Sie sind beim Buchstaben "S"
- derzeit sind 1.121 Begriffe eingetragen!
|
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Länderkennzeichen für Schweden. Kennbuchstabe der gräflich Mansfeld'schen Münzstätte in Schraplau seit dem 16. Jh., der württembergischen Münzstätte in Stuttgart im 17. Jh., Schwabach auf Münzen des fränkischen Kreises und auf österreichisch-ungarischen Münzen für Schmöllnitz (Smolnik, Slowakei), auf Münzen der Helvetischen Republik für Solothurn (1798-1803), auf französischen Münzen für Troyes von ca. 1540 bis 1698 (zeitweise gekrönt) und Reims von 1679 bis 1772 (mit der hl. Ampulle), auf spanischen Münzen für Segovia bis zum 16. Jh. und Sevilla seit dem 16. Jh., auf schwedischen Münzen für Stockholm (15./16. Jh.) und auf britischen Sovereigns (1871-1931) für die Münzstätte in Sydney in Australien. In Rußland wurde es auf Silbermünzen für Helsinki (19. Jh.), für die Moldau und Walachei (1768-1774) und für die Privatmünzstätte in Sadogura des Freiherrn von Gartenberg (1771-1774). Außerdem wurde es von der amerikanischen Münzstätte in San Francisco (1854-1955) verwendet, die während des 2. Weltkriegs (zwischen 1942 und 1944) auch für die Niederlande, Curacao und die Fidschi-Inseln prägte, und es gab ein großes "S" mit einem kleinen aufgesetzten "o" von der Münzstätte in Santiago de Chile (seit 1743). zurück zurück Die Saadier waren eine muslimische Dynastie, die von 1549 bis 1664 über das heutige Marokko herrschte. Unter der Herrschaft der Wattasiden (1465–1549) befand sich Marokko in einer schweren Krise, da die Dynastie nur eine geringe Autorität besaß und das Land nicht gegen Portugal schützen konnte. Im Widerstand der religiösen Bruderschaften und Marabouts übernahmen die Saadier die Führung und errichteten eine eigenständige Machtbasis in Südmarokko. Durch die Eroberung des portugiesischen Agadir gewannen die Saadier breite Unterstützung und konnten gegen den Widerstand von Bu Hassun 1549 die Wattasiden stürzen. Die Sultane Muhammad asch-Schaich (1549–1557) und Abdallah al-Galib (1557–1574) mußten sich zunächst gegen die Osmanen behaupten. Bei Kämpfen um die Thronfolge konnte sich Abu Marwan Abd al-Malik (1576–1578) mit osmanischer Hilfe in Marokko so die Herrschaft sichern. Als der portugiesische König Sebastian I. den entthronten Abu Abdallah (1574–1576) wieder an die Macht bringen wollte, wurde das Invasionsheer bei Qsar al-Kabir vernichtend geschlagen. Nachdem Abu Marwan Abd al-Malik während der Schlacht starb, konnte sich Ahmad al-Mansur (1578–1603) als neuer Herrscher durchsetzen. Unter diesem erreichte Marokko wirtschaftlich und kulturell nochmals eine Blütezeit. Nach dem Tod al-Mansurs brachen mangels Thronfolgeregelung Machtkämpfe aus, im Laufe derer sich in Fes und Marrakesch zwei Linien der Saadier festsetzten. Während dieser Zeit nahm Marokko viele der Morisken auf, die aus Spanien vertrieben wurden. 1626 ging Fes an die Dila-Bruderschaft verloren und 1659 eroberten die Alawiden Marrakesch und beendeten die Dynastie die Saadier. zurück Hierbei handelt es sich um kleine Kupfermünzen des Herzogtums Sachsen-Coburg-Saalfeld (Sachsen-Saalfeld wurde 1735 mit Coburg vereinigt), die seit 1646 in großen Mengen geprägt wurden. Die "Saalburger Heller" wurden weit über den Bedarf des kleinen Herzogtums hinaus geprägt (ähnlich wie der Coburger Heller) und geriet im 17. und 18. Jh. in den Umlauf der umliegenden Gebiete, besonders im Kurfürstentum Sachsen und Nordbayern. zurück Bezeichnung für ein Gebot, das von einem im Saal anwesenden Bieter während einer Auktion abgegeben wird. zurück  Seit der Rückgliederung ins Deutsche Reich nannte man das Saargebiet "Saarland", auch um sich von der Zeit zwischen 1920 und 1935 deutlich abzugrenzen. Nach dem 2. Weltkrieg war es wieder französisch besetzt. Als das Gebiet 1959 in die Bundesrepublik Deutschland als Bundesland eingegliedert wurde, blieb es bei diesem Namen. Seit der Rückgliederung ins Deutsche Reich nannte man das Saargebiet "Saarland", auch um sich von der Zeit zwischen 1920 und 1935 deutlich abzugrenzen. Nach dem 2. Weltkrieg war es wieder französisch besetzt. Als das Gebiet 1959 in die Bundesrepublik Deutschland als Bundesland eingegliedert wurde, blieb es bei diesem Namen.Ende 1944 wurde das »Saarland« von alliierten Streitkräften besetzt, die zunächst das linke Saarufer einnahmen. Am 21.03.1945 war der 2. Weltkrieg zwischen Saarbrücken und Neunkirchen zu Ende. Am 20. Juli wurden die amerikanischen Truppen durch französische Streitkräfte abgelöst. zurück Sabah gehörte zu den malaiischen Staaten. zurück Marcus Asinius Sabinianus war ein römischer Gegenkaiser in der Zeit der Reichskrise des 3. Jh. Sabinianus wurde 240 von den Karthagern zum Kaiser erhoben, weil diese mit Gordian III. unzufrieden waren. Er wurde jedoch noch im selben Jahr vom Statthalter von Mauretanien besiegt. Seine eigenen Truppen lieferten ihn in Karthago aus, womit sie um Vergebung baten. zurück Russisch für Säbelmünze. zurück  Das &&Königreich Sachsen&& entstand aus dem Kurfürstentum Sachsen und existierte von 1806 bis 1918. Es gehörte von 1806 bis 1815 dem Rheinbund und von 1815 bis 1866 dem Deutschen Bund an. Seit 1867 war es Mitglied des Norddeutschen Bundes und von 1871 bis 1918 des Deutschen Reiches. Die Hauptstadt war Dresden. Das &&Königreich Sachsen&& entstand aus dem Kurfürstentum Sachsen und existierte von 1806 bis 1918. Es gehörte von 1806 bis 1815 dem Rheinbund und von 1815 bis 1866 dem Deutschen Bund an. Seit 1867 war es Mitglied des Norddeutschen Bundes und von 1871 bis 1918 des Deutschen Reiches. Die Hauptstadt war Dresden.Das Königreich Sachsen entstand am 11.12.1806 mit der Unterzeichnung eines Friedensvertrages zwischen Frankreich und Sachsen in Posen. Mit dem Frieden von Posen schied Sachsen aus dem Vierten Koalitionskrieg aus, nachdem die sächsisch-preußischen Truppen im Oktober 1806 von Napoleon bei Jena und Auerstedt vernichtend geschlagen worden waren und Preußen den sächsischen Verbündeten im Stich gelassen hatte. Im Posener Frieden mußte das von Napoleon alsbald besetzte Sachsen dem Rheinbund beitreten und verschiedene in Thüringen gelegene Gebiete abtreten, erhielt dafür aber als Entschädigung die preußische Enklave um Cottbus zugesagt und wurde nach Bayern und Württemberg nun ebenfalls zum Königreich erhoben. Außerdem wurde in Sachsen das römisch-katholische dem evangelisch-lutherischen Bekenntnis rechtlich gleichgestellt. Am 20.12.1806 erfolgte die Ausrufung des regierenden Kurfürsten Friedrich August des Gerechten zum König von Sachsen. Die Verkündung stieß auf kein besonderes Echo, vermutlich deshalb, weil der Königstitel seit mehr als einhundert Jahren in Sachsen geläufig war, denn seit 1697 war Kurfürst August der Starke König von Polen, 1733 folgte ihm sein Sohn als König August III. auf dem polnischen Thron. Dessen Sohn, Kurfürst Friedrich Christian, regierte 1763 nur ein Vierteljahr lang und damit zu kurz, um in Polen zum König gewählt werden zu können. Friedrich August der Gerechte erklärte zwei Jahre nach seinem Regierungsantritt zunächst den Verzicht auf die polnische Krone (1765), wurde aber in der vom Sejm 1791 verabschiedeten Polnischen Verfassung zum Thronnachfolger bestimmt. Die Königswürde empfing Friedrich August gleichwohl erst Ende 1806 aus der Hand Napoleons und diesmal nun als sächsische Krone. Wenige Monate danach wurde er allerdings auch als Herrscher in Polen eingesetzt. Hervorgegangen ist das Königreich aus dem Kurfürstentum Sachsen, dessen um 1800 erreichter Gebietsstand hauptsächlich im Ergebnis der Übertragung der sächsischen Kurwürde an die wettinischen Markgrafen von Meißen 1423, dem Übergang der Kurwürde von den ernestinischen an die albertinischen Wettiner nach der Wittenberger Kapitulation 1547 sowie dem Zugewinn von Ober- und Niederlausitz im Prager Frieden 1635 resultierte. zurück Das alte, ostdeutsche Stammesherzogtum Sachsen ist mit dem heutigen Bundesland nicht identisch. Nachdem die Askanier als Herzöge des Landes teilten, wurde die Gegend um Wittenberg das eigentliche "Sachsen". Die Markgrafen von Meißen erhielten es 1423 als Lehen wurden zu Kurfürsten erhoben. Im Laufe der Zeit entwickelten sich viele Nebenlinien, die zu einer Aufsplitterung des Landes führten. Es gab aber auch Erbfolgen, die zu Vereinigungen führten. Schon in früher Zeit gab es einen großen Reichtum an Silber, das im deutschen Geldwesen eine große Rolle spielte. Sächsisches Geld gerne überall angenommen. Zur Zeit der Groschen besaß es sogar eine beherrschende Stellung und auch bei der Prägung von Guldengroschen nahm Sachsen eine führende Stellung ein. Die Geschichte des sächsischen Geldes ist allerdings recht unübersichtlich und kompliziert, da jede Nebenlinie ihr eigenes Münzrecht besaß und davon auch zum Teil reichlich Gebrauch machte. Die Prägetätigkeit dauerte bis ins 20. Jh. zur Zeit des Deutschen Reiches. zurück  &&Sachsen-Altenburg&& war ein Herzogtum und Bundesstaat des Deutschen Reiches im Gebiet des heutigen Bundeslandes Thüringen. Das Herzogtum Sachsen-Altenburg bestand aus zwei räumlich voneinander getrennten Gebieten, dem Ostkreis mit den Städten Altenburg, Schmölln, Gößnitz, Lucka und Meuselwitz mit den Exklaven Mumsdorf, Roschütz, Hilbersdorf, Neukirchen bei Waldenburg und Rußdorf bei Chemnitz sowie dem Westkreis mit den Städten Eisenberg, Kahla, Orlamünde und Roda und der Exklave Ammelstädt. Der Ostkreis des Herzogtums entsprach in seinen Grenzen ungefähr dem heutigen Landkreis Altenburger Land im Freistaat Thüringen, zusätzlich gehört das Gebiet um Ronneburg zum Landkreis Greiz. Der Westkreis liegt heute größtenteils im Saale-Holzland-Kreis, zu kleineren Teilen auch in angrenzenden Landkreisen
Das Herzogtum gehörte im Mittelalter zur Markgrafschaft Meißen und seit der Leipziger Teilung von 1485 zum Gesamtbesitz der Ernestiner. Nach weiteren Landesteilungen gehörte es seit 1672 zu Sachsen-Gotha. Nach dem Aussterben der Linie Sachsen-Gotha-Altenburg 1826 fiel ganz Sachsen-Hildburghausen und der Saalfelder Teil von Sachsen-Coburg-Saalfeld an Sachsen-Meiningen. Herzog Friedrich III. von Sachsen-Hildburghausen erhielt dafür im Gegenzug Sachsen-Altenburg als selbständiges Herzogtum. &&Sachsen-Altenburg&& war ein Herzogtum und Bundesstaat des Deutschen Reiches im Gebiet des heutigen Bundeslandes Thüringen. Das Herzogtum Sachsen-Altenburg bestand aus zwei räumlich voneinander getrennten Gebieten, dem Ostkreis mit den Städten Altenburg, Schmölln, Gößnitz, Lucka und Meuselwitz mit den Exklaven Mumsdorf, Roschütz, Hilbersdorf, Neukirchen bei Waldenburg und Rußdorf bei Chemnitz sowie dem Westkreis mit den Städten Eisenberg, Kahla, Orlamünde und Roda und der Exklave Ammelstädt. Der Ostkreis des Herzogtums entsprach in seinen Grenzen ungefähr dem heutigen Landkreis Altenburger Land im Freistaat Thüringen, zusätzlich gehört das Gebiet um Ronneburg zum Landkreis Greiz. Der Westkreis liegt heute größtenteils im Saale-Holzland-Kreis, zu kleineren Teilen auch in angrenzenden Landkreisen
Das Herzogtum gehörte im Mittelalter zur Markgrafschaft Meißen und seit der Leipziger Teilung von 1485 zum Gesamtbesitz der Ernestiner. Nach weiteren Landesteilungen gehörte es seit 1672 zu Sachsen-Gotha. Nach dem Aussterben der Linie Sachsen-Gotha-Altenburg 1826 fiel ganz Sachsen-Hildburghausen und der Saalfelder Teil von Sachsen-Coburg-Saalfeld an Sachsen-Meiningen. Herzog Friedrich III. von Sachsen-Hildburghausen erhielt dafür im Gegenzug Sachsen-Altenburg als selbständiges Herzogtum.Nachdem das Herzogtum Sachsen-Altenburg am 29.04.1831 eine Verfassung erhalten hatte, trat es 1833/34 als souveräner Bundesstaat dem Deutschen Zollverein bei, 1867 dem Norddeutschen Bund und schließlich 1871 dem Deutschen Reich. Als letzter Regent des Herzogtums Sachsen-Altenburg dankte am 13.11.1918 Herzog Ernst II. ab und der Freistaat Sachsen-Altenburg wurde gegründet. Letzter herzoglicher Staatsminister war Waldemar von Wussow (1915-1918). zurück  &&Sachsen-Coburg&& war ein ernestinisches Fürstentum mit dem oberfränkischen Coburg als Residenzstadt. Als Heinrich VIII. von Henneberg-Schleusingen 1347 starb, wurde der Besitz des Hauses Henneberg-Schleusingen zwischen der Witwe Jutta von Brandenburg und Heinrichs jüngerem Bruder Johann aufgeteilt, wobei Jutta die sogenannte neue Herrschaft, unter anderem mit Coburg, zugesprochen bekam. Sechs Jahre später folgte nach dem Tod von Jutta die endgültige Aufteilung der neuen Herrschaft unter drei ihrer Töchter. Die zweite Tochter Katharina von Henneberg bekam den südöstlichen Teil mit dem Coburger Land zugesprochen. &&Sachsen-Coburg&& war ein ernestinisches Fürstentum mit dem oberfränkischen Coburg als Residenzstadt. Als Heinrich VIII. von Henneberg-Schleusingen 1347 starb, wurde der Besitz des Hauses Henneberg-Schleusingen zwischen der Witwe Jutta von Brandenburg und Heinrichs jüngerem Bruder Johann aufgeteilt, wobei Jutta die sogenannte neue Herrschaft, unter anderem mit Coburg, zugesprochen bekam. Sechs Jahre später folgte nach dem Tod von Jutta die endgültige Aufteilung der neuen Herrschaft unter drei ihrer Töchter. Die zweite Tochter Katharina von Henneberg bekam den südöstlichen Teil mit dem Coburger Land zugesprochen.Markgraf Friedrich III. von Meißen aus dem Haus Wettin, Gemahl von Katharina von Henneberg, forderte zwar schon nach der Heirat 1346 die Mitgift seiner Frau, die sogenannte Coburger Pflege, was allerdings auf Widerstand bei seinem Schwiegervater stieß. So konnte Friedrich III. von Meißen erst nach dem Tod von Jutta im Jahr 1353 den Besitz belehnen. Damit bildete die Pflege Coburg den südlichsten Teil der sächsischen Territorien. Mit der "Großen Sächsischen Landesteilung" 1485 in eine albertinische und eine ernestinische Linie fiel die Pflege Coburg zusammen mit dem größeren Teil der Landgrafschaft Thüringen und den vogtländischen Besitzungen an Ernst von Sachsen und wurde dadurch der ernestinischen Linie zugeteilt. Nach dem 1547 verlorenen Schmalkaldischen Krieg wurde der Territorialbesitz der Ernestiner in Thüringen stark reduziert (siehe auch Geschichte Thüringens). Da die Ämter der Pflege Coburg aber Herzog Johann Ernst als Ausstattung zugeteilt waren, blieben sie unberührt von den Maßnahmen gegen den geächteten Kurfürsten. Als Johann Ernst kinderlos 1553 starb, war der vormalige Kurfürst Johann Friedrich I., jetzt nur noch Herzog von Sachsen, gerade aus der Haft entlassen und starb seinerseits schon 1554. Die Pflege Coburg erhielt Herzog Johann Friedrich II. der Mittlere zu seinem Erbanteil. Er regierte von Gotha aus gemeinsam mit seinen Brüdern Johann Wilhelm (in Weimar residierend) und Johann Friedrich, "dem Jüngeren". Nach dem frühen Tod des jüngsten Bruders kam es zu einer vorläufigen Teilung des ernestinischen Gesamtbesitzes, wobei die Brüder eine "Mutschierung", also einen Wechsel in der Regierung, alle 3 Jahre vereinbarten. Johann Friedrich II. regierte in Gotha, Eisenach und Coburg, geriet aber in seinem Bemühen, die Kurwürde wieder für sich und sein Haus zurückzugewinnen, in Konflikt mit dem Kaiser (Grumbachsche Händel) und wurde schließlich geächtet und bis an sein Lebensende gefangen gesetzt. Sein Besitz fiel zunächst an seinen Bruder Johann Wilhelm, der sich an der Reichsexekution an der Seite von Kurfürst August von Sachsen beteiligt hatte, wurde jedoch in der Erfurter Teilung 1572 an seine Söhne zurückgegeben. Mit dem Erfurter Teilungsvertrag von 1572 wurde das verbliebene Land schließlich zwangsweise auf die Söhne des unterlegenen Kurfürsten Johann Friedrich aufgeteilt (Siehe auch: Johann Ernst I. von Coburg). Der jüngere Sohn Johann Wilhelm erhielt Sachsen-Weimar unter anderem mit den Städten Jena, Altenburg und Saalfeld. Da der ältere Sohn Johann Friedrich II. (der Mittlere) in lebenslänglicher Gefangenschaft in Österreich war, bekamen die minderjährigen Enkel Johann Casimir und Johann Ernst das neue Fürstentum Sachsen-Coburg mit Coburg als Residenzstadt zugeteilt. Das Fürstentum bestand aus süd- und westthüringischen Gebieten, u. a. mit den Städten Eisenach, Gotha und Hildburghausen. Vormund der Kinder war unter anderem Kurfürst August von Sachsen, der für eine Erziehung unter seiner Aufsicht und in seinem Sinne sorgte sowie eine korrupte kursächsische Vormundschaftsregierung in Coburg einsetzte. Erst nach dem Tode von Kurfürst August von Sachsen 1586 konnte Herzog Johann Casimir zusammen mit seinem Bruder Johann Ernst die Regierung des Fürstentums übernehmen. 1596 wurde für Johann Ernst das Fürstentum Sachsen-Eisenach abgespalten, und Casimir regierte in Coburg alleine weiter. Sein Herrschaftsgebiet bestand aus den Ämtern Coburg mit den Gerichten Lauter, Rodach und Gestungshausen, Heldburg mit Gericht Hildburghausen, Römhild, Eisfeld, Schalkau, Sonneberg, Neustadt, Neuhaus, Mönchröden und Sonnefeld. Unter ihm gab es eine rege Bautätigkeit in Coburg. Vor allem errichtete er aber als Kern Coburger Staatlichkeit einen Verwaltungsapparat, der über seinen Tod hinweg lange bestand und viele politische Umwälzungen überlebte. 1633 starb Casimir, der Gründer des coburgischen Staates, kinderlos. Das Fürstentum Sachsen-Coburg fiel an Sachsen-Eisenach des ebenfalls kinderlosen Bruders Johann Ernst. In dieser Zeit wurde das Coburger Land durch den Dreißigjährigen Krieg als Durchgangsstation zahlreicher Heere stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Einwohnerzahl reduzierte sich von 55.000 auf 22.000. 1638 erlosch dann die Coburg-Eisenacher Linie der Ernestiner und das Territorium wurde zwischen Sachsen-Weimar und Sachsen-Altenburg aufgeteilt. zurück Das Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha entstand 1826 aus den ernestinischen Herzogtümern Sachsen-Coburg und Sachsen-Gotha. Es wurde zuerst durch Herzog Ernst I. in Personalunion regiert, die 1852 unter Herzog Ernst II. zu einer Realunion ausgeweitet wurde. Das Doppelherzogtum wurde damit zu einem quasiföderalen Einheitsstaat. zurück Nachdem Herzog Ernst I. der Fromme von Sachsen-Gotha am 26.03.1675 in Gotha gestorben war, wurde das Fürstentum 1680 unter seinen sieben Söhnen aufgeteilt. Nach dem Tod von Herzog Johann Ernst 1729 regierten seine Söhne Christian Ernst und Franz Josias das Land gemeinsam, jedoch von verschiedenen Residenzorten aus. 1747 konnte er das Erstgeburtsrecht (Primogenitur) bei der Thronfolge gesetzlich verankern und sorgte so zusammen mit einer rasch anwachsenden Familie für das dauerhafte Überleben des Hauses Sachsen-Coburg-Saalfeld. Am 15.12.1806 trat Sachsen-Coburg-Saalfeld mit den übrigen ernestinischen Fürstentümern dem Rheinbund bei. Vom November 1806 bis zum Frieden von Tilsit im Juli 1807 war das Fürstentum französisch besetzt. Herzog Ernst I. konnte erst danach aus Königsberg in Ostpreußen in sein Land zurückkehren. Ein Grenzvertrag mit dem Königreich Bayern führte 1811 zu einem territorialen Ausgleich über strittige Gebiete. 1813 auf Seite der Alliierten kämpfend, brachte der Wiener Kongreß 1815 mit einem Gebiet links vom Rhein, später Fürstentum Lichtenberg genannt, territorialen Zuwachs für den Landesherrn sowie die Mitgliedschaft im Deutschen Bund. Das Aussterben der ältesten Linie Sachsen-Gotha-Altenburg 1825 führte wieder zu Erbstreitigkeiten in der Familie der Ernestiner. Am 12.11.1826 führte der Schiedsspruch des Familienoberhaupts, König Friedrich August I. von Sachsen, zur umfassenden Neugliederung der ernestinischen Herzogtümer. Das neue Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha als Personalunion der beiden Herzogtümer Sachsen-Coburg und Sachsen-Gotha war entstanden.
zurück  &&Sachsen-Eisenach&& war ein ernestinisches Herzogtum im heutigen Thüringen und ein Territorium des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Die Hauptstadt war Eisenach. Sachsen-Eisenach wurde im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation als Fürstentum geführt und war als solches Mitglied im Obersächsischen Kreis. Seit das Haus Wettin 1423 durch Übertragung des Herzogtums Sachsen-Wittenberg die Kurfürstenwürde und den Herzogstitel des alten Stammesherzogtums Sachsen erwarb, trugen alle Mitglieder der Familie, unabhängig davon, ob sie regierten oder nicht, den Titel eines "Herzogs zu Sachsen". Als ältester und vornehmster Titel ging dieser Titel allen anderen Titeln voran (mit Ausnahme des Kurfürstentitels, diesen hatten die Ernestiner allerdings 1547 dauerhaft an die Albertiner verloren). Da der "Fürst von Eisenach" als Ernestiner zugleich auch "Herzog zu Sachsen" war, und dieser Titel dem Fürstentitel voranging, wird auch vom "Herzogtum Sachsen-Eisenach" gesprochen. &&Sachsen-Eisenach&& war ein ernestinisches Herzogtum im heutigen Thüringen und ein Territorium des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Die Hauptstadt war Eisenach. Sachsen-Eisenach wurde im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation als Fürstentum geführt und war als solches Mitglied im Obersächsischen Kreis. Seit das Haus Wettin 1423 durch Übertragung des Herzogtums Sachsen-Wittenberg die Kurfürstenwürde und den Herzogstitel des alten Stammesherzogtums Sachsen erwarb, trugen alle Mitglieder der Familie, unabhängig davon, ob sie regierten oder nicht, den Titel eines "Herzogs zu Sachsen". Als ältester und vornehmster Titel ging dieser Titel allen anderen Titeln voran (mit Ausnahme des Kurfürstentitels, diesen hatten die Ernestiner allerdings 1547 dauerhaft an die Albertiner verloren). Da der "Fürst von Eisenach" als Ernestiner zugleich auch "Herzog zu Sachsen" war, und dieser Titel dem Fürstentitel voranging, wird auch vom "Herzogtum Sachsen-Eisenach" gesprochen.Auf Grund der ernestinischen Erbfolgeregelungen kam es im Zuge der jeweiligen Landesteilungen meist zu einer weiteren Aufsplitterung des Gesamtstaates, hiervon war auch das Eisenacher Gebiet in unterschiedlichem Umfang betroffen. Seine Unabhängigkeit verlor es hin und wieder, wenn die regierende Herzogslinie ausstarb und das Land im Zuge von gegenseitigen Erbverträgen mit anderen ernestinischen Ländern vereinigt wurde. Die eigenständige Geschichte des Herzogtums endete 1741 endgültig, als es an den ernestinischen Herzog Ernst August I. von Sachsen-Weimar fiel. 1809 wurde Sachsen-Eisenach unter Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach per Verfassung auch staatsrechtlich mit Sachsen-Weimar zum Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach zusammengelegt und stieg 1815 auf dem Wiener Kongreß zum Großherzogtum auf. zurück  &&Sachsen-Gotha&& war ein sogenanntes ernestinisches Herzogtum im heutigen Freistaat Thüringen. Es wurde 1640 gegründet und 1672 zum Herzogtum Sachsen-Gotha und Altenburg erweitert. Im Jahr 1680 wurde es in einer Erbteilung in sieben verschiedene Herzogtümer aufgeteilt. Sachsen-Gotha entstand 1640 aus einer Erbteilung des Herzogtums Sachsen-Weimar und fiel an Herzog Ernst I. von Sachsen-Gotha (der Fromme), den zweitjüngsten Sohn Herzog Johanns III. von Sachsen-Weimar. Ernst I. wählte für sein Fürstentum Gotha als Residenzstadt. In den 35 Jahren seiner Regentschaft konnte er das Herzogtum durch Erbschaften erheblich vergrößern: &&Sachsen-Gotha&& war ein sogenanntes ernestinisches Herzogtum im heutigen Freistaat Thüringen. Es wurde 1640 gegründet und 1672 zum Herzogtum Sachsen-Gotha und Altenburg erweitert. Im Jahr 1680 wurde es in einer Erbteilung in sieben verschiedene Herzogtümer aufgeteilt. Sachsen-Gotha entstand 1640 aus einer Erbteilung des Herzogtums Sachsen-Weimar und fiel an Herzog Ernst I. von Sachsen-Gotha (der Fromme), den zweitjüngsten Sohn Herzog Johanns III. von Sachsen-Weimar. Ernst I. wählte für sein Fürstentum Gotha als Residenzstadt. In den 35 Jahren seiner Regentschaft konnte er das Herzogtum durch Erbschaften erheblich vergrößern:- nach dem Erlöschen der Linie Sachsen-Eisenach 1645 um die Hälfte des Fürstentums Eisenach, - 1660 um Teile der endgültig geteilten Grafschaft Henneberg, - nach dem Erlöschen der Linie Sachsen-Altenburg 1672 um drei Viertel der altenburgischen Gebiete einschließlich Coburg. Das Fürstentum trug seit dieser Vergrößerung den Namen Sachsen-Gotha und Altenburg. Herzog Ernst I. starb 1675 und hinterließ sieben Söhne, die sich zunächst die Regentschaft teilten, da die Ernestiner bis dahin die Primogenitur in der Erbfolge ablehnten. Der älteste Sohn leitete zunächst nach dem Wunsch des Vaters als Herzog Friedrich I. die Regierungsgeschäfte. Der Versuch der gemeinsamen Hofhaltung im Schloß Friedenstein in Gotha scheiterte jedoch, und 1680 wurde das Erbe unter den sieben Brüdern aufgeteilt. zurück Das Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg war ein ernestinisches Herzogtum auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Thüringen. 1806 trat Sachsen-Gotha-Altenburg dem Rheinbund und 1815 dem Deutschen Bund bei. Das Aussterben der Dynastie im Jahr 1825 führte zur Aufteilung, nämlich Sachsen-Gotha kam zu Sachsen-Coburg, und Sachsen-Altenburg kam an den Herzog von Sachsen-Hildburghausen, der das kleine Hildburghausen an Sachsen-Meiningen abgab. zurück  Durch den Erbteilungsvertrag 1680 unter den sieben Söhnen des Herzogs Ernsts I. von Sachsen-Gotha entstand u. a. das Fürstentum Sachsen-Hildburghausen, das dem zweitjüngsten Sohn Ernst zugesprochen wurde. Die volle Souveränität von Gotha wird jedoch erst 1702 eingeräumt, als das Fürstentum mit der Landeshoheit ausgestattet wird. Durch den Erbteilungsvertrag 1680 unter den sieben Söhnen des Herzogs Ernsts I. von Sachsen-Gotha entstand u. a. das Fürstentum Sachsen-Hildburghausen, das dem zweitjüngsten Sohn Ernst zugesprochen wurde. Die volle Souveränität von Gotha wird jedoch erst 1702 eingeräumt, als das Fürstentum mit der Landeshoheit ausgestattet wird.Zum Fürstentum gehörten Amt und Stadt Hildburghausen, Amt und Stadt Heldburg, heute Teil von Bad Colberg-Heldburg, Amt und Stadt Eisfeld, das Amt Veilsdorf und das halbe Amt Schalkau. 1683 kamen das Amt Königsberg und 1705 das Amt Sonnefeld hinzu. Außerdem erhielt das Fürstentum nach Beendigung der Erbschaftsstreitigkeiten 1714 im Tausch gegen Schalkau Teile von Sachsen-Römhild, das Amt Behrungen, die Echterschen Lehen und Milz. 1684 wurde Hildburghausen zur Residenzstadt erhoben und entsprechend bebaut. Jedoch zerrütteten der aufwendige Hofstaat und die Bauten der Fürsten die Finanzen des Fürstentums so stark, daß ab 1769 eine Zwangsschuldenverwaltung durch eine kaiserliche Debitkommision für die folgenden Jahren durchgeführt wurde, zu deren Direktorin die Regentin Charlotte Amalie von Sachsen-Meiningen bestellt wurde. Mit der Auflösung des alten Reiches im Jahre 1806 erhielt auch Sachsen-Hildburghausen die volle Souveränität und aus dem Fürstentum wurde das Herzogtum Sachsen-Hildburghausen, das 1806 dem Rheinbund und 1815 dem Deutschen Bund beitritt. Als eines der ersten deutschen Länder hatte das Herzogtum schon 1818 eine Verfassung. Das Aussterben der Linie Sachsen-Gotha-Altenburg im Jahre 1826 erforderte eine Neuordnung der ernestinischen Herzogtümer und die Güter Sachsen-Hildburghausens fallen bis auf die Ämter Königsberg und Sonnefeld, die Sachsen-Coburg und Sachsen-Gotha zugeschlagen wurden, an Sachsen-Meiningen. Herzog Friedrich von Sachsen-Hildburghausen übernahm dafür das Herzogtum Sachsen-Altenburg. zurück Das Herzogtum && Sachsen-Lauenburg&& war ein seit 1296 reichsunmittelbares Fürstentum im äußersten Südosten des heutigen Schleswig-Holsteins mit dem territorialen Schwerpunkt in dem heutigen nach ihm benannten Kreis Herzogtum Lauenburg. Neben dem Kernterritorium um Lauenburg und Ratzeburg gehörten zeitweise aber auch andere Territorien hinzu, wie das Land Hadeln im Elbmündungsgebiet, das Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg nördlich der Elbe, die Elbmarschen des heutigen Kreises Lüneburg sowie die Stadt Bergedorf mit den Vierlanden, die heute zu Hamburg gehören. Das Herzogtum entstand 1296 durch Teilung des Rest-Herzogtums Sachsen. Residenzorte des Herzogtums waren die Städte Ratzeburg und Lauenburg. Das Herzogtum Sachsen-Lauenburg war ein seit 1296 reichsunmittelbares Fürstentum im äußersten Südosten des heutigen Schleswig-Holsteins mit dem territorialen Schwerpunkt in dem heutigen nach ihm benannten Kreis Herzogtum Lauenburg. Neben dem Kernterritorium um Lauenburg und Ratzeburg gehörten zeitweise aber auch andere Territorien hinzu, wie das Land Hadeln im Elbmündungsgebiet, das Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg nördlich der Elbe, die Elbmarschen des heutigen Kreises Lüneburg sowie die Stadt Bergedorf mit den Vierlanden, die heute zu Hamburg gehören. Das Herzogtum entstand 1296 durch Teilung des Rest-Herzogtums Sachsen. Residenzorte des Herzogtums waren die Städte Ratzeburg und Lauenburg. zurück  &&Sachsen-Meiningen&& war ein ernestinisches Herzogtum im heutigen Thüringen, das 1680 durch Teilung des Herzogtums Sachsen-Gotha unter den Söhnen des Herzogs Ernsts I. "des Frommen" von Sachsen-Gotha (1601–1675) entstand. Ab 1871 war Sachsen-Meiningen eines von 26 Bundesstaaten im Deutschen Kaiserreich. &&Sachsen-Meiningen&& war ein ernestinisches Herzogtum im heutigen Thüringen, das 1680 durch Teilung des Herzogtums Sachsen-Gotha unter den Söhnen des Herzogs Ernsts I. "des Frommen" von Sachsen-Gotha (1601–1675) entstand. Ab 1871 war Sachsen-Meiningen eines von 26 Bundesstaaten im Deutschen Kaiserreich.Der drittälteste Sohn Bernhard I. bekam das neue Fürstentum Sachsen-Meiningen. Wie bei den älteren Brüdern, Herzog Friedrich von Sachsen-Gotha und Herzog Albrecht von Sachsen-Coburg, erhielt Sachsen-Meiningen volle Landeshoheit im Reichsverband. Durch das Aussterben der Linien Sachsen-Coburg 1699 und Sachsen-Römhild 1710 wurde das Territorium des Fürstentums nach jeweils langen und zum Teil kriegerischen Erbauseinandersetzungen (Themarer Krieg) deutlich vergrößert. 1735 wurde das Amt Neuhaus und Gericht Sonneberg von Sachsen-Coburg und 1753 Zweidrittel der Herrschaft Römhild Sachsen-Meiningen zugesprochen. Sachsen-Meiningen hatte bereits 1723 die Hälfte von Sachsen-Hildburghausen und 1729 auch die schaumbergische Hälfte des Amtes Schalkau sowie 1732 den schaumbergischen Gerichtsbezirk Rauenstein erworben. 1742 entstand aus dem Gericht Sonneberg ein Amt Sonneberg, das zusammen mit den Ämtern Schalkau und Neuhaus sowie dem Gericht Rauenstein ein räumlich vom Kerngebiet Sachsen-Meiningen um die Residenzstadt Meiningen durch Sachsen-Hildburghausen getrenntes Gebiet bildete, für das sich die Bezeichnung „Meininger Oberland“ einbürgerte. Die letzte Neuordnung und Territoriumsveränderung der ernestinischen Herzogtümer erfolgte nach dem Aussterben der Linie Sachsen-Gotha-Altenburg im Jahre 1826. Bis auf die Ämter Königsberg und Sonnefeld erhielt Sachsen-Meiningen ganz Sachsen-Hildburghausen, die Ämter Saalfeld, Gräfenthal und Themar (bisher zu Sachsen-Coburg-Saalfeld), Camburg und Kranichfeld und 1/3 Amt Römhild (bisher zu Sachsen-Gotha-Altenburg) zugesprochen. Sachsen-Coburg-Saalfeld bekam dafür Sachsen-Gotha, das in Personalunion als Doppelherzogtum Sachsen-Coburg und Gotha verwaltet wurde. Der Herzog Friedrich von Sachsen-Hildburghausen wurde zum Ausgleich mit Sachsen-Altenburg abgefunden. Im Deutschen Krieg 1866 stand Sachsen-Meiningen auf der Seite Österreichs, so daß eine preußische Kriegserklärung am 11. Juli erfolgte. Nach der Niederlage Österreichs und dem späteren Austritt am 26. Juli aus dem Deutschen Bund ersuchte Herzog Bernhard II. um die Aufnahme in den Norddeutschen Bund. Dieses wurde ihm nur unter der Bedingung der Abdankung zu Gunsten seines damals preußenfreundlichen Sohnes Georg II. zugesagt. Nach langwierigen Verhandlungen über einen Auseinandersetzungsvertrag mit seinem Sohn dankte der Herzog schließlich am 20. September nach dem Einrücken eines preußischen Infanterieregimentes in Meiningen zu Gunsten des Erbprinzen Georg ab. So konnte am 8. Oktober ein Friedensvertrag geschlossen werden, der lediglich gegen Abtretung des Dorfes Abtlöbnitz bei Camburg, ohne weitere Kriegsentschädigungen, die Aufnahme in den Norddeutschen Bund ermöglichte. 1871 wurde das Herzogtum Mitglied des Deutschen Reiches, das den Norddeutschen Bund ersetzte. Im Bundesrat in Berlin ließ es sich durch das Königreich Bayern vertreten und nicht wie die meisten anderen thüringischen Staaten durch das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach. Nach der Abdankung des Herzogs 1918 wurde aus dem Herzogtum der Freistaat Sachsen-Meiningen. zurück  Das &&Herzogtum Sachsen-Weimar&& war ein Land des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Thüringen und wurde von den ernestinischen Wettinern regiert. Die Haupt- und Residenzstadt war Weimar. Es entstand bei der Erfurter Teilung 1572 und ging 1741 im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach (seit 1815 Großherzogtum) auf. Das &&Herzogtum Sachsen-Weimar&& war ein Land des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Thüringen und wurde von den ernestinischen Wettinern regiert. Die Haupt- und Residenzstadt war Weimar. Es entstand bei der Erfurter Teilung 1572 und ging 1741 im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach (seit 1815 Großherzogtum) auf.In Sachsen-Weimar wurde der Achtbrüdertaler geprägt. zurück  Sachsen-Weimar-Eisenach war ein ernestinisches Herzogtum im heutigen Thüringen und ein Territorium des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Die Hauptstadt war Weimar. Es entstand 1741, als das Herzogtum Sachsen-Eisenach an das Herzogtum Sachsen-Weimar fiel. 1809 wurden Sachsen-Eisenach und Sachsen-Weimar unter Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach per Verfassung auch staatsrechtlich zum Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach vereinigt. Sachsen-Weimar-Eisenach war ein ernestinisches Herzogtum im heutigen Thüringen und ein Territorium des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Die Hauptstadt war Weimar. Es entstand 1741, als das Herzogtum Sachsen-Eisenach an das Herzogtum Sachsen-Weimar fiel. 1809 wurden Sachsen-Eisenach und Sachsen-Weimar unter Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach per Verfassung auch staatsrechtlich zum Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach vereinigt.Auf dem Wiener Kongreß erlangte das Herzogtum 1815 den Status eines Großherzogtums. Ab 1903 bezeichnete es sich als Großherzogtum Sachsen. Dem seit 1572 bestehenden Herzogtum Sachsen-Weimar fiel 1741 das Herzogtum Sachsen-Eisenach zu, da die Linie mit dem Tod Herzog Wilhelm Heinrichs erlosch. Erster Herzog des vereinten Landes Sachsen-Weimar-Eisenach war Ernst August, der Bauherr des Schlosses Belvedere bei Weimar. Sein Sohn Ernst August Konstantin regierte nur drei Jahre und starb im Alter von 20 Jahren. Mit achtzehn Jahren hatte er die ein Jahr jüngere braunschweigische Prinzessin Anna Amalia, eine Nichte des preußischen Königs Friedrich II., geheiratet. Sie gebar ein Jahr später ihren Sohn Carl August und nach einem weiteren Jahr, schon als Witwe, den Sohn Konstantin. Als Herzogin-Mutter übernahm Anna Amalia mit Zustimmung der Kaiserin Maria Theresia und der Unterstützung ihres integren Ministers Freiherr von Fritsch tatkräftig die Regentschaft des Landes Sachsen-Weimar und Eisenach. Als Prinzenerzieher gewann sie den Dichter Christoph Martin Wieland, damals Professor an der Erfurter Universität. Mit 18 Jahren volljährig, heiratete Carl August die hessische Prinzessin Luise und rief den Dichter Johann Wolfgang Goethe, mit dem ihn bald eine tiefe Freundschaft verband, an seinen Hof. Goethe sorgte für die Berufung Johann Gottfried Herders und Friedrich Schillers. So wuchs, im Hintergrund von Anna Amalia gefördert, der Kreis der Weimarer Klassik, deren Erbe zu hüten, sich die folgenden Regenten zur Aufgabe machten. Die Hochzeit des Erbprinzen Carl Friedrich mit der russischen Großfürstin Maria Pawlowna 1804 brachte dem Land den Schutz des russischen Zaren Alexander I., den es in den Wirren der napoleonischen Kriege brauchte. Dem Einfluß Alexanders verdankte Carl August auf dem Wiener Kongreß 1815 die Erhebung zum Großherzog und mit 1700 qkm eine umfangreiche Vergrößerung und Abrundung seines Landes. Das Herzogtum erhielt Teile des Kreises Neustadt a. d. Orla (629 qkm Fläche), große Teile der Mainzer Enklave Erfurt und weitere kleine Herrschaften wie zum Beispiel Blankenhain, Kranichfeld. In der Rhön wurde das Eisenacher Oberland geschaffen, dieses bestand aus angrenzenden Gebietsteilen von Hessen und des zuvor säkularisierten Kloster Fulda. National gesinnt und weltoffen zugleich gab der Fürst seinem Land als erstem in Deutschland am 05.05.1816 eine liberale, sog. landständische Verfassung. Die in der Urburschenschaft organisierten Studenten der Universität Jena feierten im Oktober 1817 auf der Wartburg das Wartburgfest. Beteiligt waren viele liberal Gesinnte, die meist studentischen Redner auf dem Fest jedoch müssen bereits der frühen deutschen Demokratie zugerechnet werden. Maria Pawlowna, seit 1828 Großherzogin, leitete das silberne Zeitalter Weimars ein, das mit Namen wie Franz Liszt und Peter Cornelius vor allem der Musik galt. Ihr kunstsinniger Sohn Carl Alexander (1818-1901) wirkte im gleichen Sinn. Verheiratet mit der Oranierin Sophie, die seine Pläne unterstützte, ließ er die verfallende Wartburg im damals üblichen Stil eines romantischen Historismus renovieren und von Moritz von Schwind ausmalen. Die Gründung der Kunstgewerbeschule Weimar, die 1919 im Bauhaus aufging, wurde von ihm, wenn auch halbherzig, gefördert. Auf Carl Alexander folgte 1901 sein Enkel Wilhelm Ernst, verheiratet in erster Ehe mit Karoline von Reuß Ältere Linie und in zweiter mit Feodora von Sachsen-Meiningen. Am 09.11.1918 verzichtete er auf den Thron. Damit endete die Monarchie im Großherzogtum Sachsen (so amtlich seit 1903). Das Großherzogtum wurde zum Freistaat Sachsen-Weimar-Eisenach und ging 1920 im neu gegründeten Land Thüringen mit Weimar als Landeshauptstadt auf. zurück Das Herzogtum Sachsen-Weißenfels war ein Fürstentum im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Es bestand von 1656/57 bis 1746. Die Residenzstadt war Weißenfels. Das Herzogtum befand sich im Besitz einer Seitenlinie der albertinischen Wettiner. zurück  &&Sachsen-Wittenberg&& war ein historisches Territorium des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Das Herzogtum Sachsen-Wittenberg entstand 1296 durch die Teilung des askanischen Herzogtums Sachsen und erstreckte sich über die heutigen Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Durch die Goldene Bulle von 1356 erlangten die Herzog von Sachsen-Wittenberg die Kurwürde. &&Sachsen-Wittenberg&& war ein historisches Territorium des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Das Herzogtum Sachsen-Wittenberg entstand 1296 durch die Teilung des askanischen Herzogtums Sachsen und erstreckte sich über die heutigen Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Durch die Goldene Bulle von 1356 erlangten die Herzog von Sachsen-Wittenberg die Kurwürde.Nach dem Aussterben der Askanier im Mannesstamme 1422 gingen Herzogtum und Kurwürde 1423 an die meißnischen Wettiner über. 1134 wurde Albrecht der Bär von dem deutschen König Lothar von Supplinburg als Markgraf der Nordmark (Altmark) eingesetzt. Er gehörte zu dem Geschlecht der Askanier, die sich nach der Burg Askanien an der Eine am Ostrand des Harzes nennen. Auf seinen Heereszügen gegen die altsorbischen Slawenstämme eroberte er 1157 Brandenburg. Deshalb legt er sich den Titel Markgraf von Brandenburg zu und dehnte seine Herrschaft bis südlich der Elbe aus. Allerdings wurde das vorher nicht sehr dicht bewohnte und nun unterworfene Gebiet verwüstet und von den Slawen zum Teil verlassen. Andererseits hatten Bauern und Bürger im Rheinland, in Flandern, Sachsen und Franken begonnen, sich der steigenden Lasten zu entziehen und neue Siedlungsgebiete aufzusuchen. Einen Teil dieses Stromes lenkte Albrecht in sein Gebiet. 1159/1160 ließ er unter den Rheinländern werben, vor allem aber unter den Flamen, Seeländern und Holländern, die von Überschwemmungen heimgesucht werden, wobei er günstige Lebensbedingungen versprach. Seine Zusagen fanden Gehör, die Siedler kamen ins Land. Im Süden des Markgrafentums Brandenburg ließen sich vor allem Flamen nieder, so daß der Höhenrücken, den die Eiszeit abgelagert hat, nach ihnen der Fläming genannt wurde. Die Einwanderer bezogen aber auch noch südlich davon Dörfer, sogar links der Elbe. Von der Mündung der Saale in die Elbe bis über den Zusammenfluß von Schwarzer Elster und Elbe hinaus. Oft übernahmen sie die Namen der vorhandenen, meist slawischen Siedlungen. Manchmal gaben sie ihnen einen neuen Namen; ebenso benannten sie die von ihnen gegründeten Orte. Als in der erste Phase der ostelbischen Herrschaftserrichtung deutscher Feudalherren, das Gebiet der altsorbischen Slawenstämme erobert wurde, teilte man die eroberten Gebiete zunächst in Gaue. In diesen Gauen entstanden befestigte Plätze, von denen aus die umliegende Landschaft beherrscht und verwaltet wurden. Die Anfänge Wittenbergs gehen auf eine solche Burg zurück, die durch Albrecht den Bären zum Schutz des Elbübergangs angelegt worden sein soll und die als deutscher Burgward erstmals 1187 urkundlich erwähnt wird. Förderlich für die frühstädtische Entwicklung war der Verkehr auf dem Fernhandelsweg von Magdeburg und Zerbst über Wittenberg in das Gebiet des Schwarzen Elster und die Niederlausitz oder nach Meißen, also in West-Ost-Richtung, sowie die Nord-Süd-Verbindung von Cölln bzw. Berlin über Wittenberg nach Leipzig. In der wissenschaftlichen Forschung offen blieb aufgrund des Fehlens schriftlicher Überlieferung die Frage, ob Herzog Bernhard das Gebiet um Wittenberg bereits unmittelbar nach dem Tod seines Vaters Albrechts des Bären 1170 erhielt oder erst durch Erbschaft nach dem Ableben seines Bruders Dietrich von Werben 1183. Als 1180 Heinrich der Löwe das Herzogtum Sachsen verlor, wurde der östliche Teil davon Bernhard zu Lehen gegeben. Nachdem Herzog Bernhard 1212 gestorben war, wurde sein Erbe unter seinen beiden Söhnen Heinrich und Albrecht I. aufgeteilt. Der ältere Heinrich erhielt die alten askanischen Grafschaften sowie Erb- und Stammlande in der Region des Vorharzes und der unteren Saale und wurde zum Begründer der anhaltischen Landesherrschaft, die bis 1918 in den Händen der Askanier blieb. Der jüngere Albrecht I. erhielt hingegen das Herzogtum Sachsen mit seinen Reichslehen an der mittleren Elbe sowie mehrere askanische Stammgüter östlich und direkt an der Mulde, darunter insbesondere die Region um Aken und Wittenberg sowie Streubesitz in der alten askanischen Grafschaft Aschersleben. Albrecht I. war bemüht, die Herzogsgewalt an der mittleren Elbe wiederzuerrichten, was ihm auch erfolgreich gelang. Für die von ihm in diesem Raum regierten Gebiete bürgerte sich allmählich der Name Sachsen ein, ab 1227 nannte er sich selbst Herzog von Sachsen, Engern und Westfalen. Herzog Albrecht I. beteiligte sich bereits 1252 direkt an der Wahl des Königs Wilhelm. Nach dem Tod des Herzogs Albrecht I. 1261 regierten seine beiden Söhne Johann I. und Albrecht II. zunächst gemeinsam, bis der ältere Bruder Johann I. 1282 Sonderbesitz im Norden des Herzogtums übernahm, den er schon bald seinen drei Söhnen Johann II., Albrecht III. und Ericht I. überließ, um selbst in das Franziskanerkloster Wittenberg einzutreten. Johann I. starb jedoch bereits 1286 und seine Söhne wurden der Vormundschaft ihres Onkels Albrecht I. unterstellt. Dieser bemühte sich, den Besitz zusammenzuhalten, doch als seine Neffen 1295 volljährig wurden, war die endgültige Trennung des Herzogtums Sachsen in die beiden Herzogtümer Sachsen-Lauenburg und Sachsen-Wittenberg nicht mehr aufzuhalten. Das Gebiet elbaufwärts behielt Albrecht II. und benannte es nach dem Ort seiner Residenz "Sachsen-Wittenberg". 1290 wurde dieses Herzogtum um die Burggrafschaft Magdeburg und um die Grafschaft Brehna erweitert. Es kam noch zu weiterem Gebietszuwachs. Als Albrecht II. 1296 starb, folgte ihm sein Sohn Rudolf I. in der Regierung. Im Streit zwischen Ludwig dem Bayern und dem Luxemburger Karl um die deutsche Königswürde schlug sich Rudolf I. auf die Seite Karls, wofür er 1356 dauerhaft mit der Kurwürde belohnt wurde. Damit war Sachsen-Wittenberg endgültig zu einem der sieben deutschen Kurfürstentümer aufgestiegen. Als die Wittenberger Askanier mit Albrecht IV. 1422 ausstarben, verfügte Sachsen-Wittenberg nur über geringe Macht, jedoch war es als Kurfürstentum mit einem hohen Rang ausgestattet. Deshalb war die Neubesetzung des Sachsen-Wittenberger Gebiets auch begehrt. Die Vergabe des Gebiets erfolgte am 6. Januar 1423 durch Kaiser Sigismund, der den Wettiner Markgrafen Friedrich dem Streitbaren von Meißen und Thüringen für seinen Kampf gegen die Hussiten mit dem Kurfürstentum Sachsen belehnte. Indem dieser Kurfürst von Sachsen wurde, wanderte die Bezeichnung Sachsen weiter elbaufwärts, mit der weiteren Bindung der Kurfürstenwürde an Wittenberg. Dies heißt also, wer Wittenberg besaß, hatte auch Kurfürstentitel und die Kurstimme des Erzmarschalls inne, mit dem Recht, den römisch-deutschen Kaiser zu wählen; und das blieb so bis zum Erlöschen des Alten Reichs im Jahr 1806. Am 09.11.1485 teilten, entgegen zahlreicher Ratschläge und Warnungen, Kurfüst Ernst und Herzog Albrecht in Leipzig ihren Besitz. Aus dem bis dahin von beiden gemeinsam regierten Kurfürstentum Sachsen entstanden auf diese Weise zwei wettinische Dynastien. Fortan war von den Ernestinern und den Albertinern die Rede. Der ernestinische Besitz umfaßte neben dem Wittenberger Kurkreis und dem damit verbundenen Amt Teile der alten Landgrafschaft Thüringen sowie das Vogt- und Pleißenland. Friedrich der Weise (1486–1525) baute Wittenberg zur kursächsischen Residenz aus und das Gebiet wurde zum Kernland der Reformation. Ihm folgten sein Bruder Johann der Beständige (1525–1532) und Johann Friedrich der Großmütige (1532–1547). Letzterer wurde von Kaiser Karl V. im Schmalkaldischen Krieg in der Schlacht in der Lochauer Heide 1547 besiegt und gefangen genommen. Der Kaiser nahm ihm die Kurwürde und einen Teil der Kurlande und belehnte damit seinen Vetter Moritz von Sachsen (Wittenberger Kapitulation). Unter Moritz von Sachsen begann die Einteilung des Kurfürstentums in sieben Kreise. Dabei ging der Kurkreis aus dem Herzogtum Sachsen-Wittenberg hervor. zurück Bei den &&"Sachsenpfennigen"&& handelt es sich um anonyme mittelalterliche Pfennige aus dem 10. und 11. Jh., die - neben Otto-Adelheid-Pfennigen - die häufigst gefundenen Pfennigmünzen ihrer Zeit sind. Neuerdings werden sie auch Hochrandpfennige genannt, auf Grund ihres hohen aufgebörtelten Randes. In der älteren numismatischen Literatur werden sie als Wendenpfennige bezeichnet, da sie häufig in den von Wenden und anderen slawischen Völkern besiedelten Gebieten gefunden wurden. Ursprünglich stammten sie nicht von den Wenden, die damals keine Christen waren, denn sie zeigen eindeutig christliche Symbole. Vermutlich dienten sie nicht nur dem Fernhandel mit den Westslawen, sondern auch dem Binnenhandel. Sie sind aus sächsischem Silber ausgemünzt worden, das wohl aus dem Harz stammte, als Prägezentrum wird Magdeburg angesehen. Später beteiligten sich auch noch andere (u.a. kirchliche) Münzstätten an der Prägung, denn das Prägezentrum wurde wohl mit dem Slawenaufstand 983 n.Chr. zunächst weitgehend lahmgelegt und es entstand mit den Otto-Adelheid-Pfennigen eine neue Münzsorte, die für den Wikingerhandel wichtig wurde.
Die älteren und im Durchmesser größeren Sachsenpfennige (um 18 mm) aus dem 10. Jh. zeigen auf den Vorderseiten ein stilisiertes Kirchengebäude, die Rückseiten zeigen ein Kreuz mit Kugeln in den Winkeln. Anstelle der Umschrift finden sich häufig Trugschriften in Form von Strichen (Keilen). Die anonymen Stücke wurden früher Heinrich I. (919-936) zugeschrieben, sind aber wohl nicht vor der Mitte des 10. Jh.s geschlagen worden und werden heute in die Zeit der Ottonen datiert (936-1002 n.Chr.). Manche sind mit dem Namen des Königs und Kaisers "O-D-D-O" oder "O-T-T-O" beschriftet, der oft quer über das Münzfeld läuft. Es ist aber nahezu unmöglich zu bestimmen, ob sie unter Otto I. (936-973), Otto II. (973-983) oder Otto III. (983-1002) geschlagen wurden. Die späteren "Sachsenpfennige" aus dem 11. Jh. sind im Durchmesser kleiner (bis 10 mm). Es handelt sich wohl in der Mehrzahl um Beischläge, die von Wenden zwischen Elbe und Oder und auch in Polen und Schlesien angefertigt wurden. zurück Der "Sachsenspiegel" war ein bedeutendes Rechtsbuch des Mittelalters, das um 1224 von dem sächsischen Ritter und Richter Eike von Repgow in niederdeutscher Sprache verfaßt wurde. Dem Autor wird auch die "Sächsische Weltchronik", das erste deutsche Geschichtswerk in Prosa, zugeschrieben. Der "Sachsenspiegel" überliefert nicht nur das sächsische Gewohnheitsrecht aller Stände, sondern geht auch auf feudalrechtliche Bestimmungen des Münzwesens, auf Neuprägungen, Verrufungen und die Kaufkraft von Pfennigsorten ein. zurück Dies ist die Bezeichnung für päpstliche Münzen, die nach dem ersten Wort in der Aufschrift "Sacrosanctae Basilicae Lateranensis Posessio" benannt sind. Die Lateran-Basilika war der Sitz der Bischöfe von Rom und wurde von den Päpsten beansprucht. Der Bischofssitz wurde anläßlich einer Prozession zur Lateran-Basilika in Besitz genommen, in deren Verlauf die "Sacrosanctae-Münzen", meist Baiocchi, Grossi oder Giulii, an die Armen verteilt wurden. Papst Clemens IX. führte im Jahr 1667 diesen Brauch ein, der von dreizehn Päpsten fortgesetzt wurde. zurück Lateinische Bezeichnung für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. zurück zurück Dies ist die volkstümliche Bezeichnung für die russische Denga, da auf ihr der Großfürst zu Pferd mit geschwungenem Säbel gezeigt wird. zurück Die "Sächsische Münzordnung" vom 20.01.1534 legte für Sachsen die Nominalen, Größen und Gewichte der Münzen fest. zurück Dänisch für "gewöhnlich" (englisch: normal bzw. ordinary, französisch: ordinaire, italienisch und spanisch: ordinario, niederländisch: gewoon, portugiesisch: ordinário). zurück Vom lateinischen "saeculum" (deutsch: "Jahrhundert") abgeleitet, sind hiermit Medaillen gemeint, die sich auf den Beginn eines neuen Jahrhunderts oder auf die Jahrhundertfeier historisch bedeutsamer oder denkwürdiger Ereignisse beziehen. zurück Vom lateinischen "saeculum" (deutsch: "Jahrhundert") abgeleitet, sind hiermit Münzen gemeint, die sich auf den Beginn eines neuen Jahrhunderts oder auf die Jahrhundertfeier historisch bedeutsamer oder denkwürdiger Ereignisse beziehen. Es gibt zahlreiche "Säkularmünzen" auf die Augsburger Konfession von 1530, auf Jahrhundertjubiläen von Universitäten und auf den kalendarischen Beginn neuer Jahrhunderte. zurück Die Farbe "sämisch" ist eine Farbe, die bei Banknoten vorkommt (dänisch: karmosinrod, englisch: buff, französisch: chamois, italienisch: camoscio, niederländisch: bleekgeel, portugiesisch: cor de camurca, spanisch: anteado). zurück Dies ist die Bezeichnung für die dänischen und norwegischen Münzen nach 1924. zurück Alternative Schreibweise für Saerskillemönt. zurück Dies ist die Bezeichnung eines Typs des spanischen Acht-Reales-Stücks, der die Säulen des Herakles zeigt, die zum spanischen Wappen gehörten. Nach antiker Sage soll Herakles nach Vollendung seiner Taten im Westen zu beiden Seiten der Meerenge von Gibraltar je eine Säule als Grenze der Welt aufgestellt haben. Der Bezeichnung Säulenpiaster entspricht in der englischen Sprache die Bezeichnung Pillar Dollar, im Mittelmeerraum die italienische Bezeichnung Colonnato und arabisch Abu Midfa (deutsch: "Vater der Kanone"), weil die Araber die Säulen als Kanonen mißdeuteten. zurück Die Safawiden waren eine Fürstendynastie in Persien, die von 1501–1722 regierte, den schiitischen Islam als Staatsreligion einführte und das &&Safawidenreich&& gründeten. Die Ursprünge der Dynastie gehen auf Scheich Safi ad-Din Ardabili (geb. 1252; gest. 1334) zurück, der 1301 einen Sufi-Orden in Ardabil gründete, der sich ab der Mitte des 15. Jh. zunehmend militarisierte. Unter Ismail I. (1484–1524) gelang 1501 die Eroberung von Täbriz und der Sturz der turkmenischen Aq Qoyunlu. Nach der Gründung der Dynastie der Safawiden wurde in den folgenden Jahren Persien und der Irak (1507) unterworfen. Nachdem der Ostiran mit einem Sieg bei Herat (1510) über die Usbeken gesichert worden war, kam es zum Konflikt mit den Osmanen im Westen. Diese besiegten 1514 die Safawiden bei Tschaldiran schwer und eroberten die Hauptstadt Täbriz. Die Zwölfer-Schia wurde unter Ismail I. Staatsreligion. Außerdem bemühte er sich um den Ausgleich zwischen den nomadischen Turkmenen (im Militär) und den seßhaften Persern (in der Verwaltung). Tahmasp I. (1524–1576) befand sich weiter im Konflikt mit den Osmanen und den Usbeken. Während er Khorasan gegen letztere in ständigen Kämpfen behaupten konnte, gingen der Irak und Aserbaidschan bis 1534 an die Osmanen verloren. Nach einigen dynastischen Wirren erreichte Abbas I. der Große (1587 – 1629) eine Konsolidierung des Reiches. Unter ihm wurde 1601 Bahrain besetzt, seit 1603 die Osmanen aus Aserbaidschan, Armenien und Georgien vertrieben und 1623 sogar der Irak mit Bagdad wieder erobert. Damit kamen die schiitischen Wallfahrtszentren Nadschaf und Kerbala wieder unter persische Kontrolle. Außerdem konnten um 1595 die verheerenden Einfälle des Usbeken Abdullah II. in Khorasan beendet werden. Durch eine geschickte Wirtschaftspolitik kam das Land zu großem Wohlstand, welcher unter anderem in dem großartigen Ausbau der neuen Hauptstadt Isfahan zu erkennen ist. Unter den schwachen Nachfolgern von Abbas I. verlor die Zentralverwaltung wieder an Einfluß. Nur unter Abbas II. (1642–1666) gelang mit Reformen noch einmal eine Konsolidierung des Reiches. Auch kam es unter ihm zu engen Handelskontakten mit den europäischen Seemächten England und Niederlande. 1649 konnte auch Kandahar in Chorasan endgültig besetzt werden, das zwischen Persien und dem indischen Mogulreich umstritten war. Gegen Ende des 17. Jh. kam es unter Sultan Hussain (1694–1722) zu einem starken wirtschaftlichen Niedergang Persiens. Da gleichzeitig die Sunniten im Reich zwangsweise zum schiitischen Islam bekehrt werden sollten, kam es 1719 zum Aufstand der sunnitischen Afghanen . Diese eroberten 1722 Isfahan und beendeten 1736 endgültig die Dynastie der Safawiden. Doch diese neue Hotaki-Dynastie konnte sich nur einige Jahre halten. Zwar wurden auch später von einigen Machthabern (z. B. Nadir Schah) Safawiden als Herrscher eingesetzt, doch waren diese nur noch Marionetten. In einigen Provinzen konnten sich die Safawiden bis 1773 halten. Nach der Vertreibung der Afghanen wurden die Safawiden von den Afschariden abgelöst. zurück zurück Eigenname von Spanisch-Sahara. zurück Der "Saiger" war im Mittelalter eine Feinwaage, die der Münzmeister zum Wiegen und Justieren der Münzen benutzte. zurück "Saigern" (auch: seigern) ist ein aus dem Mittelalter stammender Ausdruck für das Aussondern von Münzen. Das Wort ist vom mittelhochdeutschen "seigen" (senken, neigen) abgeleitet und bedeutete zunächst soviel wie wiegen. Der Saiger war im Mittelalter eine Feinwaage, die der Münzmeister zum Wiegen und Justieren der Münzen benutzte. Früher justierte man die Kleinmünzen meist al marco, d.h. die vorgeschriebene Anzahl der Münzen, die auf eine Gewichtsmark gingen, wurde gemeinsam gewogen. Dadurch stimmte das Durchschnittsgewicht. Das Gewicht der einzelnen Exemplare schwankte, was dazu ausgenutzt wurde, die schwereren Stücke aussondern, zurückzuhalten und von Zeit zu Zeit einzuschmelzen, um am Silberwert Gewinn zu machen. Dieser als "Saigern" bezeichnete Vorgang schädigte das mittelalterliche Münzwesen, denn dadurch verblieben nur die leichteren Stücke im Umlauf, was zur ständigen Verschlechterung des Münzfußes beitrug. Das "Saigern" war verboten und wurde mit strengen Strafen und Sanktionen belegt So durften z. B. zeitweise nur Münzmeister Fein- und Münzwaagen besitzen. Aber die Unsitte des "Saigerns" verbreitete sich auch in den Münzstätten selbst und war zur Kipper- und Wipperzeit weit verbreitet. zurück Alternative Schreibweise für St. Lô. zurück Dies ist der Name einer französischen Familie von Medailleuren und Stempelschneidern. Ferdinand de Saint Urbain (1658-1738) war seit etwa 1673 an der Münzstätte in Bologna und von 1683 bis 1704 an der Münzstätte in Rom beschäftigt. In dieser Zeit arbeitete er unter vier Päpsten. Neben vielen päpstlichen Münzen schuf er auch eine Reihe von Medaillen, u.a. eine unvollendete Suite der Päpste. Der auch als Architekt tätige Münzkünstler verwendete die Signaturen "F.D.Sv" oder "S.V.S." und kehrte um 1704 in seine Heimatstadt Nancy zurück. Dort trat er in die Dienste von Herzog Leopold von Lothringen. An dessen Hof setzte er sein Medaillenwerk fort, u.a. mit einer Suite der Herzöge und Herzoginnen von Lothringen, an der auch schon sein Sohn und Schüler Claude August (1703-1761) beteiligt war. Nach dem Tod seines Vaters 1838 fand Claude August de Saint Urbain (Signaturen: "C.A.S.V." oder "A.S. Urbain") in Wien eine Anstellung als erster Stempelschneider und avancierte später zum Direktor der Wiener Münze. zurück Claude August de Saint Urbain (geb. 1703; gest. 1761) gehört zum Clan der Saint Urbain und war der Sohn von Ferdinand de Saint Urbain. Er lernte sein Handwerk zunächst in Nancy bei seinem Vater und arbeitete mit ihm zusammen. Zeitweise war er auch in Rom tätig. 1738 ging er nach Wien und wurde an der dortigen Münzstätte erster Stempelschneider und Direktor. Als Signatur verwendete er "A. S. Urbain" bzw. "C. A. S. V.". zurück Ferdinand de Saint Urbain (geb. 1658; gest. 1738) gehört zum Clan der Saint Urbain und war ein französischer Stempelschneider und Medailleur, der seit 1673 an der Münzstätte in Bologna und ab 1683 in Rom tätig war. 1704 kehrte er nach Nancy zurück und arbeitete für die herzoglich-lothringische Münzstätte. Außer den zahlreichen Münzen für Herzog Leopold von Lothringen schuf er zahlreiche Medaillen. Seine Signatur war "F.D.SV" bzw. "S V. S.". Er war der Vater von Claude August de Saint Urbain. zurück Sainte-Menehould ist ein Ort im Westen Frankreichs. Im Mittelalter gab es dort auch eine Münzstätte, die von 1538 bis 1551 den Kennbuchstaben "T" verwendete. zurück Eigenname von Georgien. zurück Alternative Bezeichnung für Kesa. zurück Portugiesisch für "Restbestand" (dänisch: restbeholdning, englisch: stock remainder, französisch: stock restant, italienisch: stocks residu, niederländisch: restvoorraad, spanisch: stock sobrante). zurück Englisch für "Verkauf" (dänisch: salg, französisch: vente, italienisch: vendita, niederländisch: verkoop, portugiesisch: venda, spanisch: venta). zurück Salerno (lateinisch: Salernum) ist eine Hafenstadt am Golf von Salerno, im Süden Italiens. Die Stadt wurde im neunten und sechsten Jh. v.Chr. erstmals besiedelt. Der Name der Stadt geht auf die römische Kolonie und Militärlager Salernum zurück. Schon in der Antike war Salerno ein wichtiger Handelsplatz. Im Mittelalter erreichte Salerno mit seinen Handelsbeziehungen zu Sizilien und Nordafrika einen umfangreichen Aufschwung. Salerno war seit 983 Erzbischofssitz. Früher gab es dort auch eine eigene Münzstätte. zurück Lateinische Bezeichnung für Salerno. zurück Dänisch für "Verkauf" (englisch: sale, französisch: vente, italienisch: vendita, niederländisch: verkoop, portugiesisch: venda, spanisch: venta). zurück Die Salier waren ein fränkisches Adelsgeschlecht im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation des 10. bis 12. Jh. Der Beiname erscheint erstmals Anfang des 12. Jh. als "rex salicus" oder "reges salici". Die Salier gelten als deutsche Nebenlinie der in Italien mächtig gewordenen Widonen bzw. Lambertiner und waren durch die Mutter Konrads des Roten verschwägert mit den Konradinern. Durch seine Ehe mit Liutgard, der Tochter Ottos des Großen, und seine Ernennung zum Herzog von Lothringen wurde Konrad der Rote zum Begründer des Geschlechts. Er war der Urgroßvater von König Konrad II., der 1024 König des ostfränkisch-deutschen Reiches und 1027 erster Kaiser aus dem Geschlecht der Salier wurde. Der Niedergang der Salier wurde durch einen Streit Heinrichs IV. mit dem Papst eingeleitet. Heinrich V., der letzte Salierkönig, regierte bis 1125. Auf die Herrschaft der Salier folgte als Übergang der Sachse Lothar III. und nach ihm der Staufer Konrad III., der über seine Mutter, die Tochter Heinrichs IV., ein Neffe des letzten salischen Kaisers Heinrich V. war. zurück Portugiesisch für "lachsfarben" (dänisch: laksefarvet, englisch und spanisch: salmon, französisch: saumon, italienisch: salmone, niederländisch: zalmkleurig). zurück Englisch und spanisch für "lachsfarben" (dänisch: laksefarvet, französisch: saumon, italienisch: salmone, niederländisch: zalmkleurig, portugiesisch: salmao). zurück Italienisch für "lachsfarben" (dänisch: laksefarvet, englisch und spanisch: salmon, französisch: saumon, niederländisch: zalmkleurig, portugiesisch: salmao). zurück Alternative Bezeichnung für die Salomon-Inseln. zurück Der "Salomonen-Dollar" (ISO-4217-Code: SBD; Abkürzung: SI$) ist die Währung der Salomon-Inseln. Er wurde nach der Unabhängigkeit der Inseln eingeführt, um den Australischen Dollar zu ersetzen. Auf den Münzen ist Königin Elisabeth II., die auch Königin der Salomon-Inseln ist, eingeprägt. Der Wert des "Solomonen-Dollars" nahm in den letzten 30 Jahren und besonders während des Bürgerkriegs von 1999 - 2001 stetig ab. Den Salomonen-Dollar gibt es in Banknoten zu 2, 5, 10, 20 und 50 Dollar, sowie Münzen zu 5, 10, 20, 50 Cent und 1 Dollar. Die 1- und 2-Cent-Münzen sind nicht mehr im Umlauf. zurück  Die &&Salomon-Inseln&& (auch: Salomonen, englisch: British Solomon Islands) sind ein Inselstaat im Südwesten des Pazifiks, östlich von Neuguinea. Er wird zum größten Teil aus den Gebieten der südlichen Salomon-Inseln sowie den Rennell-Inseln, den Ontong-Java-Inseln und den weiter östlich liegenden Santa-Cruz-Inseln gebildet. Die nördlichen Inseln der Salomon-Inseln gehören zum Staat Papua-Neuguinea. Die &&Salomon-Inseln&& (auch: Salomonen, englisch: British Solomon Islands) sind ein Inselstaat im Südwesten des Pazifiks, östlich von Neuguinea. Er wird zum größten Teil aus den Gebieten der südlichen Salomon-Inseln sowie den Rennell-Inseln, den Ontong-Java-Inseln und den weiter östlich liegenden Santa-Cruz-Inseln gebildet. Die nördlichen Inseln der Salomon-Inseln gehören zum Staat Papua-Neuguinea.Die Salomonen waren ab 1893/99 britisches Protektorat (ohne Bougainville und Buka), 1942 von Japan besetzt und wurden bis 1944 von den Amerikanern zurückerobert. Am 02.01.1976 erhielten sie die innere Selbstverwaltung und wurden am 07.07.1978 unabhängig. Die Salomonen sind Mitglied des Commonwealth of Nations. Amtssprache: Englisch Hauptstadt: Honiara Staatsform: Parlamentarische Monarchie Fläche: 28.450 qkm Einwohnerzahl: 552.438 (2006) Bevölkerungsdichte: 19,4 Einwohner pro qkm BIP/Einwohner: 620 US-Dollar (2004) Unabhängigkeit: 07.07.1978 Zeitzone: UTC +11 Währung: Salomonen-Dollar zurück Dies ist die Bezeichnung für eine siamesische Nominale im Wert von 1/4 Baht nach dem Münzsystem des Königreichs Siam (Thailand). zurück 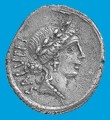  Salus war die römische Göttin der Gesundheit und der öffentlichen (Salus populi Romani) und kaiserlichen (Salus Augusti) Wohlfahrt. Sie entspricht der griechischen Göttin Hygieia. Sie ist auf römischen Münzen der Römischen Kaiserzeit meist mit Patera, Zepter und Schlange dargestellt, die sie manchmal füttert. Auf einigen Münzen lehnt sich Salus an eine Säule an (Gefühl der Sicherheit) und gelegentlich erscheint sie zusammen mit Aesculap. Auf älteren Münzen aus der Zeit der Römischen Republik wird die Göttin der Gesundheit auch Valetudo genannt. Salus war die römische Göttin der Gesundheit und der öffentlichen (Salus populi Romani) und kaiserlichen (Salus Augusti) Wohlfahrt. Sie entspricht der griechischen Göttin Hygieia. Sie ist auf römischen Münzen der Römischen Kaiserzeit meist mit Patera, Zepter und Schlange dargestellt, die sie manchmal füttert. Auf einigen Münzen lehnt sich Salus an eine Säule an (Gefühl der Sicherheit) und gelegentlich erscheint sie zusammen mit Aesculap. Auf älteren Münzen aus der Zeit der Römischen Republik wird die Göttin der Gesundheit auch Valetudo genannt.zurück   Die ersten Goldmünzen, die das religiöse Motiv der Verkündigung darstellen, gaben Karl I. von Anjou (1264/66-1275/85) und sein Nachfolger Karl II. (1285-1309) für die Grafschaft Provence und das Königreich Neapel aus. Sie zeigen auf der Vorderseite die Verkündigungsszene: Der Engel Gabriel, verkündet Maria die Geburt Jesu, letzterer symbolisch dargestellt durch einen Rosenstock. Die Rückseite zeigt den Wappenschild (Kreuze/Lilien). Es gab auch Halbstücke. Die ersten Goldmünzen, die das religiöse Motiv der Verkündigung darstellen, gaben Karl I. von Anjou (1264/66-1275/85) und sein Nachfolger Karl II. (1285-1309) für die Grafschaft Provence und das Königreich Neapel aus. Sie zeigen auf der Vorderseite die Verkündigungsszene: Der Engel Gabriel, verkündet Maria die Geburt Jesu, letzterer symbolisch dargestellt durch einen Rosenstock. Die Rückseite zeigt den Wappenschild (Kreuze/Lilien). Es gab auch Halbstücke.Später erschien der "Salut d'or" als anglo-gallische Goldmünze, die die englischen Könige Heinrich V. (1415-1422) und Heinrich VI. (1422-1453) für ihre südwestfranzösischen Besitzungen in Aquitanien ausgaben. Die Vorderseiten zeigen die Brustbilder von Gabriel und Maria, darunter die Wappenschilde von Frankreich und England und die Rückseiten ein Kreuz. zurück Italienische Bezeichnung für den Salut d'or. zurück Der &&"Salvatortaler"&& ist ein Typ des schwedischen Riksdalers, der auf der Rückseite die Ganzfigur von Christus als Heiland (lateinisch: "salvator") darstellt, der seine Wunden zeigt, in der Hand den Reichsapfel. Die Inschrift lautet entweder "SALVATOR MVNDI ADIVVA NOS" (deutsch: "Heiland der Welt, hilf uns") oder "SALVATOR MUNDI SALVA NOS" (deutsch: "Heiland der Welt, errette uns"). Die Vorderseite zeigt meist Darstellungen des regierenden schwedischen Monarchen, unter denen die als Amulettmünzen beliebten Taler zwischen 1542 bis 1653 geprägt wurden, besonders häufig unter Gustav II. Adolf (1611-1632) und Christina (1632-1654). Letztere ließ auch Halb- und Viertelstücke ausgeben. zurück Die Fürstbischöfe von Salzburg galten als reich und mächtig und ließen vom Frühmittelalter bis zur Säkularisation im Jahre 1903 zahlreiche Münzen prägen. Im Jahr 996 verlieh Kaiser Otto III. dem Salzburger Erzbischof Hartwich das Münzrecht. Er ließ Denare schlagen, die oft im Ostseeraum zu finden sind, da sie häufig für den Sklavenhandel verwendet wurden. Die Sklaven kamen aus dem slawischen Raum und wurden nach Arabien verkauft. Von der zweiten Hälfte des 11. Jh. bis zur Mitte des 12. Jh. wurden keine Münzen geprägt. Mit dem Einsetzen des Salzhandels kam die Stadt zu Wohlstand und im 13. Jh. setzte auch der Silber- und Goldbergbau ein. Von 1350 bis 1450 ging die Prägetätigkeit allerdings zurück. Erst um 1500 ließ Erzbischof Leonhard von Keutschach ließ wieder zahlreich prägen, und zwar Dukaten, Goldgulden, Batzen, Pfennige und Heller. Später folgten auch Zehner und ein 16 Pfennige zählender Batzen, der wegen des erzbischöflichen Wappens auch Rübenbatzen bzw. Rübler genannt wurden. Es sind aus der Zeit um 1500 allein 120 verschiedene Stempelvarianten bekannt. Es gab auch eine große Zahl von Geschichtsmünzen bekannt, wie z. B. zur Domweihe im Jahre 1628. 1682 wurde im Erzstift die Jahrtausendfeier zelebriert, zu der es einen Taler gab. Im 30-jährigen Krieg blieb man neutral, allerdings vertrieb man danach im Salzburger Land die Protestanten, was in den Jahren 1731 bis 1733 unter Erzbischof Leopold Anton von Firmian geschah. Der letzte regierende Erzbischof war Hieronymus von Colloredo (1772-1803), der in Folge der Französischen Revolution vertrieben wurde und in Wien Zuflucht fand. 1805 kam Salzburg zu Österreich, 1810 zu Bayern und 1816 endgültig zu Österreich. zurück Das "Salzgeld" zählt zum Naturalgeld und taucht schon in verschiedenen voneinander unabhängigen Frühkulturen auf. Römische Legionäre bekamen zusätzlich zu ihrem Sold eine Ration Salz als Lohn, das "salarium". Davon leitet sich die Bezeichnung "Salär" (französisch: "salaire") für Lohn und Gehalt von Soldaten und Beamte ab, der sich bis heute erhalten hat. Salz war als Nahrungsmittel und zur Haltbarmachung (z. B. für Fische) lebensnotwendig und auch als Genußmittel zum Würzen sehr beliebt und darum auch ein begehrtes Handelsgut. Salzlager sind unregelmäßig über die Erde verteilt, so daß das kostbare Gut, von den reichen Salzstädten ausgehend, über weite Salzstraßen zu Lande und zu Wasser gehandelt wurde. In der Regel verteuerte sich das Handelsgut in dem Maße, wie weit das Gebiet vom Zentrum der Salzgewinnung entfernt war, so daß man in abgelegenen Gebieten "gesalzene Preise" in Kauf nehmen mußte. Über den reinen Tauschwert hinaus wurde "Salzgeld" als Zahlungsmittel in Neuguinea, Birma, Borneo, Südchina, Tibet und bei einer Reihe von afrikanischen Völkern in Äthiopien, Angola, Mali, Zaire und Guinea verwendet. Im Mittelalter soll in manchen Gebieten Afrikas Salz mit Gold im Verhältnis 1:1 getauscht worden sein. Schon vor der Zeitenwende wurde das kostbare Mineral an der Schwarzmeerküste aus Salzwasser gewonnen und gegen Erzeugnisse aus dem Hinterland getauscht. Der ausgedehnte Salzhandel um das Mittelmeer geht auf die Phönizier zurück, ein altorientalisches Handels- und Seefahrervolk im südöstlichen Mittelmeerraum, das zwischen 1200 und 900 v.Chr. den Fernhandel bestimmte und den Salzhandel bis nach England und an die Ostsee ausdehnte. Dokumenten zu Folge soll Salz in China schon im 7. Jh. v. hr. als Zahlungsmittel benutzt worden sein. Marco Polo berichtete im 13. Jh. n.Chr. im Zusammenhang mit seiner Reise ins südchinesische Grenzgebiet Yunnan über die Herstellung von "Salzmünzen". Sie sollen aus einer bestimmten Solemenge zu Salzbrei eingedampft, zu kleinen Kuchen getrocknet, am Feuer gehärtet und von kaiserlichen Beamten "geprägt" worden sein. Sechzig solcher Salzstücke sollen 10 g Feingold entsprochen haben, in schwer zugänglichen Bergregionen stieg ihr Wert auf das Doppelte. In Tibet sollen zu dieser Zeit Salzklumpen von ca. 250 g als Zahlungsmittel genutzt worden sein. Noch bis ins 20. Jh. waren im südchinesischen Grenzgebiet Salzkuchen als Tauschmittel für Lebensmittel und Trägerlohn in Gebrauch. Als traditionelles Zahlungsmittel erreichte Salzbarrengeld bei einer Reihe von Stämmen in Afrika größere Bedeutung, besonders das Amoli aus Äthiopien und das Mangul aus dem Königreich Bornu (heute: Nigeria). Auch in anderen afrikanischen Gebieten wurden Salzklumpen in verschiedenen Formen und zu regional und saisonal schwankenden Werten zur Bezahlung des Brautpreises, im Sklavenhandel und zu anderen Zwecken genutzt. zurück  Die Republik &&Sambia&& ist ein Staat im südlichen Afrika. Sie grenzt an Angola, die Demokratische Republik Kongo, Tansania, Malawi, Mocambique, Simbabwe, Botswana und Namibia. Ihr Name leitet sich vom Fluß Sambesi ab. Die Republik &&Sambia&& ist ein Staat im südlichen Afrika. Sie grenzt an Angola, die Demokratische Republik Kongo, Tansania, Malawi, Mocambique, Simbabwe, Botswana und Namibia. Ihr Name leitet sich vom Fluß Sambesi ab.Bei Sambia handelt es sich um die ehemals britische Kolonie Nord-Rhodesien. Amtssprach:e Englisch Hauptstadt: Lusaka Staatsform: Republik Fläche: 752.614 qkm Einwohnerzahl: 11,261 Mio. (2005) Bevölkerungsdichte: 14,9 Einwohner pro qkm BIP/Einwohner: 823 US-Dollar (2006) Unabhängigkeit von Großbritannien: 24.10.1964 Zeitzone: UTC+2 Währung: Sambischer Kwacha = 100 Ngwee zurück
Der "Sambische Kwacha" (ISO-4217-Code: ZMK; Abkürzung: K) ist die Währung von Sambia. Er wurde 1968 eingeführt und wurde ursprünglich in 100 Ngwee unterteilt. Heute ist auf Grund der fortgeschrittenen Inflation die kleinste benutzte Einheit die 20-Kwacha-Note. Die größte Banknote ist der 50.000-Kwacha-Schein. Das Wort "Kwacha" bedeutet auf Bemba "Morgendämmerung", "Anbruch" und spielt auf den sambischen nationalistischen Slogan "der neue Anbruch der Freiheit" an. Auch die Währung des östlichen Nachbarstaates Malawi heißt "Kwacha". Auf der Vorderseite der sambischen Banknoten ist ein Fischadler als Wahrzeichen des Landes abgebildet. Auf den Rückseiten ist die Freiheitsstatue von Lusaka als Zeichen der Freiheit zu finden. Sambia ist das erste afrikanische Land, welches Polymerbanknoten ausgegeben hat. So erschienen am 26.09.2003 erstmals zwei Polymerbanknoten zu 500 und 1.000 Kwacha. Diese Banknoten werden von der Canadian Bank Note Company in Kanada gedruckt. zurück Die meisten Neueinsteiger sammeln am Anfang wahllos alles, was ihnen gefällt oder irgendwie zwischen die Finger kommt. Früher oder später flammt dann in der Regel der Wunsch auf, Ordnung in die eigene Sammlung zu bringen und sie nach bestimmten Gesichtspunkten zu sortieren bzw. komplettieren. Deshalb ist es ratsam, sich schon früh zu spezialisieren, denn "Alle Welt" ist nicht sammelbar. Drei große Sammelgruppen lassen sich unterscheiden: Länder, Motive/Themen und Epochen. Bei der sogenannten Ländersammlung stehen zumeist die Münzen aus dem Heimatland an erster Stelle. Doch haben sich beispielsweise viele deutsche Sammler auch Münzen ferner Länder verschrieben. Heutzutage lassen sich natürlich die Münzen der Euro-Zone in einer "Ländersammlung" zusammen fassen und – bei Wunsch nach weiterer Spezialisierung – beispielsweise auf die 10-Euro-Silbermünzen - beschränken. Womit die Verbindung zu einer Themensammlung geknüpft wäre. Das Sammelthema "Euro" ließe sich dann erweitern mit den seit 1987 geprägten ECU- und Euro-Gedenkmünzen, die als Vorläufer für die heutigen Euros gelten. Die traditionell beliebtesten Themen- bzw. Motiv-Sammelgebiete sind Gedenkmünzen zu Olympischen Spielen, gefolgt von Ausgaben zu Fußball-Weltmeisterschaften. Gefragt sind auch Sammelmotive wie "Bedrohte Tiere" oder "Schiffe, Seefahrer und Entdecker". Bei den Sammlern, die sich gerne auf bestimmte Epochen spezialisieren, stehen hierzulande insbesondere die Sammelgebiete "Deutsches Kaiserreich" und "DDR" im Vordergrund. Auf breites Interesse stößt aber auch beispielsweise die Epochensammlung "Römische Antike". zurück Hierbei handelt es sich um eine fiktive Wertgröße, die der einzelne Numismatiker seiner Sammlung beimißt. zurück Hierbei handelt es sich um ein Werturteil, das festlegen soll, ob ein philatelistisches Objekt in eine Sammlung aufgenommen werden kann oder nicht. zurück Diese Dienste gibt es praktisch von allen Staaten und dienen dazu, daß die Sammler von dort ihre Neuheiten - meist im Abonnement, ohne diese jeweils extra bestellen zu müssen - beziehen können. zurück zurück Dies ist ein anderes Wort für eine "Tauschsendung" an einen Tauschpartner. zurück Bezeichnung für ein Treffen von Sammlern zwecks Erfahrungsaustausch und Tausch von numismatischen Erzeugnissen. zurück Bezeichnung für ein Treffen von Sammlern zwecks Erfahrungsaustausch und Tausch von numismatischen Erzeugnissen. zurück Bezeichnung für eine numismatische Dachorganisation, in der Vereine zusammengeschlossen sind und die die Interessen der Sammler vertritt. zurück Bezeichnung für einen Verein, in dem sich Sammler zusammengeschlossen haben, um ihrem Hobby nachzugehen. zurück Der "Sammlerwert" ist eine Art des Münzwertes, nämlich der Wert, den eine Münze für einen Sammler hat. Dieser Wert ist natürlich sehr subjektiv und entspricht nicht dem Marktwert. zurück Hierbei handelt es sich um ein auf Münzen eingeritzte oder eingeschlagene Zeichen (Monogramme, Wappen) früherer Sammler, die damit deutlich machten, daß sich die betreffenden Sammelstücke in ihrem Besitz befanden. "Sammlerzeichen" traten seit dem 16./17. Jh. bis ins 19. Jh. auf. Sie wirken sich oft wertmindernd aus, es sei denn, die Stücke sind als Teil einer bedeutenden Sammlung ausgewiesen oder tragen das Zeichen einer bekannten Persönlichkeit. zurück Bezeichnung für einen Verein, in dem sich Sammler zusammengeschlossen haben, um ihrem Hobby nachzugehen. zurück In der Numismatik ist eine "Sammlung" das systematische Zusammentragen von numismatischen Sammelgegenständen (englisch und französisch: collection). Es wird u.a. zwischen einer Ländersammlung und einer Thematiksammlung unterschieden. zurück &&Samoa&& (samoanisch: Malo Tutoatasi o Samoa, englisch: Independent State of Samoa) ist ein Inselstaat, der den westlichen Teil der Samoa-Inseln umfaßt und deswegen auch "Westsamoa" genannt wird. Der östliche Teil gehört zu den USA. Samoa liegt im südwestlichen Pazifik nordöstlich der Fidschi-Inseln. Die größten Inseln sind Savai'i (1.708 qkm) und Upolu (1.118 qkm) mit der Hauptstadt und dem internationalen Flughafen. Dazu kommen die bewohnten Inseln Manono, Apolima und sechs Inseln, die bis auf eine kleine Ferienanlage auf Namua (Namua Island Resort) unbewohnt sind. Samoa war unabhängiges Königreich und wurde am 02.12.1899 zwischen dem Deutschen Reich und den USA geteilt. Der deutsche Teil bestand aus Westsamoa und wurde deutsche Kolonie. 1914 wurde die Kolonie von neuseeländischen Truppen besetzt und ab 1920 als Völkerbundsmandat von Neuseeland verwaltet, ab 1945 als UNO-Treuhandgebiet. Am 01.01.1962 wurde Westsamoa unabhängig und am 03.07.1997 wurde der Name in "Samoa" geändert. Amtssprache: Samoanisch, Englisch Hauptstadt: Apia Staatsform: Parlamentarische Demokratie im Commonwealth Fläche: 2.944 qkm Einwohnerzahl: 177.287 Bevölkerungsdichte: 60,2 Einwohner pro qkm BIP/Einwohner: 2.020 US-Dollar (2004) Unabhängigkeit: 01.01.1962 Zeitzone: UTC - 11 Stunden Währung: Tala zurück  Samos war ab dem 10.12.1832 selbständiges Fürstentum unter türkischer Verwaltung. Schutzmächte waren Frankreich, Großbritannien und Rußland. Am 11.11.1912 erklärte es den Anschluß an Griechenland und wurde am 10.08.1913 im Frieden von Bukarest dem Königreich Griechenland zugesprochen. Der endgültige Anschluß erfolgte 1922. Samos war ab dem 10.12.1832 selbständiges Fürstentum unter türkischer Verwaltung. Schutzmächte waren Frankreich, Großbritannien und Rußland. Am 11.11.1912 erklärte es den Anschluß an Griechenland und wurde am 10.08.1913 im Frieden von Bukarest dem Königreich Griechenland zugesprochen. Der endgültige Anschluß erfolgte 1922.zurück Hierbei handelt es sich um eine Kupfermünze zu 2 1/2 Baiocchi, die unter Papst Pius VI. (1775-1799) ab 1795 in den Münzstätten des Kirchenstaates mit unterschiedlichem Gewicht geschlagen wurde zurück Beim "Samson d'or" handelt es sich um einen Typ des Fort d'or. zurück Dies ist die Bezeichnung für einen mittelalterlichen Rückseitentyp der Agrippiner und deren Nachahmungen und Beischläge. Die Kölner Denare tragen eine dreizeilige Aufschrift, nämlich ein mit einem waagrechten Strich versehenes "S/COLONIA/A" oder später "AG" ("Sancta Colonia Agrippina"). Der Typus soll aus der Zeit Ludwigs IV. (900-911 n.Chr.) stammen, der als Kind zum letzten karolingischen König (900-911 n.Chr.) in Deutschland gesalbt wurde. Konrad I. (911-918 n. Chr.) und Heinrich I. (919-936 n. Chr.) haben keine Kölner Pfennige geprägt, so daß der Typ erst in ottonischer Zeit gesichert ist. Zwischen 940/950 und 1024 n.Chr. wurde der bedeutende Typ in Köln selbst in großen Mengen ausgeprägt und von vielen Münzstätten nachgeahmt oder übernommen. Die Aufschriften der Lütticher ("S/LEDGI/A") und Cambrayer Pfennige ("S/ODDO RE/A") orientierten sich daran. In zahlreichen Münzstätten in Westfalen (vor allem in der Münzstätte Soest der Kölner Erzbischöfe) bis ins entfernte Bremen ("S/BREMA/A") oder Halberstadt ("HALBER/STE/+DI") wurde der Typ zum Teil noch bis ins 12. Jh. nachgeahmt. zurück Die Schrötlinge moderner Münzen des 20. Jh. bestehen oft aus mehreren Metall- oder Legierungsschichten, die wie ein Sandwich aufeinander liegen, so daß man auch von "Sandwich-Münzen" spricht. zurück "Sandwirtszwanziger" (auch: Hoferzwanziger) ist ein Beiname der silbernen 20-Kreuzer-Stücke, die während des Tiroler Aufstands unter Führung des "Sandwirts" Andreas Hofer 1809 in der Münzstätte in Hall (Tirol) geprägt wurden. Die von dem Innsbrucker Uhrmacher Josef Beyrer gelieferten Prägestempel zeigen auf der Vorderseite den Tiroler Adler mit Ehrenkranz und die Umschrift "GEFÜRSTETE GRAFSCHAFT TIROL", auf der Rückseite die Aufschrift "20/KREUZER", darunter einen Palmen- und einen Lorbeerzweig gekreuzt und die Jahreszahl 1809 zwischen zwei Rosetten. Die Umschrift lautet "NACH DEM CONVENTIONSFUSS". Neben der Prägung kupferner Kreuzer sind sie die letzten Prägungen der Münzstätte in Hall. zurück Hierbei handelt es sich um eine Goldmünze aus der norditalienischen Republik Siena, die seit 1340 im Gewicht des Florentiner Fiorino geprägt wurde. Der Typ zeigt auf der Vorderseite ein großes verziertes "S" und auf der Rückseite ein Kreuz. Er wurde auch unter der Herrschaft Giovanni Galeazzos (1390-1404) weitergeprägt und hielt sich bis 1553. zurück Durch die großen Goldfunde ab 1848 und den folgenden Goldrausch kam es rund um San Francisco zu zahlreichen Ausgaben, die man auch als California Gold bezeichnet. Ab 1851 gab es halboffizielle Ausgaben mit der Inschrift "AUGUSTUS HUMBERT UNITED STATES ASSAYEER OF GOLD". Hierbei handelte es sich um achteckige Stücke im Wert von 50 US-Dollar, die aber von verschiedenem Feingewicht waren. 182 gab es auch Stücke zu 10 und 20 US-Dollar. Eine offizielle Münzstätte gab es in San Francisco erst ab 1854, wobei man zwischen April und Dezember schon in Gold für über 4 Mio. Dollar Münzen prägte. Die Prägetätigkeit dauerte bis 1955, mit kurzer Unterbrechung nach dem großen Erdbeben im Jahre 1906. 1874 und 1937 wurde die Münzstätte jeweils verlegt und ab 1965 wurde auch wieder geprägt. Als Münzzeichen wurde "S. J." verwendet. zurück zurück zurück San Luis Potosí ist eine Stadt im nördlichen Zentralmexiko und die Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates. Gegründet wurde sie am 04.11.1592. Nach der Unabhängigkeit gab es auch eine Münzstätte, die das Münzzeichen "Pi" verwendete. zurück Alternative Bezeichnung für den Albansgulden. zurück Sankt Andreasberg ist eine ehemals freie Bergstadt im Oberharz. Die erste bisher aufgefundene urkundliche Erwähnung ("sanct andrews berge") in einem Brief des Grafen Heinrich zu Stolberg an Dietrich von Witzleben stammt vom 03.11.1487. In mittelalterlicher Zeit gab es dort auch eine herzogliche Münzstätte, in der zahlreiche Rechenpfennige geschlagen wurden. zurück Alternative Bezeichnung für den Blasiustaler. zurück Früherer Name für St. Kitts. zurück St. Eligius (ca. 588-660 n.Chr.) ist der Schutzpatron der Goldschmiede, Schmiede, Münzmeister und Münzgesellen arbeitete selbst als Goldschmied und Münzmeister in Paris, Marseille und Arles. Am Hof der Merowinger bekleidete er eine hohe Stellung und wurde unter König Dagobert (628-639) Kanzler. Schließlich leitete er als Bischof von Noyon die Missionierung der nordfranzösischen Germanenstämme. Nach seinem Tod wurde er von der Kirche heilig gesprochen. Seine Attribute sind Zange, Hammer oder Pferdehuf. zurück St. Gallen ist eine Abtei, Stadt und Kanton in der östlichen Schweiz. Sankt Gallen - Abtei Das Kloster St. Gallen entstand aus der Zelle des Hl. Gallus, der im 7. Jh. aus Irland in die Gegend am Bodensee kam. König Otto I. verlieh dem Abt von St. Gallen im Jahre 947 für seinen Ort Rorschach das Markt-, Zoll- und Münzrecht. Es sind allerdings keine in Rorschach zu dieser Zeit geprägten Münzen bekannt. Die ersten Münzen der Abtei waren Denare aus dem 11. und 12. Jh., wobei der Prägeort nicht eindeutig feststeht. Man vermutet, daß die Münzen zunächst aus Rorschach stammten und die Prägung dann in die Münzstätte in St. Gallen verlegt wurde. Im 12. und 13. Jh. ging man dann zur Herstellung von Brakteaten über. Als wichtigste Typen kennt man die sog. Galluspfennige (mit dem Haupt des St. Gallus), die Bärenpfennige und die Lammpfennige. Im 14. Jh. wurden die Pfennige kleiner und viereckig, aber im 15. Jh. gab es wieder runde Pfennige, die aber auch klein und geringhaltig waren und als Scheidemünzen dienten. Schon im 14. Jh. machte die aufstrebende Stadt St. Gallen dem Kloster das Münzrecht streitig und 1373 verpachteten die Mönche dieses an die Stadt. 1415 wurde ihr selber aber das Münzrecht durch König Sigismund verliehen. Nach längeren Streitereien zwischen Abtei und Stadt wurde im Jahre 1457 das von der Stadt beanspruchte Recht für 7.000 Gulden abgelöst. Formell verzichtete die Abtei allerdings nicht und ließ sich 1485 das Recht von Kaiser Friedrich III. bestätigen. Bis 1622 blieb die Prägetätigkeit allerdings eingestellt, als unter Abt Bernhard Müller von Ochsenhausen das Münzrecht nochmals von Kaiser Ferdinand II. bestätigt und danach Reichstaler geprägt wurden. Im 17. Jh. gab es wiederum keine Münzen, aber einige Gedenkmedaillen. Erst Abt Beda Angehrn (1767-1796) ließ als letzter Münzherr nochmals prägen. 1798 ging das Münzrecht an die Helvetische Republik über und 1805 wurde die Abtei aufgehoben. Sankt Gallen - Stadt Die Stadt St. Gallen entstand außerhalb der Klostermauern, besaß aber zunächst keine eigenen Rechte. Im 13. und 14. Jh. begannen die Bestrebungen nach Selbstverwaltung. und 1415 gingen wichtige Rechte (darunter das Münzrecht) auf die Stadt über, die Freie Reichstadt wurde und bis 1798 unabhängige Stadtrepublik war. 1454 wurde ein Bündnisvertrag mit der Eidgenossenschaft geschlossen und man blieb zugewandter Ort bis 1798. Die ersten städtischen Prägungen sind noch Hohlpfennige. 1424 schloß man eine Vertrag mit Schaffhausen und Zürich für fünf Jahre über die Prägung von Hellern, Angstern und Plapparten. Auf Basis dieses Vertrages entstand 1424 der sog. "St. Gallener Plappart", der als erste datierte schweizerische Münze gilt. 1475 erschienen weitere Plapparte mit dem Reichsadler und einer Madonna. Im Jahre 1500 erhielt die Stadt von Kaiser Maximilian das Recht, Großsilbermünzen bis zu 24 Kreuzer zu prägen. Von 1500 bis 1513 gab es zahlreiche dieser Dicken. Aus der gleichen Zeit stammen die ersten sog. Etschkreuzer. Nach 1527 kam es zu einem Stillstand in der Prägetätigkeit und erst die Reichsmünzordnung von 1559 führte zu zahlreichen neuen Prägungen. 1563 bis 1567 gab es erste Taler, 1563 bis 1566 halbe Taler und 1563 bis 1589 große Mengen an Groschen. Von 1589 bis 1618 sind keine datierbaren Münzen bekannt. 1618 bis 1621 gab es einige Goldmünzen, 1620 bis 1624 große Emissionen an Talern, 1620 Halbtaler, 1618 bis 1633 letzte Dicken zu 24 Kreuzern bzw. 6 Batzen und 1619 bis 1624 Halbdicken oder 3-Batzen-Stücke. Ab 1633 stand die Münzstätte dann wieder still. Erst 1714 wurde die Münzstätte wieder eröffnet und es wurden große Mengen an Scheidemünzen ausgeprägt. Die größte Nominale aus dieser Zeit ist der Halbgulden oder 30 Kreuzer aus dem Jahre 1738. Im Jahre 1798 endete die Münzhoheit der Stadt. Sankt Gallen - Kanton Nach dem Zusammenbruch der Helvetischen Republik wurde 1803 aus St. Gallen und verschiedenen umliegenden Gebieten der Kanton St. Gallen. geschaffen, der als souveräner Kanton natürlich auch das Münzrecht erhielt. Von 1807 bis 1821 wurde dort eigenes Geld geprägt, wobei als letzte Jahreszahl 1817 vorkommt. Es gab halbe Schweizer Franken, 5 Batzen, und 6 Kreuzer sowie Batzen, Halbbatzen, Halbkreuzer, 2 Pfennige und 10 Pfennige. zurück Der "St. Gallener Plappart" entstand 1424 auf Grund eines Vertrag mit Schaffhausen und Zürich, der für fünf Jahre über die Prägung von Hellern, Angstern und Plapparten vorsah. Der "St. Gallener Plappart" gilt als erste datierte schweizerische Münze. zurück Beim "St. Gaudens Double Eagle" handelt es sich um eine amerikanische 20-Dollar-Goldmünze, die 1907 nach einem Entwurf von Augustus Saint-Gaudens eingeführt wurde und für einen der schönsten Typen der Vereinigten Staaten von Amerika gehalten wird. Die Vorderseite zeigt die stehende Liberty (Freiheitsgöttin) mit Fackel und Zweig in Händen, die Rückseite den Steinadler im Flug vor der aufgehenden Sonne. Die ersten Proben waren sehr hoch reliefiert und mit römischen Zahlbuchstaben (statt der später verwendeten arabischen Zahlen) datiert. Diese und die frühen Umlaufstücke von 1907 und Anfang 1908 waren auf der Rückseite nicht mit dem Motto "IN GOD WE TRUST" versehen, das im Laufe des Jahres 1908 bis zum Prägeende 1933 auf den Rückseiten unterhalb der Sonnenstrahlen angebracht war. Die Vorderseitendarstellung des Saint-Gaudens-Typs ist seit 1986 auf den US-amerikanischen Gold-Bullionmünzen "American Eagle" zu 5, 10, 25 und 50 US-Dollar zu sehen, die zuerst mit römischer, seit 1992 mit arabischer Jahreszahl datiert sind. zurück St. Helena ist eine Insel im Atlantischen Ozean und britische Kolonie. zurück Das "St.-Helena-Pfund" (ISO-4217-Code: SHP) ist die Währung des britischen Überseegebiets St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha. Es gilt 1 St.-Helena-Pfund = 100 Pence. Die Insel läßt eigene Münzen zu 1 Penny, 2, 5, 10, und 50 Pence sowie 1 und 2 Pfund prägen. Außerdem gibt es Banknoten zu 5, 10 und 20 Pfund. Das "St.-Helena-Pfund" ist zu einem Kurs von 1:1 fix an das Britische Pfund gekoppelt. zurück Französischer Name der Stadt Akkon. zurück St. Kitts ist eine Insel in der Karibik. Sie ist auch noch unter ihrem früheren Namen St. Christopher bekannt. Die Insel gehörte zur Präsidentschaft der britischen Kronkolonie Leeward-Inseln und seit dem Ausscheiden Anguillas aus dem assoziierten Staatenverbund St. Christopher-Nevis-Anguilla geben St. Kitts und Nevis eigene Briefmarken heraus. Am 19.09.1983 wurden St. Kitts und Nevis unabhängig und bildeten zusammen den Inselstaat St. Kitts und Nevis. Ihr Name ist abgeleitet von einem spanischen Namen, der durch Christoph Kolumbus vergeben wurde. Während der letzten Eiszeit war der Meeresspiegel ca. 60 m niedriger und St. Kitts, Nevis, Sint Eustatius und Saba bildeten eine zusammenhängende Insel. Die Insel hat eine Größe von 93 qkm. Seit 1882 war sie mit Nevis vereinigt. Am 19.09.1983 wurde die Insel unabhängig. Die Insel liegt 2.021 km südöstlich von Miami. Die Entfernung zu Saint Eustatius im Norden beträgt 13 km, nach Nevis im Süden 3 km. Die Landfläche beträgt 169 qkm (max. Ausdehnung 30 x 10 km). zurück Die Inseln St. Kitts und Nevis gehörten zur Präsidentschaft der britischen Kronkolonie Leeward-Inseln. 1908 wurde das Gebiet in St. Christopher (dem späteren St. Kitts), Nevis und Anguilla umbenannt. Ab dem 12.02.1967 war es assoziierter Staat, von dem sich Anguilla am 12.07.1967 faktisch trennte. Die Föderation &&St. Kitts und Nevis&& (früher: Saint Christopher und Nevis) ist ein unabhängiger Staat im Commonwealth of Nations und Mitglied der Vereinten Nationen. Amtssprache: Englisch Hauptstadt: Basseterre Staatsform: Parlamentarische Monarchie Fläche: St. Kitts 176 qkm, Nevis 93 qkm, zusammen 269 qkm Einwohnerzahl: 39.349 (2007) Bevölkerungsdichte: 146,3 Einwohner pro qkm BIP/Einwohner: 7.840 US-Dollar (2004) Unabhängigkeit: 19.09.1983 Nationalfeiertag: 19. September (Unabhängigkeitstag) Zeitzone: UTC -4 Stunden Währung: Ostkaribischer Dollar zurück Das Gebiet St. Christopher (später: St. Kitts), Nevis und Anguilla war ab 1952 unter dem Namen "St. Christopher Nevis Anguilla" bekannt, obwohl sich Anguilla schon am 12.07.1967 faktisch trennte. zurück Saint-Lô (auch: Saint Laud) ist eine französische Stadt in der Region Basse-Normandie und liegt auf der Halbinsel Cotentin. In den Jahren 1540-1693 besaß die Stadt auch eine eigene Münzstätte. zurück &&St. Lucia&& liegt nördlich von St. Vincent und den Grenadinen und südlich von Martinique im Bereich der Westindischen Inseln und gehört zu den Kleinen Antillen. Die Insel war britische Kolonie. Am 01.03.1967 wurde die Insel assoziierter Staat des Britischen Königsreichs und am 22.02.1979 unabhängig. Seitdem ist sie ein unabhängiger Inselstaat im Commonwealth of Nations. Amtssprache: Französisch, Englisch, Spanisch Hauptstadt: Castries Staatsform: Parlamentarische Monarchie Fläche: 619,15 qkm Einwohnerzahl: 167.640 (2006) Bevölkerungsdichte: 270,8 Einwohner pro qkm BIP/Einwohner: 4.580 US-Dollar (2004) Unabhängigkeit: 22.02.1979 Zeitzone: UTC -4 Stunden Währung: Ostkaribischer Dollar zurück Sainte-Marie ist eine Insel vor der Ostküste Madagaskars im Indischen Ozean und war französische Kolonie. zurück St. Palais ist ein Ort in Navarra, in dem es in früherer Zeit auch eine Münzstätte gab. zurück Hierbei handelt es sich um Half Pennies (Halbpfennige) und Farthings (Viertelpfennige), die der irische Einwanderer Mark Newby 1681 nach New Jersey mitbrachte, danach auch "Mark Newby Pieces" genannt. Die Kupferstücke (es gibt auch seltene silberne Farthings) wurden vermutlich in den 70er Jahren in Dublin geprägt und im Mai 1682 von der Generalversammlung der nordamerikanischen Kolonie als legale Zahlungsmittel akzeptiert. Die Vorderseite zeigen einen knienden, Harfe spielenden König, in der Umschrift (durch eine große Krone getrennt) die Worte "FLOREAT REX" (deutsch: "Möge der König aufblühen"). Die Rückseiten zeigen St. Patrick. Auf den größeren Half Pennies ist der Heilige als Prediger mit Bischofsstab und Kleeblatt in Händen zu sehen, umgeben von Menschen. Auf den kleineren Farthings ist er als Beschützer, der Reptilien und Schlangen vertreibt, mit einem Langkreuz in der Linken dargestellt. zurück &&Saint-Pierre und Miquelon&& ist eine kleine Inselgruppe östlich der kanadischen Küste, und ca. 25 km vor Neufundlund. Die Inselgruppe besteht aus den Inseln Saint-Pierre (26 qkm), Miquelon (110 qkm), Langlade (91 qkm) sowie weiteren kleineren Inseln und hat eine Gesamtfläche von 242 qkm. Früher waren die Inseln Miquelon und Langlade getrennt, heute sind sie mit einer schmalen Nehrung verbunden und werden nun einheitlich als Miquelon bezeichnet. In diesem Gebiet leben etwa 6.316 Einwohner (Saint-Pierre: 5.618 Einwohner, Miquelon zusammen mit Langlade: 698 Einwohner). Die Inseln stellen das letzte Überbleibsel der französischen Kolonien in Nordamerika dar. 1670 wird erstmals eine kleine Siedlung französischer Fischer auf Saint-Pierre erwähnt, die vermutlich schon seit dem frühen 17. Jahrhundert bestand. Zwischen 1942 und 1945 war das Gebiet kanadisch besetzt. Ab 1946 wurde die Kolonie zunächst französisches Überseegebiet. Seit dem 16.07.1976 ist St. Pierre und Miquelon eine Departement Frankreichs. Hauptstadt: Saint-Pierre Fläche: 242 qkm Einwohnerzahl: 6.316 Bevölkerungsdichte: 29 Einwohner pro qkm Zeitzone: UTC -3 Währung: Euro (€) 1 Euro = 100 Cent zurück &&St. Vincent&& ist die Hauptinsel des karibischen Inselstaates St. Vincent und die Grenadinen. Der Staat liegt in der Karibik im Bereich der westindischen Inseln und umfaßt die Insel St. Vincent und die 32 Inseln der nördlichen Grenadinen, die zu den Kleinen Antillen gehören. Grenada selbst gehört nicht dazu. St. Vincent war britische Kolonie. Am 01.06.1967 erhielt die Insel die Selbstverwaltung, war seit dem 01.06.1969 assoziierter Staat des Britischen Königreichs und wurde am 27.10.1979 unabhängig. Amtssprache: Englisch Hauptstadt: Kingstown Staatsform: Konstitutionelle Monarchie Fläche: 388 qkm Einwohnerzahl: 117.848 (2006) Bevölkerungsdichte: 303,7 Einwohner pro qkm BIP/Einwohner: 3.530 US-Dollar (2004) Unabhängigkeit: Autonomie 1969, Unabhängigkeit 27.10.1979 Zeitzone: EST (UTC -5) Währung: Ostkaribischer Dollar zurück  Die Republik &&San Marino&& (italienisch: Republica di San Marino, Beiname: La Serenissima) ist ein Staat in Südeuropa. Er ist vollständig von Italien umgeben und liegt zwischen den Regionen Emilia-Romagna (Provinz Rimini) und Marken (Provinz Pesaro und Urbino), nahe der adriatischen Küste bei Rimini. Den Felskamm Monte Titano krönt die Festung La Guaita. San Marino ist die älteste Republik der Welt mit einer Geschichte, die bis auf das Jahr 301 zurückgeht. Das Land ist kein Stadtstaat, sondern besteht aus neun Gemeinden. Die Republik &&San Marino&& (italienisch: Republica di San Marino, Beiname: La Serenissima) ist ein Staat in Südeuropa. Er ist vollständig von Italien umgeben und liegt zwischen den Regionen Emilia-Romagna (Provinz Rimini) und Marken (Provinz Pesaro und Urbino), nahe der adriatischen Küste bei Rimini. Den Felskamm Monte Titano krönt die Festung La Guaita. San Marino ist die älteste Republik der Welt mit einer Geschichte, die bis auf das Jahr 301 zurückgeht. Das Land ist kein Stadtstaat, sondern besteht aus neun Gemeinden.Amtssprache: Italienisch Hauptstadt: San Marino Staatsform: Republik Fläche: 60,57 qkm Einwohnerzahl: 30.308 (Stand September 2006) Bevölkerungsdichte: 500,4 Einwohner pro qkm Unabhängigkeit: 03.09.301 Zeitzone: MEZ (UTC+1) Währung: Euro zurück Hierbei handelt es sich um eine Kupfermünze zu 2 1/2 Baiocchi, die Papst Pius VI. (1775-1799) zwischen 1795 und 1797 im Kirchenstaat schlagen ließ. Die Vorderseite zeigt meist den hl. Petrus und die Rückseite den Wert ("BAIOCCHI/ DVE E MEZZO"), Prägeort und Datum. zurück San Severino ist eine Stadt in Italien in der heutigen Region Marken. Im Mittelalter gab es dort auch eine päpstliche Münzstätte, die vor allem vor und während der Napoleonischen Feldzüge in Italien (1796 und 1799) für die Päpste Kupfermünzen prägte. zurück &&Sansibar&& (auch: Zanzibar, Bedeutung wahrscheinlich "Küste der Schwarzen") ist eine Inselgruppe vor der Ostküste Afrikas. Sie besteht aus der Hauptinsel Unguja, welche von Europäern meist fälschlich "Sansibar" genannt wird, und der weiter nördlich gelegenen Insel Pemba. Unguja hat eine Größe von 1.658 qkm und Pemba eine Größe von 984 qkm. Sansibar ist ein autonomer Teil des Unionsstaates Tansania (der Landesname "Tansania" setzt sich aus den zwei föderalen Teilen Tanganjika und Sansibar, verbunden mit der Bezeichnung "Azania" zusammen). Hauptstadt und ökonomisches Zentrum ist Zanzibar City mit der weltberühmten Altstadt Stone Town auf Sansibar. Die Inselhauptstadt von Pemba ist Chake Chake. Das Sultanat war britisches Schutzgebiet und erlangte am 10.12.1963 seine Unabhängigkeit. Am 26.04.1964 erfolgte der Zusammenschluß mit Tanganjika zu Tanganjika-Sansibar, das 1965 in Tansania umbenannt wurde. zurück Französisch für "ungültig" (englisch: invalid). zurück Hierbei handelt es sich um eine Luccheser Münze zu 25 Soldi oder im Wert von 2 Barbone, die in der 2. Hälfte des 16. Jh. eingeführt wurde. Die Silbermünze der Republik Lucca im Gewicht von 8,64 g (895/1000 fein) wurde zwischen 1615 und 1682 sowie 1734 und 1756 geprägt. Der Typ zeigt auf der Vorderseite das verzierte Wappen und auf der Rückseite den gekreuzigten St. Vultus. zurück Santa Fé de Bogota war eine spanisch-amerikanische Münzstätte, die 1626 gegründet wurde und ab 1628 hauptsächlich Goldmünzen prägte. Als Münzzeichen wurden "V", "VA" und "BOGOTA" verwendet. Ab 1813 wurden hier die Münzen für Kolumbien geprägt. zurück Beim "San Thomé" handelt es sich um eine Goldmünze aus Portugiesisch-Indien, die seit 1545 (bis 1841) in Goa und 1684 bis 1757 in Diu geprägt wurde. Zwischen 1753 und 1755 kam es auch in Daman (Damao) zur Ausgabe, der nach St. Thomas, dem Apostel Indiens, benannten Goldmünze. Auf Grund der primitiven Prägebedingungen handelt es sich um oft sehr schlecht geprägte Stücke. Das betrifft vor allem die aus Diu (Münzzeichen "D-O") geschlagenen Stücke. Es gibt mehrere Typen. Die früheren zeigen den Apostel Thomas (stehend oder sitzend) auf den Vorderseiten und den gekrönten Wappenschild auf den Rückseiten, zuletzt 1728. Im 18. und 19. Jh. zeigen die Vorderseiten meist das gekrönte Wappen und die Rückseiten Kreuze, häufig das Thomaskreuz. Sie schwanken stark in Durchmesser, Gewicht und Wert (zwischen 1 und 12 silberne Xerafim). zurück Der "Santeem" ist eine äthiopische Kleinmünze, die 1945 die Matona ablöste. zurück Schon Ende des 17. Jh. stellte man in Santiago de Chile den Antrag zur Errichtung einer Münzstätte, die aber erst im Jahre 1743 vom Vizekönig genehmigt wurde, nachdem die Bürger zugesagt hatten, die Kosten zu übernehmen. Zunächst blieb die Münzstätte in Privatbesitz, bis sie 1772 verstaatlicht wurde. Ab 1749 gab es schon 4- und 8-Escudo-Stücke in Gold und ab 1751 in Silber. Seit 1817 ist Santiago de Chile die Münzstätte der Republik Chile. Als Münzzeichen wird ein "S" mit einem kleinen "o" darüber verwendet. zurück Mehrzahl des lettischen Santims. zurück Hierbei handelt es sich um eine kleine Münze der Republik Lettland von 1922 bis zur russischen Besetzung 1940 und - nach Anerkennung der Unabhängigkeit Lettlands 1991 - wieder seit der Münzreform vom 05.03.1993. Es galten 100 Santimi = 1 Lats. Die Bezeichnung lehnt sich landessprachlich an das französische Wort "Centime" an. Es gibt Stücke zu 1 Santims, 2 und 5 Santimi und 10, 20, und 50 Santimi. zurück Santo Domingo war nach Mexico City die zweite Münzstätte, die die Spanier in Amerika errichteten. Nach einem Edikt von 1542 wurden hier Münzen zu 1/2, 1, 2 und 4 Reales. zurück &&Sao Tomé & Principe&& war von 1876 bis 1950 portugiesische Kolonie, ab 1954 bis 1975 »portugiesische Überseeprovinz«. Die Insel São Tomé im Golf von Guinea ist ein Teil des afrikanischen Staates São Tomé und Príncipe. Sie bildet gleichzeitig zusammen mit umliegenden kleineren Inseln die Provinz São Tomé mit der Stadt São Tomé als Provinzhauptstadt. Die Südspitze von São Tomé liegt nur zwei km nördlich des Äquators. Ca. 1 km südlich dieser Südspitze liegt die 3 qkm kleine Insel Rolas, die vom Äquator geschnitten wird. Vom afrikanischen Festland (Hafenstadt Port-Gentil in Gabun) ist die Insel 240 km entfernt. Hauptstadt: São Tomé Fläche: 859 qkm Einwohner: 91.356 (1991) Bevölkerungsdichte: 106,35 Einwohner pro qkm (1991) Währung: São-toméischer Dobra zurück Der "São-toméische Dobra" (ISO-4217-Code: STD; Abkürzung: Db) ist die Währung auf São Tomé und Príncipe. Ein Dobra war in 100 Céntimos eingeteilt. Diese werden zur Zeit aber nicht mehr genutzt. 1.000 Dobra werden auch "Conto" genannt. Bis zur Unabhängigkeit am 12.07.1975 war der portugiesische Escudo die Währung in Sao Tomé und Principe. Im Umlauf befinden sich seit 1997 Münzen zu 500, 1.000 und 2.000 Dobra, sowie Banknoten zu 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 und 100.000 Dobra. zurück Andere Schreibweise für Sapèque. zurück "Sapèque" (auch: Sapek) ist die französische Bezeichnung für das Geld von Annam, die aus dem Malaiischen "sa" (deutsch: "eins") und "paku" (deutsch: "Kette") abgeleitet ist, da man die durchlochten Münzen an einer Schnur aufreihte. zurück ISO-4217-Code für den Saudi-Rial. zurück Der "Saracenatus" (auch: Sarazino oder Saraceno) wurde in Europa ein nach dem Fuß des byzantinischen Solidus geschlagenes arabisches Goldstück genannt. Um die Mitte des 12. Jh. bezeichnete man dann die von den Kreuzfahrerstaaten nachgeahmten Stücke der ayubidisch-arabischen Dinare lateinisch als "Saracenati". Die kufischen Aufschriften der Nachahmungen sind von den Kreuzfahrern anfangs meist nur vorgetäuscht worden (Trugschriften). Als im 13. Jh. fast identische Beischläge mit echten kufischen Legenden auftauchten, ließ sie Papst Innozenz IV. (1254-1261) verbieten. Später wurden von den Kreuzfahrern noch "Saracenati" mit fatimidischer Schrift, aber mit abweichendem (christlichen) Inhalt und Kreuzzeichen geprägt. zurück Alternative Bezeichnung für Saracenatus. zurück Saragossa ist heute die Hauptstadt der spanischen Autonomen Gemeinschaft Aragonien sowie der Provinz Saragossa und des gleichnamigen Kreises . Sie liegt am Mittellauf des Ebro ungefähr in der Mitte der Region Aragonien in Spanien. In der Zeit von 1366 bis 1387 gab es dort auch eine Münzstätte, die den Kennbuchstaben "Z" verwendete. zurück Alternative Schreibweise von Serapis. zurück Sarawak gehörte zu den malaiischen Staaten. zurück Sarazenen ist ein Begriff, der ursprünglich einen im Nordwesten der arabischen Halbinsel siedelnden Volksstamm bezeichnete. Im Gefolge der islamischen Expansion wurde der Begriff in lateinischen Quellen und im christlichen Europa als Sammelbezeichnung für die muslimischen Völker, die ab ca. 700 n.Chr. in den Mittelmeerraum eingedrungen waren, verwendet, meist in angstgeprägtem Sinn. Obgleich dieser Begriff noch heute zuweilen in historischen Darstellungen als Bezeichnung für Muslime verwendet wird, ist dieser Gebrauch geschichtswissenschaftlich nicht korrekt, da häufig nicht klar wird, welche muslimische Macht (Fatimiden, Ziriden, Abbasiden usw.) konkret damit gemeint ist. zurück Alternative Bezeichnung für Saracenatus. zurück Sardeis ist eine antike Stadt in Kleinasien, die auch eine eigene Münzstätte besaß, in der auch Kistophoren geschlagen wurden. zurück Sardinien, das zu Altitalien gehört, wurde in der Antike auch von Phöniziern, Griechen und Römern besiedelt. Die phönizisch-punische Zeit auf Sardinien begann im 9. Jh. v.Chr. Mitte des 6. Jh.v. Chr. hatten die Punier den Süden und Westen Sardiniens unter Kontrolle gebracht. Bis zum Ersten Punischen Krieg waren die punischen Bewohner Karthagos nominell die Herren der Insel. Nach der römischen folgte die achtzigjährige Besetzung durch die Vandalen ab 455 n.Chr. Die byzantinische bzw. oströmische Besetzung begann dann 534, als der kaiserliche Feldherr Belisar die Inseln im westlichen Mittelmeer eroberte. Kurz erschienen die Ostgoten auf der Insel, die 552 unter Totila Cagliari eroberten. Die Langobarden versuchten die Insel ab 568 mehrmals zu erobern, aber ohne Erfolg. Mit der Eroberung von Sulcis im Jahre 704 brach eine mehr als zweihundertjährige Phase an, in der die Araber immer wieder die Insel überfielen. Die byzantinische Herrschaft endete als Folge der arabischen Eroberung Siziliens um 832 mit der Sezession des byzantinischen Statthalters. Sardinien wurde ab 860 mehr oder weniger völlig von arabischen Muslimen beherrscht, die um 1020 von den Armeen der Stadtstaaten Genua und Pisa verdrängt wurden. Der Staufer und König von Sizilien, Friedrich II. (1198–1250), ernannte 1239 seinen illegitimen Sohn Enzio zum König von Sardinien (1239–1249, gest. 1272). Sardinien fiel später, ebenso wie Sizilien, zunächst dem Königreich von Aragon (1323–1409) zu, das den sardischen Reichsstatus erneuerte, und gehörte seit dem frühen 16. Jh. in Personalunion zum Königreich Spanien. Nach dem Aussterben der spanischen Habsburger fiel Sardinien nach dem Spanischen Erbfolgekrieg 1714 an die österreichische Linie des Hauses Habsburg, wurde jedoch schon 1720 von Österreich – im Tausch gegen Sizilien – an das Herrscherhaus von Savoyen abgetreten. Das neu entstandene Königreich Sardinien mit seiner Hauptstadt Turin und seinen Provinzen Savoyen und Piemont hatte seinen geographischen Schwerpunkt jedoch auf dem italienischen Festland. Lediglich während der französischen Okkupation des norditalienischen Reichsteils zwischen 1799/1800 und 1814 regierten die sardischen Könige Karl Emanuel II. (1796–1802) und sein Bruder Viktor Emanuel I. (1802–1821) – ähnlich wie wenig später der aus Neapel vertriebene bourbonische König von Sizilien, Ferdinand IV. – unter dem Schutz der britischen Flotte direkt von ihrer Insel Sardinien aus, die sonst eher vernachlässigt wurde. Im Zuge der italienischen Einigung wurde der Herrscher Sardiniens Viktor Emanuel II. (1849–1878) im Jahre 1861 König von Italien. zurück Alternative Bezeichnung für Stephanspfennige. zurück Sarnen ist eine politische Gemeinde und der Hauptort des schweizerischen Kantons Obwalden. Dort gab es auch eine Münzstätte, die Münzen aus Gold, Silber und Billon prägte. zurück Alternative Schreibweise für Sassaniden. zurück  Der Gründer des &&Sassanidenreiches&& war Ardaschir I. (Regierungszeit 224–240), ein aufständischer Fürst aus dem Süden des Partherreiches, der Persis, wo die Sassaniden als Unterkönige fungierten. Nachdem er den letzten Partherkönig, den Arsakiden Artabanos IV., im Jahre 224 n.Chr. getötet hatte, nahm er dessen Platz ein, schaltete bald auch Vologaeses VI., aus und eroberte wohl 226 die parthische Hauptstadt Ktesiphon, die Hauptresidenz der Sassanidenkönige wurde. Es kam auch zu Feldzügen im Nordosten des Reiches sowie an der Golfküste. Der Gründer des &&Sassanidenreiches&& war Ardaschir I. (Regierungszeit 224–240), ein aufständischer Fürst aus dem Süden des Partherreiches, der Persis, wo die Sassaniden als Unterkönige fungierten. Nachdem er den letzten Partherkönig, den Arsakiden Artabanos IV., im Jahre 224 n.Chr. getötet hatte, nahm er dessen Platz ein, schaltete bald auch Vologaeses VI., aus und eroberte wohl 226 die parthische Hauptstadt Ktesiphon, die Hauptresidenz der Sassanidenkönige wurde. Es kam auch zu Feldzügen im Nordosten des Reiches sowie an der Golfküste.Eine erste Auseinandersetzung mit den Römern unter Kaiser Severus Alexander gab es 231/32, die aber trotz hoher Verluste auf beiden Seiten weitgehend ergebnislos verlief. Nach dem Tod des Kaisers 235 griff Ardaschir jedoch wohl 238 erneut an und eroberte mehrere Städte. 240/41 konnte dann das strategisch wichtige Königreich Hatra nach mehrjähriger Belagerung der Hauptstadt und mit gewaltigem Aufwand erobert werden. 243 fielen die Römer in Persien ein. Schapur besiegte (nach anfänglichen Rückschlägen) im Jahr 244 den römischen Kaiser Gordian III., der gegen ihn gezogen war und nun den Tod fand, in der Schlacht von Mesiche. Schapurs Sohn und Nachfolger Hormizd I. betrieb eine ähnlich tolerante Religionspolitik. Hormizd regierte jedoch kaum länger als ein Jahr, und unter seinen Nachfolgern Bahram I. (273–276) und vor allem Bahram II. (276–293) wurden die Manichäer, die auch im Römischen Reich Anhänger fanden, dann wiederholt verfolgt. Mani wurde hingerichtet. Bahram II. mußte sich mehrerer Bedrohungen erwehren, so eines Angriffes der Römer unter Kaiser Carus. In der Regierungszeit des römischen Kaisers Diokletian mußten die Sassaniden dann unter König Narseh (293–302) nach einer schweren Niederlage gegen den Caesar Galerius 298 im Frieden von Nisibis einige Gebiete im nördlichen Mesopotamien und fünf Satrapien östlich des Tigris abtreten. Die Sassaniden, ganz ähnlich wie die Römer, hatten nicht nur an einer Front zu kämpfen. Auch das Neupersische Reich mußte sich (wie schon die Parther) gegen Eindringlinge aus den Steppen Zentralasiens zur Wehr setzen. Die Pässe des Kaukasus mußten ebenso verteidigt werden wie die stets gefährdete Nordostgrenze, wo die Sassaniden zunächst gegen die Kushan und Saken zu kämpfen hatten. Der westliche Teil des Kushanreiches wurde vielleicht schon von Ardaschir I. besetzt. Um 350 fielen auch die Chioniten in das östliche Perserreich ein. Zu Beginn des 5. Jh. folgten ihnen die Hephthaliten (die "Weißen Hunnen"), die ein noch gefährlicherer Gegner waren und sich wiederholt auch in die inneren Angelegenheiten Persiens einmischten. Im Verhältnis zu Rom kam es im Laufe der Zeit zu einer bemerkenswerten Wandlung. Die Römer akzeptierten die Sassaniden notgedrungen als nahezu gleichberechtigt. Für sie waren diese Perser keine Barbaren im engeren Sinne mehr (wie etwa die Germanen), sondern eine zivilisierte, gleichstarke und (fast) ebenbürtige Macht. Kaiser Julian, der Nachfolger des Constantius, nahm den Perserkrieg seines Vorgängers wieder auf und rückte im März 363 mit einem starken Heer von etwa 65.000 Mann in Mesopotamien ein. Bald stand der Kaiser, dem Schapur immer wieder geschickt ausgewichen war, vor Ktesiphon. Dort aber entschied er sich zur Umkehr. Von seinen Nachschublinien abgeschnitten, fiel Julian am 26. Juni in einem Gefecht und ließ das römische Heer in einer verzweifelten Situation zurück. Schapur III. (383–388) stellte die Christenverfolgungen ein und vereinbarte mit dem römischen Kaiser im Osten, Theodosius I., wohl 387 die Teilung des stets umstrittenen Armeniens. In der Regierungszeit Bahrams IV. (388–399) kam es 395 zu einem Einfall von Hunnen, welche die Kaukasuspässe passierten und bis tief nach Mesopotamien eindrangen. Bahram V. Gor (420/421–439), einem Sohn Yazdegerds I., wurde die Königswürde auf Grund der Unbeliebtheit seines Vaters zunächst verweigert, so daß er sich den Thron mit Hilfe der arabischen Lachmiden, die eine bedeutende Rolle in der persischen Grenzverteidigung gegen Rom spielten, erkämpfen und zu diesem Zweck auch einige Kompromisse mit dem mächtigen Adel eingehen mußte. Dennoch entwickelte sich Bahram V. zu einem der bedeutendsten Sassanidenkönige. Nach der nur kurzen Regierungszeit Hormizds III. (457–459) gelangte dessen Bruder Peroz I. (459–484) gewaltsam auf den Thron. Im 5. Jh. waren die Beziehungen zu den Römern zumeist friedlicher Natur, da nicht nur die Kaiser, sondern auch die Perser Probleme an anderen Fronten hatten. 484 fiel König Peroz im Kampf gegen die Hephthaliten, die zeitweise sogar Tribute von den Sassaniden empfangen hatten - ein Tiefpunkt der sassanidischen Geschichte. Allerdings spielten die Hephthaliten auch eine Rolle bei der Thronbesteigung Kavadhs I. (488–496 und wieder von 499–531), als er mit ihrer Hilfe seinen Konkurrenten Balasch (484–488) entmachten konnte. In Kavadhs Regierungszeit kam es aber auch zu inneren Wirren. Letztendlich konnte sich das Königtum jedoch behaupten. Kavadh, der zwischenzeitlich vertrieben und durch Zamasp (496–499) ersetzt worden war, aber mit Hilfe der Hephthaliten wieder an die Macht kam, gelang es sogar, die Stellung der Zentralregierung gegenüber den mächtigen Adelsfamilien zu stärken. Großkönig Chosrau I. Anuschirvan ("mit der unsterblichen Seele"; 531–579) war der große Gegenspieler des nicht minder bedeutenden oströmischen Kaisers Justinian I. Während Chosraus Herrschaft erreichte das Reich seine größte Blüte, er selbst lebt in der Sagenwelt des Orients weiter, während sein Name als "Kisra" bei den Arabern bis heute das Synonym für "König" ist (ähnlich wie Caesar als "Kaiser"“ im Deutschen). Noch 540 wurde die Weltstadt Antiochia am Orontes erobert und geplündert, auf demselben Kriegszug machte Chosrau auch in anderen oströmischen Städten reiche Beute und deportierte Zehntausende nach Persien. Justinian sah sich nun gezwungen, den Krieg gegen die Perser wieder aufzunehmen und entsandte seinen magister militum Belisar in den Osten. Die Römer und Sassaniden schlossen schließlich 562 erneut Frieden, wobei Justinian diesmal Tributzahlungen zustimmen mußte, aber dafür die Kontrolle über Lazika behielt. Allerdings kam es nur wenige Jahre später unter Justinians Nachfolger Justin II. erneut zu Kampfhandlungen, wobei die Perser nach großen Anfangserfolgen 575 (oder 576) bei Melitene ihre seit langem schwerste Niederlage gegen die Römer hinnehmen mußten. Chosrau konnte nur mit Mühe entkommen, doch brachte der römische Sieg keine Entscheidung. Chosraus Sohn Hormizd IV. (579–590) führte den 572 erneut ausgebrochenen Krieg gegen Ostrom mit wechselndem Erfolg fort und mußte sich bald auch der Türken an der Nordostgrenze erwehren. Von 603 bis 629 tobte zwischen Oströmern und Sassaniden dann der letzte große Krieg der Antike. Chosrau II., der mit Hilfe seines Beraters Yazdin die Staatsfinanzen saniert hatte und der die Schwäche des Oströmischen Reichs nach dem Sturz des Maurikios nutzte, präsentierte einen angeblichen Sohn seines 602 ermordeten Gönners und fiel daraufhin Anfang 603 in oströmisches Gebiet ein. 614 eroberten die Perser Jerusalem und führten das angebliche Kreuz Christi fort, 615/16 erreichten persische Truppen zeitweilig Chalkedon. Seit 619 standen sassanidische Truppen in der Kornkammer des römischen Reiches, in Ägypten, und drangen im Westen bis in die Barka, im Süden bis in den Sudan vor. Während die Sassaniden in den vorangegangenen drei Jahrhunderten niemals ernsthaft versucht hatten, ihren Machtbereich im Westen über Armenien und Mesopotamien hinaus auszuweiten, brach Chosrau angesichts der militärischen Erfolge nun mit dieser Politik. Syrien und Ägypten wurden um 620 als dauerhafte Eroberung administrativ in das Perserreich integriert. Anfang Dezember 627 fügte Herakleios den Persern in der Schlacht bei Ninive eine Niederlage zu. Chosrau II., der sich in der Nähe aufhielt und von dem römischen Vorstoß überrascht worden war, mußte fliehen und verlor damit sein Ansehen und seinen Rückhalt bei den Großen des Reiches; er wurde bald darauf (Februar 628) entthront und schließlich ermordet. Sein Nachfolger Kavadh II. ersuchte um Frieden. Die Sassaniden mußten das Kreuz Christi und alle eroberten Gebiete zurückgeben (629/630). Nach der Ermordung Chosraus II. und dem Tod Kavadhs II. folgten eine Zeit der Wirren und rund ein Dutzend schnell wechselnder Herrscher. Das Ende des geschwächten Sassanidenreiches wurde in der Regierungszeit Yazdegerds III. (632–651) besiegelt, als die Heere der muslimischen Araber sowohl in die oströmischen Orientprovinzen als auch in das Sassanidenreich eindrangen. zurück   Die Sassaniden sind die letzte altpersische Dynastie, die von Ardaschir, einem Vasallen der Parther, in der Persis begründet wurde. Die Dynastie ist nach dem Großvater Ardaschirs, Sassan, einem Priester des Feuerkults, benannt. Die Sassaniden sind die letzte altpersische Dynastie, die von Ardaschir, einem Vasallen der Parther, in der Persis begründet wurde. Die Dynastie ist nach dem Großvater Ardaschirs, Sassan, einem Priester des Feuerkults, benannt.Bei den Münzen der Sassaniden handelt es sich um stilistisch eigenständige flache und relativ dünne Münzen. Die Drachmen, deren Teilstücke und Obolen sind in Pehlewi, einer altiranischen Schrift, beschriftet. Sie zeigen auf den Vorderseiten in der Regel die bekrönten Büsten der Könige. Die wechselnde Gestalt der Kronen stellt ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal dar, nach dem undatierbare oder unleserliche sassanidische Münzen zeitlich eingeordnet werden können. Die Rückseiten zeigen häufig zwei Priester an einem Feueraltar, vermutlich der Altar des obersten Gottes Ahura Mazda. Die ursprünglich noch naturalistischen Darstellungen werden im Laufe der Zeit immer abstrakter. Nach der Eroberung durch die Araber lehnten sich viele Gepräge an den späten sassanidischen Typ an, allerdings mit arabischen Aufschrift. Diese Münzen werden als arabo-sassanidische Münzen bezeichnet. zurück zurück Spanisch für "glatt" (englisch: glazed bzw. satin-like, französisch: satiné, italienisch: satinato, niederländisch: gesatineerd, portugiesisch: assetinado). zurück Italienisch für "glatt" (englisch: glazed bzw. satin-like, französisch: satiné, niederländisch: gesatineerd, portugiesisch: assetinado, spanisch: satinado). zurück Französisch für "glatt" (englisch: glazed bzw. satin-like, italienisch: satinato, niederländisch: gesatineerd, portugiesisch: assetinado, spanisch: satinado). zurück Alternative Bezeichnung für "glatt" (englisch: glazed bzw. satin-like, französisch: satiné, italienisch: satinato, niederländisch: gesatineerd, portugiesisch: assetinado, spanisch: satinado). zurück Hierbei handelt es sich um Medaillen, deren Darstellungen sich in beißendem Spott auf Personen, Mißstände oder Anschauungen der Zeit beziehen. Satirische Darstellungen auf Kursmünzen sind selten, obwohl es gemilderte satirische (spöttische) Darstellungen gibt, wie die emblematischen Prägungen (Taler) des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel (1589-1613) auf die Auseinandersetzung mit einigen Adligen des Landes. Man spricht in diesem Fall von Rebellen-, Pelikan-, Wespen-, Lügen- und Wahrheitstalern. Zu den "satirischen Medaillen" gehören aber auch Volksmedaillen, die satirische Darstellungen auf Krieg, Inflation und Notzeiten zeigen. Auf den mit dem Hunger der Bevölkerung verbundenen Getreidewucher spielen die Kornjudenmedaillen des Medailleurs Christian Wermuth von 1694 an. Auch religiöse Phänomene wie Reformation, Gegenreformation oder Pietismus werden ebenso satirisch beleuchtet wie erotische Themen (Hahnrei-Medaillen). zurück Englisch für "glatt" (englisch: glazed, französisch: satiné, italienisch: satinato, niederländisch: gesatineerd, portugiesisch: assetinado, spanisch: satinado). zurück Saturn (lateinisch: Saturnus) ist ein römischer Gott, der im Lauf der Zeit mit dem griechischen Kronos gleichgesetzt wurde. Er wurde auch auf vielen Münzen abgebildet, wie z. B. auf dem Semis. Saturn war vor allem der Gott des Ackerbaus und galt als Symbol des mythischen Goldenen Zeitalters, der "Saturnia regna". Nach Hesiod ist er der Sohn des Himmelsgottes Uranus und der Erdgöttin Tellus (vielleicht aber auch Gäa, die allerdings griechisch ist). Er kommt zu großer Macht, nachdem er seinen Vater überwältigt und kastriert. Eine Prophezeiung jedoch sagt voraus, daß er durch die Hand seines eigenen Sohnes entmachtet werden wird. Deshalb fraß Saturn alle seine Kinder, bis auf seinen sechsten Sohn Jupiter, den Saturns Gattin Ops auf der Insel Kreta versteckt hielt und Saturn an seiner Stelle einen in Kleider gehüllten Stein anbot. Nach seiner Entmachtung durch Jupiter floh er zusammen mit Ops (sie entspricht der griechischen Rhea), der römischen Göttin des Erntesegens und der Fruchtbarkeit, nach Latium, wo er von Janus aufgenommen wurde. Als Dank lehrte er die Einwohner Latiums die Kunst des Ackerbaus. zurück zurück Bezeichnung für eine komplette Serie verschiedener Wertstufen. Es handelt sich dabei um gleiche oder unterschiedliche Motive, die sich aber alle auf das gleiche Thema beziehen. Die Münzen oder Medaillen müssen nicht unbedingt zum gleichen Zeitpunkt verausgabt werden, sondern können auch über einen längeren Zeitraum erscheinen (englisch und französisch: set). zurück Bezeichnung für den Katalogpreis oder Verkaufspreis für einen kompletten Satz, wobei eine Addition der Wertansätze aller zum Satz gehörigen Münzen oder Medaillen vorgenommen wird (englisch: price of set, französisch: prix de la série). zurück Bezeichnung für Posten, die aus kompletten Sätzen in gleicher Erhaltung bestehen. zurück Eigenname von Saudi-Arabien. zurück  Das Königreich &&Saudi-Arabien&& ist eine absolute Monarchie in Vorderasien, die sich auf den Islam als Staatsreligion beruft. Saudi-Arabien liegt auf der Arabischen Halbinsel und grenzt an deren Anrainerstaaten, an das Rote Meer und den Persischen Golf. Die beiden heiligsten Stätten des Islam, die Kaaba in Mekka und die Ruhestätte des islamischen Propheten Mohammed in Medina, liegen in Saudi-Arabien. Der Islam wahhabitischer Prägung spielt in Saudi-Arabien eine sehr große Rolle, das Land gilt als besonders strenggläubig und islamisch-konservativ. Der Donnerstag ist teilweise Ruhetag, der Freitag ist ein kompletter Ruhetag. In Saudi-Arabien gilt die islamische Zeitrechnung. Das Königreich &&Saudi-Arabien&& ist eine absolute Monarchie in Vorderasien, die sich auf den Islam als Staatsreligion beruft. Saudi-Arabien liegt auf der Arabischen Halbinsel und grenzt an deren Anrainerstaaten, an das Rote Meer und den Persischen Golf. Die beiden heiligsten Stätten des Islam, die Kaaba in Mekka und die Ruhestätte des islamischen Propheten Mohammed in Medina, liegen in Saudi-Arabien. Der Islam wahhabitischer Prägung spielt in Saudi-Arabien eine sehr große Rolle, das Land gilt als besonders strenggläubig und islamisch-konservativ. Der Donnerstag ist teilweise Ruhetag, der Freitag ist ein kompletter Ruhetag. In Saudi-Arabien gilt die islamische Zeitrechnung.Saudi-Arabien ging 1932 aus der Vereinigung von Hedschas und Nedschd hervor. Amtssprache: Arabisch Hauptstadt: Riad Staatsform: Absolute Monarchie Fläche: 2.240.000 qkm Einwohnerzahl: 26,417 Mio. (2005) Bevölkerungsdichte: 11,8 Einwohner pro qkm BIP/Einwohner: 12.510 US-Dollar (2004) Währung: Saudi-Rial Unabhängigkeit: 23.09.1932 Zeitzone: UTC+3 Währung: Saudi-Rial zurück Der "Saudi-Rial" (ISO-4217-Code: SAR; Abkürzung: SR) ist die Währung des Königreiches Saudi-Arabien. Ein Saudi-Rial ist in 20 Qurush und 100 Halala unterteilt. Der Rial hat eine feste Wechselkursbindung zum US-Dollar, nämlich 1 USD = 3,75 SAR. zurück Der "Saudukat" (auch: Schweinsdukat oder Eberdukat) ist eine der zahlreichen Jagdmünzen des Landgrafen Ludwigs VIII. (1739-1768) von Hessen-Darmstadt. zurück Alternative Bezeichnung für den Ebergulden. zurück Französisch für "lachsfarben" (dänisch: laksefarvet, englisch und spanisch: salmon, italienisch: salmone, niederländisch: zalmkleurig, portugiesisch: salmao). zurück Veraltete (englische) Bezeichnung von Niue. zurück Bartelomeo Savelli ist der eigentliche Name des unter "Sperandio" bekannten Medailleurs der Renaissance. zurück "Saving glut" (auch: "Savings glut") ist die englische Bezeichnung für Sparschwemme. zurück "Savings glut" (auch: "Saving glut") ist die englische Bezeichnung für Sparschwemme. zurück Italienischer Name von Savoyen. zurück Französischer Name von Savoyen. zurück Savoyen (französisch: Savoie, italienisch: Savoia) ist eine Landschaft, die sich heute im Wesentlichen auf die französischen Départements Haute-Savoie und Savoie verteilt. Savoyen liegt zwischen der Schweiz, Piemont und den Départements Isère sowie Ain. In keltischer Zeit wurde das Gebiet von den Allobrogern bewohnt. 121 v.Chr. unterwarfen es die Römer und vereinigten es mit Gallien, aus dem sie später die Provinz Alpes Graiae et Vallis Poeninae bildeten. Im Jahr 354 wird das Land als "Sapaudia" (keltisch für "Waldland") bezeichnet. 443 werden hier von den Römern die Burgunder angesiedelt, nachdem ihr Reich am Rhein von den Hunnen zerstört worden ist. 534 eroberten die Franken das Land. Im Jahr 838 kam die Sapaudia an Hochburgund, gehörte dann ab 934 zum Königreich Burgund und kam mit diesem 1032 zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. 1023 wurde das Land dem Erzbischof von Vienne gegeben. 1310/1313 wurde Savoyen zum Reichsfürstentum erhoben, 1349 ging die südlich gelegene Dauphiné an Frankreich, woraufhin Kaiser Karl IV. 1361 Savoyen vom alten Königreich Burgund (Arelat) ablöste und reichsunmittelbar sowie den Grafen 1365 zum Reichsvikar für Arelat machte. 1416 wurden die Grafen von Savoyen zu Herzögen erhoben. 1512/1521 wurde Savoyen schließlich formal in den Oberrheinischen Kreis aufgenommen. Da Franz der I. Savoyen 1536 im 3. Italienischen Krieg besetzte und das Stammland somit bis zum Zweiten Vertrag von Cateau-Cambrésis 1559 zur französischen Krone gehörte, verlegten die Herzöge ihre Hauptstadt von Chambéry nach Turin. Gleichzeitig (1534/36) gingen erhebliche Teile des Landes an die Schweiz verloren. Genf und Wallis an die Eidgenossen, Pays de Gex, Waadtland und Chablais an Bern, lediglich das Chablais kehrte 1564 (gegen Verzicht auf die anderen Gebiete) zurück. Am 17.01.1601 wurden die Gebiete im äußersten Westen (Bresse, Bugey, Valromey und Gex) mit dem Vertrag von Lyon an Frankreich abgetreten, 1631, am Ende des Mantuanischen Erbfolgekriegs, auch die Festung Pinerolo; im Gegenzug bekam Savoyen Teile der Markgrafschaft Montferrat zugesprochen. Im Frieden von Utrecht 1713 mußte Spanien dann Sizilien und Teile des Herzogtums Mailand an das Herrscherhaus von Savoyen abtreten, woraufhin der Herzog den Königstitel annahm. Sizilien wurde 1720 gegen Sardinien getauscht, das Herzogtum Savoyen mit Sardinien zum Königreich Sardinien vereinigt. 1738 wurden Novara und Tortona und 1748 weitere Gebiete erworben. Am 22.09.1792 rückten französische Revolutionstruppen ohne Kriegserklärung in das Gebiet ein. Zwischen 1796 und 1815 war Savoyen Teil Frankreichs und bildete zunächst das Département Mont-Blanc. 1798 wurde es in die Départements Mont-Blanc und Léman geteilt. 1801 schied das Land auch offiziell aus dem Reich aus. Nach dem Wiener Kongreß kam es zurück zum Königreich Sardinien. In der Folgezeit spielte Savoyen eine Rolle bei der italienischen Einigung und die Könige wurden zu Königen von Italien. zurück zurück zurück zurück ISO-4217-Code für den Salomonen-Dollar. zurück Abkürzung für "Sculpsit". zurück   "S C" ist die Abkürzung für "Senatus consulto" (deutsch: "auf Beschluß des Senats"), die vor allem auf den Rückseiten von römischen AE-Münzen der Römischen Kaiserzeit vorkommt. Die Abkürzung "S C" bedeutet, daß die betreffenden Münzen auf Anordnung des römischen Senats geprägt wurden, der bei den AE-Münzen bestimmte Rechte innehatte, während die Prägungen in Gold und Silber dem römischen Kaiser vorbehalten war. "S C" ist die Abkürzung für "Senatus consulto" (deutsch: "auf Beschluß des Senats"), die vor allem auf den Rückseiten von römischen AE-Münzen der Römischen Kaiserzeit vorkommt. Die Abkürzung "S C" bedeutet, daß die betreffenden Münzen auf Anordnung des römischen Senats geprägt wurden, der bei den AE-Münzen bestimmte Rechte innehatte, während die Prägungen in Gold und Silber dem römischen Kaiser vorbehalten war.zurück zurück Die von "scalpere" (deutsch: "ritzen", "gravieren") abgeleitete lateinische Bezeichnung steht für die römischen Gemmen- und Stempelschneider sowie die Münzgraveure. zurück Scarborough ist eine englische Stadt in der Grafschaft Yorkshire, die während der Bürgerkrieges 1644/45 belagert wurde. Man zerschnitt altes Silber und stempelte darauf die Ansicht von Scarborough Castle sowie den Wert. Es gab die Nominalen von 4 Pence bis 5 Shillings 8 Pence. zurück Englisch für "selten" (dänisch: sjaelden, englisch und französisch: rare, italienisch, portugiesisch und spanisch: raro, niederländisch: zeldzaam). zurück Italienisch für "scharlachrot" (dänisch: skarlagenrod, englisch: scarlet, französisch: écarlate, niederländisch: scharlaken, portugiesisch: escarlate, spanisch: escarlata). zurück Englisch für "scharlachrot" (dänisch: skarlagenrod, französisch: écarlate, italienisch: scarlatto, niederländisch: scharlaken, portugiesisch: escarlate, spanisch: escarlata). zurück Dies ist die Bezeichnung einer frühmittelalterlichen Münzsorte, die ursprünglich von den Angelsachsen seit der 2. Hälfte des 7. Jh. geschlagen wurde und von der sich das Wort "Schatz" ableitet. Es handelt sich um kleine silberne Münzen im Gewicht von 1 bis 1,5 g und im Durchmesser von ca. 10-13 mm), die stilistisch - trotz starker Abstrahierung - an spätrömische Vorbilder und keltische Münzen erinnern. Es gibt viele Typen und Varianten, die in England teilweise bestimmten Gebieten zugeteilt sind. Die "Sceattas" kamen durch Handel auch auf das europäische Festland und wurden von den Friesen und den Dänen nachgeprägt. Die Benennung der Typen orientiert sich meist daran, an welche gegenständliche Darstellung sie erinnern. Es finden sich Bezeichnungen wie Drachen-, Wolfs-, Porcupine (Stachelschwein)-, Wodan/ Monstertyp und ähnliche Bezeichnungen. Bei der Beschriftung der Stücke handelt es sich oft um Trugschriften oder verwilderte Aufschriften. Manchmal sind sie durch Runen ersetzt worden und werden als Runenmünzen bezeichnet. Im 8. Jh. entwickelte sich in England ein breiterer Pfennigtyp. Ausgenommen von dieser Entwicklung war das Königreich Northumbria, wo die Fabrikation der "Sceattas" weiterführt wurde, die dann im 9. Jh. in eine Kupferprägung überging (Styca). zurück Französisch für "Siegel" (englisch: seal, italienisch: timbro, portugiesisch: carimbo, spanisch: sello). zurück Der "Scellino" ist die Währungseinheit von Somalia seit 1962. Die Münzen wurden erst seit 1967 in Kupfer-Nickel geprägt. Goldene Mehrfachstücke wurden bereits zum 5. Jahrestag der Unabhängigkeit 1965 und 1966 geprägt. Die Bezeichnung ist von dem englischen Wort Shilling abgeleitet. Es gilt 1 Scellino Somali = 100 Centesimi. zurück zurück Länderkennzeichen für Montenegro. zurück Anton Schaeffer (geb. 1722; gest. 1799) war ein pfälzischer Medailleur und Stempelschneider, Sohn des Münzgraveurs Wiegand Schaeffer. Als Münzmeister der kurpfälzischen Münzstätte in Mannheim, die 1735 von Heidelberg nach Mannheim verlegt worden war, gestaltete Anton Schaeffer eine Reihe kurpfälzischer Münzen, wie beispielsweise die Rheingolddukaten von 1763 und 1764 und die Konventionstaler von 1766 und 1775. Zu seinem umfangreichen Medaillenwerk zählt eine 26 Exemplare umfassende Medaillensuite auf die pfalzgräflichen Ahnen, die Anton Schaeffer (Signatur meistens "A.S.") im Auftrag des Pfalzgrafen und Kurfürsten Karl IV. Philipp Theodor (1743-1799) schuf. zurück Alternative Schreibweise für Scherf. zurück Österreichisch für Stückelungsplus (englisch: Shere). zurück Im Auktionswesen vom Auktionator angesetzter Preis für ein einzelnes Los, der als Anhaltspunkt für die Abgabe von Geboten dienen soll. Er ist gleichzeitig der Mindestpreis, der überboten werden kann. zurück Dies ist die Bezeichnung des doppelten Stübers in Ostfriesland im 16. Jh., der wohl im beginnenden 16. Jh. ursprünglich 3 Stüber gegolten hat. Die Bezeichnung leitet sich vermutlich von einem burgundisch-niederländischen Silbermünztyp aus dem ausgehenden 15. Jh. ab, der aus den Niederlanden in den Umlauf Ostfrieslands gelangte und dort mit drei Stübern bewertet wurde. Dieser in Anlehnung an die Darstellung des burgundischen Ordens vom Goldenen Vlies, niederländisch als Zilveren Vliesen (deutsch: "Silbernes Vlies") oder französisch Toison d'argent genannte Typ ist wohl in Ostfriesland im Volksmund schon als "Schaf" bezeichnet worden. zurück Schaffhausen ist eine schweizerische Stadt und ein Kanton. Er hatte an der Seite der Schweizer schon im Bürgerkrieg geben die Burgunder von 1476 mitgefochten. 1333 pachtete die Stadt zunächst das Münzrecht vom Kloster Allerheiligen. 1424 wurde mit St. Gallen und Zürich ein Vertrag geschlossen zur Prägung gleichwertiger Münzen. Bis 1658 kamen größere und kleinere mit dem Reichsmünzfuß übereinstimmende Münzen im Umlauf. Danach war die Münzstätte lange außer Betrieb, bis ab 1808/09 nochmals Münzen zu einen 1/2 und 1 Batzen und zu 1 Kreuzer ausgeprägt. zurück Dies ist die volkstümliche Bezeichnung der Doppelschillinge des Wendischen Münzvereins des 16. Jh. im norddeutschen Raum nach dem rückseitigen Motiv, das Johannes den Täufer mit einem Schaf auf dem Arm zeigt. zurück Dies ist die persische Bezeichnung für König. Der Titel war auch schon für die Dynastie der Achämeniden und Sassaniden sowie für kleinere Dynastien gebräuchlich. Er bezeichnet auch die Herrscher der indischen Mogul-Dynastie. zurück Hierbei handelt es sich um einen Taler aus Zürich aus dem 18. Jh., der die Stadt am Limmat innerhalb ihrer neuen Schanzen (Befestigungen) zeigt, die im 17. Jh. erbaut wurden. Die Vorderseite zeigt zwei Löwen, die das Wappen halten. zurück  Anton Scharff (geb. 10.06.1845 in Wien; gest. 05.06.1903 in Brunn am Gebirge) war ein bedeutender österreichischer Medailleur, Münzgraveur und Stempelschneider, der an der Münzstätte in Wien tätig war. Sein Hauptwerk besteht aus einer Vielzahl Medaillen im Stil des Realismus, die sich durch die künstlerische Gestaltung ausdrucksvoller Porträts auszeichnen. Außerdem gravierte Scharff, der meist mit "A. SCHARFF" signierte, Münzen für Österreich und andere Länder, die ihre Münzen in Wien herstellen ließen. Dazu zählen der goldene persische Toman von 1879 mit dem Porträt des Schah Nasreddin, bulgarische und rumänische Silbermünzen aus den 90er Jahren des 19. Jh. sowie mehrere serbische Münzen. Anton Scharff (geb. 10.06.1845 in Wien; gest. 05.06.1903 in Brunn am Gebirge) war ein bedeutender österreichischer Medailleur, Münzgraveur und Stempelschneider, der an der Münzstätte in Wien tätig war. Sein Hauptwerk besteht aus einer Vielzahl Medaillen im Stil des Realismus, die sich durch die künstlerische Gestaltung ausdrucksvoller Porträts auszeichnen. Außerdem gravierte Scharff, der meist mit "A. SCHARFF" signierte, Münzen für Österreich und andere Länder, die ihre Münzen in Wien herstellen ließen. Dazu zählen der goldene persische Toman von 1879 mit dem Porträt des Schah Nasreddin, bulgarische und rumänische Silbermünzen aus den 90er Jahren des 19. Jh. sowie mehrere serbische Münzen.zurück Bei den "Scharfrichterpfennigen" handelt es sich nicht um Münzen, sondern Hamburger Medaillen aus Silber, die im Gewicht etwa einem doppelten Taler entsprechen. Nach einem alten Brauch übergaben die Hamburger Scharfrichter den aus dem Amt scheidenden Richtern der Stadt die Medaillen als eine Art Treue- oder Lehensgabe. Die Tradition der Ausgabe von Hamburger "Scharfrichterpfennigen" bestand seit 1541 und wurde bis 1810 gepflegt. zurück Kurzbezeichnung für "scharlachrot". zurück Die Farbe "scharlachrot" ist eine Farbe, die bei Banknoten vorkommt (dänisch: skarlagenrod, englisch: scarlet, französisch: écarlate, italienisch: scarlatto, niederländisch: scharlaken, portugiesisch: escarlate, spanisch: escarlata). zurück Niederländisch für "scharlachrot" (dänisch: skarlagenrod, englisch: scarlet, französisch: écarlate, italienisch: scarlatto, portugiesisch: escarlate, spanisch: escarlata). zurück In der Numismatik ist hier ein Münzschatzfund gemeint. zurück Das bundesdeutsche "Schatzregal" löste die alten Ausgrabungsgesetze ab. Es regelt, daß bestimmte Kulturfunde mit ihrer Entdeckung Eigentum des Landes werden. Wenn Privatpersonen auf einem ihnen gehörenden Gelände einen Fund machen, gilt dies aber nur, wenn die gefundenen Gegenstände einen "herausragenden wissenschaftlichen Wert" darstellen. zurück Die "Schautaler" gehören zu den Schaumünzen. zurück Die "Schaugroschen" gehören zu den Schaumünzen. zurück Die "Schaugulden" gehören zu den Schaumünzen. zurück  &&Schaumburg-Lippe&& war bis 1946 ein selbstständiges deutsches Land (Grafschaft, Fürstentum, Freistaat) im Gebiet des heutigen Niedersachsen, zwischen der Stadt Hannover und der westfälischen Grenze gelegen. Der Name bezieht sich auf die Schaumburg im Wesergebirge (heute: Rinteln) und die Grafen von Lippe, die 1647 aus einer Nebenlinie die Grafen der neu gebildeten Grafschaft lippischen Anteils stellten. Hauptstadt war Bückeburg. &&Schaumburg-Lippe&& war bis 1946 ein selbstständiges deutsches Land (Grafschaft, Fürstentum, Freistaat) im Gebiet des heutigen Niedersachsen, zwischen der Stadt Hannover und der westfälischen Grenze gelegen. Der Name bezieht sich auf die Schaumburg im Wesergebirge (heute: Rinteln) und die Grafen von Lippe, die 1647 aus einer Nebenlinie die Grafen der neu gebildeten Grafschaft lippischen Anteils stellten. Hauptstadt war Bückeburg.zurück Hierbei handelt es sich um Gelegenheitsmünzen und Gedenkprägungen, die sich durch niedrige Stückzahlen und ihre prächtige Gestaltung von den Umlaufmünzen abhoben, auch wenn die meisten alten "Schaumünzen" sich in Größe und Münzfuß nach den Umlaufmünzen richten. In der Regel fanden die Schautaler, Schaudukaten, Schaugulden, Schaugroschen und Schaupfennige keinen Eingang in den Umlauf, sondern wurden aufbewahrt und gingen in Münzsammlungen ein. Oftmals handelt es sich um Kunstmedaillen aus der Renaissance und dem Barock. zurück Die "Schaugulden" gehören zu den Schaumünzen. zurück Alternative Schreibweise von Shauri. zurück Die "Schautaler" gehören zu den Schaumünzen. zurück Ein "Scheck" ist ein Mittel des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, eine auf den Namen des Empfängers oder auf den Inhaber ausgestellte übertragbare schriftliche Anweisung an eine Bank zur Zahlung einer Geldsumme aus dem Guthaben des Ausstellers. Nach dem für Deutschland gültigen Scheckgesetz vom 14.08.1933 muß der "Scheck" als solcher gekennzeichnet sein, die Anweisung auf eine bestimmte Geldsumme lauten, die Angabe des Geldinstituts, Zeit und Ort der Ausstellung und die Unterschrift des Ausstellers enthalten. Bei den in Deutschland überwiegend vorkommenden Inhaberschecks wird keine bestimmte Person als Empfänger bezeichnet, sondern hier ist der Zusatz "oder Überbringer" vorgegeben. Man unterscheidet zwischen dem Verrechnungsscheck und dem Barscheck. Die Bezeichnung Scheck leitet sich von dem italienischen Wort "scacco" (deutsch: "Staatsschatz") ab, von dem auch der englische Ausdruck Exchequer bills abgeleitet ist. Der etymologische Ursprung deutet an, daß die Vorläufer der modernen schriftlichen Depotanweisungen früher meist für Zahlungen für die Staatsgewalt (oder andere öffentliche Gewalten) Verwendung fanden. Eine Bankanweisung aus privater Hand ist erstmals in Italien im ausgehenden 14. Jh. nachweisbar. Die Bankanweisung erlangt aber erst im 17. Jh. Bedeutung in Antwerpen und Amsterdam und verbreitete sich von dort aus nach England, damals noch "orders" oder "discharges" genannt. Die Funktion von "Scheck" und Banknoten begann sich im 18. Jh. zu trennen. In Großbritannien wurde der "Scheck" noch als Sonderform des Wechsels betrachtet und nicht gesondert geregelt. Nach der Peelschen Bankakte von 1844 waren die "Schecks" nicht von der Kontingentierung des Banknotenumlaufs betroffen und somit das einzige schnell und ausreichend zur Verfügung stehende Zahlungsmittel. Deshalb begannen die privaten Zettelbanken erfolgreich den Aufbau des Depositengeschäfts. Erstmals erwähnt wird der Scheck im "Bills of Exchange Act" von 1882, als er als Zahlungsmittel wesentlich bedeutender war als der Wechsel und die Banknote. Im ausgehenden 19. Jh. war England allen anderen Staaten bei der Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehr weit voraus. Die Rückständigkeit Kontinentaleuropas auf diesem Gebiet wurde durch staatliche Restriktionen begünstigt. Die wohl aus fiskalischen Überlegungen (staatliches Münzregal) hergeleiteten Vorbehalte gegen den bargeldlosen Zahlungsverkehr drückten sich in Deutschland und Frankreich auch in der hohen Besteuerung von Scheck und Wechsel aus. Ähnliche Gründe mögen auch die Entwicklung privater Notenbanken gehemmt haben. zurück   Hierbei handelt es sich um einen niederländischen silbernen Gulden (Schiffsgulden), der nach der Darstellung auf der Rückseite (Dreimaster) benannt ist. Die Vorderseite zeigt den bekrönten Löwenschild. Die Schiffsgulden und ihre Teilstücke (1/16, 1/8, 1/4 und 1/2) wurden 1802 im westfriesischen Enkhuisen (Münzzeichen: Stern) geprägt und sollten ursprünglich in die Kapkolonie gehen, die jedoch an Großbritannien verloren ging. Die "Scheepjesgulden" brachte man per Schiff nach Batavia (heute Jakarta) auf der Insel Java. Der "Scheepjesgulden" entspricht mit seinem Raugewicht von 10,616 g genau dem niederländischen Gulden. Sein Silbergehalt (916/1000) lag um vier Tausendstel unter dem vergleichbaren holländischen Stück. Hierbei handelt es sich um einen niederländischen silbernen Gulden (Schiffsgulden), der nach der Darstellung auf der Rückseite (Dreimaster) benannt ist. Die Vorderseite zeigt den bekrönten Löwenschild. Die Schiffsgulden und ihre Teilstücke (1/16, 1/8, 1/4 und 1/2) wurden 1802 im westfriesischen Enkhuisen (Münzzeichen: Stern) geprägt und sollten ursprünglich in die Kapkolonie gehen, die jedoch an Großbritannien verloren ging. Die "Scheepjesgulden" brachte man per Schiff nach Batavia (heute Jakarta) auf der Insel Java. Der "Scheepjesgulden" entspricht mit seinem Raugewicht von 10,616 g genau dem niederländischen Gulden. Sein Silbergehalt (916/1000) lag um vier Tausendstel unter dem vergleichbaren holländischen Stück.zurück Dies ist die Bezeichnung für einen niederländischen Schillingtyp zu 6 Stuiver, der nach der Darstellung eines Segelschiffs auf der Rückseite benannt ist. Die Vorderseiten zeigen die Wappenschilde der prägenden Provinzen Holland (1670-1793), Westfriesland (1673-1771) und Utrecht (1700-1794). Sie wurden im Gewicht von 4,95 g (583/1000 fein) ausgebracht. Die ersten westfriesischen Münzen (zwischen 1673 und 1679) stammen aus der privaten Münzstätte von Dirk Bosch aus Enkhuisen. Es gibt auch einen "Scheepjesschelling" in Klippenform (Westfriesland 1716) sowie eine ganze Reihe von Abschlägen in Gold (fast alle im Gewicht von 7 g), vor allem in den Provinzen Holland und Utrecht. Die als Huedjesschellinge bezeichneten Schillinge gleichen Gewichts zeigen zwischen 1750 und 1793 ein ähnliches Segelschiffmotiv auf den Rückseiten. zurück Franz Andreas Schega (geb. 16.11.1711 in Novo mesto/deutsch: Neustadt bei Laibach/Krain; gest. 04.12.1787 in München) war ein angesehener Medailleur und Stempelschneider des Rokoko, der seit 1738 in München tätig war und zahlreiche Münzen für Bayern und die Pfalz fertigte (Signatur meist "F. A. S."). Im Jahr 1751 wurde er zum Ersten Bayerischen Hofmedailleur ernannt und schuf eine Reihe von künstlerisch wertvollen Medaillen (Signatur meist "F. A. SCHEGA F."). zurück Hierbei handelt es sich um Kleinmünzen zum Ausgleich kleiner Wertdifferenzen zwischen Käufer und Verkäufer, also, um an einem Geschäft beteiligte Leute friedlich "zu scheiden", was bei groben Münzsorten wie Taler und Gulden nicht möglich war. Der Begriff "Schieds- oder Scheidemünze" bildete sich im 16. Jh., da mit dem Umlauf der Großsilbermünzen eine differenzierte Geldwirtschaft gefordert war. Die Prägung von "Scheidemünzen" war von Anfang an mit Problemen verbunden. Einerseits sollte sich ihr innerer Wert, wie bei den groben Sorten oder Währungsmünzen möglichst dem Nennwert annähern, um nicht mit einem Abschlag versehen zu werden oder gar die Verweigerung der Annahme zu riskieren. Andererseits kam die Ausprägung der kleinen Werte wegen des größeren Arbeitsaufwandes für die gleiche Summe Geldes wesentlich teuerer als die Ausprägung grober Münzen. Die "Scheidemünzen" wurden also ihres inneren Wertes beraubt und zuerst aus geringhaltigeren Silberlegierungen (Billon) und später vermehrt aus Kupfer geprägt. Außerdem waren die Prägezahlen und die Annahmebedingungen beschränkt. Im 18. Jh. ist auf den entsprechenden Münzen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation die Aufschrift "Scheidemünz" oder ähnliches aufgeprägt. Da bei den Reichsmünzordnungen des 16. Jh. der Münzfuß für die auszuprägenden Scheidemünzen zu hoch angesetzt war, prägten viele Münzstände entweder gar keine Scheidemünzen aus oder richteten ihre Prägung nicht nach der geltenden Reichsmünzordnung und gaben geringerhaltige Scheidemünzen aus. Diese Entwicklung führte zu den schlechten Scheidemünzen der Kipper- und Wipperzeit, die eine Münzkrise im ganzen Reich auslöste. Zwar kam es auch später im Reich gelegentlich noch zu Problemen), aber eine vergleichsweise katastrophale inflationäre Entwicklung wie bei den Kippermünzen blieb bis zur Inflation im Jahre 1923 aus. Ähnliche Probleme gab es auch in Italien, während im 17. Jh. zu große Mengen an Kupferprägungen in Spanien (Inflation der Vellonmünzen) und Polen (Achtzehngröscher) wirtschaftlichen Schaden anrichteten. In Großbritannien prägte man zu geringe Mengen an Scheidemünzen, was zur Ausgabe privater Token führte. Mit der Einführung der Goldwährungen im 19. Jh. änderten sich die Verhältnisse. Mit Ausnahme der Goldmünzen waren alle Münzen der Währung des Deutschen Reiches Scheidemünzen, auch wenn sie nicht so genannt wurden. Die Annahmepflicht dieser Münzen wurde begrenzt, um die Bevölkerung vor finanziellen Nachteilen zu schützen. Heute ist das bedeutungslos geworden, da die Währungen auf anderen Grundlagen beruhen. Jede ausgeprägte Kursmünze ist praktisch eine Scheidemünze und sogar der kupferne Pfennig hat einen höheren inneren Wert (Metallwert) als das Papiergeld (zu weit höheren Nennwerten), das nur ein Kreditgeld ist. zurück Mit "Scheiden" ist das Trennen von Metall aus Erzen und Legierungen durch Amalgamation, Elektrolyse und andere Verfahren gemeint. zurück Dies ist die Bezeichnung der Salpetersäure (HNO 3) in einer Konzentration von 50 bis 55 Prozent, die früher in Münzstätten zur Scheidung von Silber und Kupfer aus Goldlegierungen und zur Feingehaltsbestimmungen von Goldmünzen verwendet wurde. Diese Lösung greift Gold (und Platin) nicht an, löst aber Silber und Kupfer aus der Goldlegierung heraus und bildet mit diesen Nitratsalze. zurück Hierbei handelt es sich um ein angebliches Verkaufsangebot, das jedoch nur zum Testen der Aufnahmefähigkeit des Marktes, des Umfangs des Interessentenkreises und zur Einschätzung der Preislage abgegeben wird. zurück Hierbei handelt es sich um ein zur Irreführung abgegebenes Gebot, um den Zuschlag auf Auktionen in die Höhe zu treiben. zurück Der "Schekel" (ISO-4217-Code: ILS; Abkürzung: NIS) ist die Währung von Israel seit 1980. Es gelten 100 Agorot = 1 Israelisches Pfund ab 1960, seit 1980 100 Neue Agorot = 1 Schekel. Das Wort "Schekel" (auch: Shekel oder Shegel; Mehrzahl: Shekalim oder Shegalim) leitet sich in den alten semitischen Sprachen von der Bezeichnung für "Wiegen" ab. Ursprünglich war der "Schekel" ein altorientalisches Gewicht (nachweisbar in Babylon und Kanaan), wobei 60 Schekel auf eine Mine gingen, die allerdings lokal im Gewicht verschieden war. Da die Mine im einfachen (leichte Mine) und doppelten Betrag (schwere Mine) unter dem gleichen Namen vorkommt, erklären sich so auch die unterschiedlichen Bezeichnungen der Münzwerte (je nachdem, welche Gewichte zu Grunde gelegt werden). Die Bezeichnung "Schekel" kommt schon im Alten Testament als Recheneinheit des jüdischen Volkes vor. Der Schekel wird griechisch als Siglos bezeichnet. Die Silbermünzen einiger phönizischer Handelsstädte vom späten 5. Jh. wurden bis zur Eroberung durch Alexander den Großen (um 332 v.Chr.) als Dischekel (doppelte Schekel) und "Schekel" bezeichnet. In Sidon wurden etwa seit 425 n.Chr. Silbermünzen nach dem Schekelfuß gemünzt. Von der gemeinhin als Dischekel bezeichneten Silbermünze im Gewicht von 25,75 bis 28,4 g bis zu Teilstücken (1/16-Schekel) im Gewicht von 0,6 bis 0,8 g. Die Vorderseiten zeigen meist eine Kriegsgaleere und die Rückseiten eine bärtige Gottheit im Streitwagen (mit und ohne eine königliche Gestalt dahinter) oder eine bärtige Gestalt (Gottheit oder Heros), die einen Löwen tötet. Sie wurden zuletzt unter dem persischen Satrapen Mazaios (345-335 v.Chr.) geprägt. Die ersten jüdischen Schekel wurden als Silbermünzen im Gewicht zwischen 13,5 und 14,5 g während des 1. jüdischen Aufstands gegen Rom (66-70 n.Chr.) ausgemünzt. Ihrer charakteristischen Form wegen - dicker Schrötling mit nach außen gewölbtem Rand - werden sie auch als "dicke Schekel" bezeichnet. Ihre Vorderseiten zeigen einen Kelch, die Rückseiten einen Zweig des Granatapfels. Es gab auch Halbstücke und Bronzemünzen, die heute als Viertel-Schekel gedeutet werden. Eine zweite Aufgabe erfolgte während des 2. jüdischen Aufstands (132-135 n. Chr.) unter Simon Bar Kochba. Sie zeigen auf den Vorderseiten den viersäuligen Tempel mit Heiligtum, auf den Rückseiten Lulav (Zweigbündel) mit dem Ethrog. zurück Vom sog. "dicken" Schekel des ersten jüdischen Aufstandes 66-70 n.Chr. gab es schon sehr früh Fälschungen, da man sie der Epoche des Simon Makkabäus zuordnete und glaubte, daß dies die "Silberlinge" des Neuen Testaments wären. Sie wurden vom Anfang des 19. Jh. bis heute hergestellt. Man erkennt sie an der Schrift und anderen Herstellungsmerkmalen. Meist haben sie auch ein anderes Gewicht und eine andere Legierung. zurück Bei den "Schekelmedaillen" handelt es sich um einfache Nachahmungen der Schekel zur Zeit des ersten jüdischen Aufstandes 66-70 n.Chr., da man diese ursprünglich für das Silbergeld des alten jüdischen Königreiches aus der Zeit des Simon Makkabäus hielt und glaubte, daß es diese Münzen auch zu Lebzeiten Christi in Jerusalem gegeben hätte. Sie wurden deshalb auch als die "Silberlinge" des Judas Ischariot angesehen. Erste Nachahmungen gab es schon im 16. Jh., die meist nicht geprägt, sondern gegossen waren und in Stil, Schrift und Form von den Originalen abwichen. Im 18. Jh. waren sie meist aus Blei oder Zinn. Große Mengen wurden zum Ende des 19. Jh. hergestellt. zurück Niederländisch für Schilling. zurück Als "Scherf" (auch: Schärf, Skärf, Hälbling, Helling) wird das Halbstück des mittelalterlichen Pfennigs bezeichnet. Erst als sich im 14. Jh. der Heller (Haller) als Halbpfennig durchsetzte, wurde die Bezeichnung zurückgedrängt. zurück Nach dem Weißsieden wurden die Münzen früher gescheuert, um sie zu polieren. Bei wertvollen Gold- und Silbermünzen geschah dies per Hand durch eine Mischung aus Kohlenstaub und Wasser, später benutzte man Sägespäne und pulverisierten Weinstein. Münzen aus minderen Materialien wurden in Rollfässern gescheuert. zurück Alternative Bezeichnung für Scheidemünzen. zurück Bezeichnung für "geneigt", "nicht gerade", bzw. "krumm" (dänisch: skrâ, englisch: oblique bzw. slanting, französisch: oblique bzw. incliné, italienisch und portugiesisch: obliquo, niederländisch: schuin, spanisch: oblicuo). zurück Die Farbe "schiefer" ist eine Farbe, die bei Banknoten eigentlich recht selten vorkommt (dänisch: skiffer, englisch: slate, französisch: arboise, italienisch: ardesia, niederländisch: leisteenkleurig, portugiesisch: ardósia, spanisch: pizarra). zurück Alternative Bezeichnung für Schützenmedaille. zurück Alternative Bezeichnung für Schützenmedaille. zurück Münzen mit Schiffsmotiven erfreuen sich bei den Sammlern in aller Welt seit Jahrzehnten größter Beliebtheit und sind somit ein wichtiges Sammelgebiet in der Numismatik. Schon auf frühen antiken Münzen sind Galeeren dargestellt, vor allem auf Münzen des phönizischen Seefahrervolkes (in Arados, Byblos, Sidon) seit dem späten 5. Jh. v.Chr. So zeigen die etwa seit 425 v.Chr. geschlagenen Schekel der Stadt Sidon eine Kriegsgaleere unter vollem Segel auf Wellen, der im späten 5. Jh. folgende Typ eine Galeere vor der Stadtmauer. Die Prora (Bug des Schiffes) erscheint schon im späten 6./frühen 5 Jh. auf Silbermünzen der Stadt Phaselis in Lykien (im Südwesten Kleinasiens). Die Prora ist ein häufig dargestelltes Motiv auf römischen Münzen und erscheint von Anfang an auf dem Aes grave der Römischen Republik. Unter dem Flottenpräfekten Antonius wird Anzahl der Schiffe (3, 2 und 1) und die Prora zum Unterscheidungsmerkmal und dient der Wertabstufung der AE-Münzen. Prora- und Schiffsdarstellungen im Zusammenhang mit Getreidelieferung, Reisen der Kaiser erscheinen auf römischen Münzen bis in die späte Römischen Kaiserzeit. Das Schiffshinterteil (lateinisch: "puppis") findet sich vor allem auf Münzen der Makedonen. Im Mittelalter sind Schiffe auf karolingischen Denaren von Dorestad und auf einigen Nachahmungen in Schweden (Hedeby-Münzen) dargestellt. Auch auf dem goldenen englischen Nobel und seinen niederländischen Nachahmungen ist aus Anlaß des Seesiegs von Sluys (1340 n.Chr.) über die Franzosen das Hüftbild des siegreichen Königs Edward III. in einem Schiff dargestellt. Mit dem Aufkommen der Medaille in der Renaissance kommen Schiffe oder Darstellungen mit nautischem Bezug auch auf Medaillen häufig vor. Zu den ersten Medaillen mit nautischem Bezug zählt eine für Papst Sixtus IV. 1454 hergestellte Medaille, die den Papst in einem Nachen zeigt, der lateinisch als "Eclesia" (deutsch: "Kirche") bezeichnet ist. Im 17. Jh. sind zu Ehren der Admirale Ruyter und Tromp niederländische Medaillen geprägt worden. Im 17. und 18. Jh. erscheint in den Niederlanden ein Typ von Schillingen zu 6 Stuiver, der nach dem Segelschiff-Motiv auf der Rückseite als Scheepjesschelling bezeichnet wird. Die von Herzog August dem Jüngeren von Braunschweig-Wolfenbüttel (1635-1666) ausgegebenen Talermünzen mit Schiffsmotiven werden Reise- oder Schiffstaler genannt. Ein Typ der Nürnberger Rechenpfennige wird nach seiner Darstellung als Schiffspfennig bezeichnet. In jüngerer Zeit erscheinen viele Münzen mit Schiffsmotiven, vor allem von den Inselstaaten in der Karibik. Ihre Schiffsdarstellungen gedenken oft Schiffen und Entdecker aus Spanien, Portugal oder England. Berühmte Schiffe wie die Nina, Pinta und Santa Maria (die drei Schiffe der 1. Entdeckungsreise des Christoph Kolumbus) oder die Bounty sind auf Münzen oft dargestellt worden. zurück Als "Schiffsgeld" werden die roh geprägten spanisch-amerikanischen Silbermünzen in Werten von 1 bis 8 Reales bezeichnet, die Acht-Reales-Stuecke dieser groben Machart wurden Schiffspesos oder -piaster genannt. Auf Grund der schlechten Gepräge und der nur unvollkommen runden Formen nahm man an, daß die Stücke in aller Eile während der Überfahrt von den spanischen Kolonien Süd- und Mittelamerikas nach Spanien geschlagen wurden. Tatsächlich war aber das Verbot, in den spanischen Kolonien ungeprägtes Silber zu besitzen, der Grund dafür, daß das Bergsilber in schlecht ausgestatteten Münzstätten grob geprägt und dann nach Europa verschifft wurde. Vielleicht hat die Bezeichnung auch damit zu tun, daß man auf gestrandeten oder gesunkenen Schiffen Münzen dieser Machart fand, die englisch als "Cob", spanisch als "Macuqina" bezeichnet werden. zurück Deutsche Bezeichnung für den niederländischen Scheepjesgulden, der einen Dreimaster zeigt. zurück Beim &&"Schiffsnobel"&& handelt es sich um einen englischen Nobel mit Schiffsmotiven. zurück Die Acht-Reales-Stuecke (siehe auch: Schiffsgeld) in ihrer gröbsten Machart wurden "Schiffspesos" (auch: Schiffspiaster) genannt. zurück Ein Typ der Nürnberger Rechenpfennige wird nach seiner Darstellung eines Schiffes als "Schiffspfennig" bezeichnet. zurück Alternative Bezeichnung für Schiffspeso. zurück Alternative deutsche Bezeichnung für Rostralkrone. zurück Als "Schiffstaler" (auch: Reisetaler) werden die von Herzog August dem Jüngeren von Braunschweig-Wolfenbüttel (1635-1666) undatierten Talermünzen genannt, die auf den Rückseiten Schiffsmotive zeigen. Sie zeigen in verschiedenen Varianten entweder zwei Schiffe oder einen Dreimaster. Auf allen Stücken steht rechts unten am Ufer ein Mann. In der Umschrift der Wahlspruch des Herzogs "ALLES MIT BEDACHT" und "ALEA EST IACTA" (deutsch: "Der Würfel ist gefallen"). zurück Der "Schild" ist eine wichtige Schutzwaffe, die schon lange vor Entstehen der mittelalterlichen Heraldik zum Symbol seines Trägers wurde. Der auf den Vorderseiten der Gepräge aus Böotien (z. B. Theben, Akraiphia, Haliartos, Koroneia, Mykalessos, Orchomenos, Pharai und Tanagra) schon in archaischer und klassischer Zeit sehr einheitlich dargestellte Ovalschild mit zwei seitlichen Einbuchtungen wurde praktisch zum Wahrzeichen der nördlich von Attika gelegenen griechischen Landschaft Böotien. Auch auf makedonischen und römischen Münzen kommen runde Schildformen vor, die meist in Verbindung mit Gottheiten (z. B. Diana und Pan) oder Trophäen dargestellt sind. Auf einigen Münzen aus der Zeit des Augustus findet man den großen goldenen Rundschild, den der Senat Augustus für seine Tugenden verlieh, mit der Aufschrift "S.P.Q.R. CL. V." (abgekürzt für "Senatus Populusque Romanorum Clipeus Virtutis"; deutsch: "Tugendschild des Senates und Volkes von Rom"). Im Mittelalter entwickelten sich mit dem Aufkommen der Heraldik die Wappenschilde. Sie erscheinen auf vielen Münzen, vor allem seit dem Spätmittelalter. Die seit 1266 geprägte französische Goldmünze ist nach der Darstellung des charakteristischen Lilienschildes deshalb auch Ecu d'or (deutsch: "goldener Schild") benannt. Auf neuzeitlichen Münzen gibt es neben die Wappen- und Landesschilden auch Schildhalter. zurück Der "Schildgroschen" ist ein Typ des Meißner Groschens, bei dem zum ursprünglichen Typ auf beiden Seiten der Landsberger Pfahlschild tritt, weshalb auch als Landsberger Groschen bezeichnet wird. Auf der Vorderseite ist der Schild in der Umschrift zu sehen, teilweise mit einem kleinen Löwen darüber. Auf der Rückseite befindet er sich im Münzfeld, links neben dem Löwen. Der Schildgroschen wurde erstmals unter den Markgrafen Friedrich IV. und Wilhelm II. sowie dem Landgrafen Friedrich dem Einfältigen von Thüringen zwischen 1409 und 1425 geprägt. Auch die Bezeichnung "schildige Groschen" ist gebräuchlich und bezieht sich auf die typähnlichen hessischen "Schildgroschen", die unter Landgraf Ludwig I. von Hessen (1413-1458) geschlagen wurden Sie tragen statt des Landsberger Pfahlschildes den hessischen Löwenschild. Auf den Gulden gingen zunächst 20 Schildgroschen, aber nach 1442 schwankte der Wert zwischen 24 und 26 Schildgroschen, je nach Wertrelation des Silbers zum Gold. zurück Hierbei handelt es sich um heraldische Figuren, die bei der Wappendarstellung den Schild halten oder bewachen. Sie kommen u.a. in Gestalt von Wilden Männern (in Brandenburg und Braunschweig), Wildem Mann und Wilder Frau (Schwarzburg), Engeln (Sachsen), Hirsch und Löwe (Württemberg), Löwe und Greif (Köln), Greifen (Brandenburg-Bayreuth und Baden) und Basilisken (Basel) seit dem 15./16. Jh. auf Münzen vor. Das Auftreten der "Schildhalter" steht oft in Zusammenhang mit dem Wappen oder der Geschichte der jeweiligen Stadt bzw. des Landes. zurück Alternative Bezeichnung für Schildgroschen. zurück 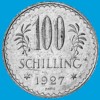  "Schilling" ist eine häufige Bezeichnung für Münzen, die zu verschiedenen Zeiten zu verschiedenen Gewichten, Werten, Gestaltungen und Materialien ausgebracht wurden. Ihr gemeinsamer Ursprung wurzelt in Bezeichnungen, wie "Skullinger", "Skilligs" und "Scilling" o.ä., die germanische Völker zur Völkerwanderungszeit vermutlich für den byzantinischen Solidus bzw. für seine Nachahmungen verwendeten. Spätere "Schillinge" tragen auch offiziell als lateinische Bezeichnung den Namen "Solidus". "Schilling" ist eine häufige Bezeichnung für Münzen, die zu verschiedenen Zeiten zu verschiedenen Gewichten, Werten, Gestaltungen und Materialien ausgebracht wurden. Ihr gemeinsamer Ursprung wurzelt in Bezeichnungen, wie "Skullinger", "Skilligs" und "Scilling" o.ä., die germanische Völker zur Völkerwanderungszeit vermutlich für den byzantinischen Solidus bzw. für seine Nachahmungen verwendeten. Spätere "Schillinge" tragen auch offiziell als lateinische Bezeichnung den Namen "Solidus".Das unter Karl dem Großen als Gewichtseinheit eingeführte Karlspfund wurde in 20 Schillinge (Solidi) zu je 12 Pfennige (Denarii) eingeteilt. Aus dem Karlspfund wurden demnach 240 Pfennige geprägt. Der Schilling wurde nicht ausgeprägt, sondern bestand nur als Zähl- oder Recheneinheit zu 12 Pfennigen. Zum ersten Mal ausgeprägt wurde das 12-Pfennig-Stück in Form des französischen Gros tournois, als im 13. Jh. der aufstrebende Handel eine größere Nominale als den Pfennig benötigte. Diese Groschenmünzen, die auch in Deutschland als Handelsmünzen dienten, und ihre Nachahmungen (Turnosen oder Turnosengroschen) wurden zum Ausgangspunkt der Groschenprägung in Deutschland und Europa (nördlich der Alpen). Im Rheinland wurden die Nachfolgemünzen aus Billon nach ihrer Farbe als Weißpfennig oder Albus bezeichnet. Im Ostseeraum, in Preußen, dem Gebiet des Wendischen Münzvereins und in süddeutschen Gebieten (Franken und Schwaben) wurden die Münzen nach ihrem Wert "Schillinge" genannt. Eine der ältesten als "Schilling" bezeichnete Münze wurde unter Hochmeister Winrich von Kniprode (1351-1382) im Gebiet des Deutschen Ritterordens im Gewicht von etwa 1,67 g (ca. 1,39 Silbergewicht) geschlagen. Die Ordensschillinge verschlechterten sich aber bald zu Billonmünzen und hielten im ausgehenden 15. Jh. (bei einem Raugewicht von ca. 1,32 g) nur noch ca. 0,24 g Silber. Ihr Münzbild wurde weitgehend unverändert beibehalten und zeigt den Wappenschild des Hochmeisters und den Ordensschild. Nach diesem Vorbild ließen die Bischöfe und der Ordensmeister in Livland ähnliche Schillinge prägen. In Pommern begann die Prägung von Schillingen unter Bogislaus IX. (1418-1446). Im polnisch-baltisch-preußischen Raum waren die Schillinge (im Wert von 1/3 Groschen) im 16. Jh. zeitweise die kleinste Münze, da dort wenige Pfennigmünzen (Denare und Ternare) geprägt wurden. In der Mitte des 17. Jh. wurden die polnischen und baltischen Schillinge zu Kupfermünzen (Boratinki). Die preußischen Schillinge blieben kleine Billonmünzen. Im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jh. wurden auch die Schillinge von Preußen und Posen aus Kupfer geschlagen. Um 1432 begannen die vier im Wendischen Münzverein zusammengeschlossenen Städte Lübeck, Hamburg, Wismar und Lüneburg regelmäßig nach gemeinsamem Fuß Schillinge zu prägen. Anfangs lag ihr Gewicht bei ca. 2,54 g und ihre Stempel (meist Stadtwappen/Kreuz) wurden in Lübeck hergestellt. Im späten 15. Jh. begann auch die Ausgabe von Doppelschillingen als Gemeinschaftsprägung des Wendischen Münzvereins, an der sich auch umliegende Münzstände beteiligten. Die Lübecker Schillinge wurden bis ins ausgehende 18. Jh., die Hamburger Schillinge (1/32-Taler) bis 1855 und die mecklenburgischen Schillinge (1/48-Taler) sogar bis 1866 (beide zuletzt in Berlin) geprägt. In Süddeutschland, vor allem im fränkischen und schwäbischen Raum, entstanden seit dem ausgehenden 14. Jh. und im beginnenden 15. Jh. Schillinge von verschiedenem Gewicht und Gepräge. Je nach Vereinbarung beteiligten sich verschiedene Münzstände an der Schillingprägung. Im fränkischen Raum waren vor allem Nürnberg, die Bischöfe von Bamberg und Würzburg, Brandenburg und die Pfalzgrafen an der Prägung beteiligt. An der ersten spätmittelalterlichen Schillingprägung in Schwaben nahmen Herzog Leopold von Österreich, die Grafen von Württemberg und Oettingen, der Bischof von Augsburg, die Reichstände von Ulm, Eßlingen und Schwäbisch Gmünd teil. In Württemberg wurden Schillinge bis in die Kipper- und Wipperzeit, im Bistum Würzburg bis zur Säkularisation geschlagen. In Westfalen hatten die Schillinge von Dortmund, Minden, Münster, Osnabrück und Paderborn ebenfalls verschiedene Gewichte und Werte. In Osnabrück wurden zuletzt 1628-1633 kupferne Schillinge zu 12 Pfennigen geschlagen. In den Niederlanden waren die ersten Schillinge unter der Bezeichnung Snapphaan oder Schnapphahn bekannt. Es folgten Schillinge zu 6 Stuiver wie Arendschelling, Hoedjesschelling, Rijder- oder Staatenschelling, Roosschelling und der Scheepjesschelling. Den englischen Schilling gab es unter der Bezeichnung Shilling und den skandinavischen unter Skilling. In Österreich wurde die Schillingwährung im Jahre 1925 eingeführt, die die Kronenwährung ablöste. Es galt 1 Schilling = 100 Groschen. Die erste Prägephase endete mit der Eingliederung Österreichs in das sog. Dritte Reich im Jahre 1938. Die 2. österreichische Republik nahm die Schillingwährung 1945 wieder auf. Die vielen österreichischen Gedenkmünzen in Schillingwerten machten den Schilling bei Sammlern weltweit bekannt. zurück In Holstein gebräuchliche Bezeichnung für den dänischen Skilling Courant. zurück Alternative Bezeichnung für den lübischen Schilling. zurück zurück Unter "Schillingwährung" versteht man ein Währungssystem, bei dem der Schilling die maßgebende Währungseinheit ist. zurück Die Bezeichnung "Schinderlinge" steht für die schlechten spätmittelalterlichen Pfennige, die 1457 bis 1460 im österreichischen und süddeutschen Raum geprägt wurden und mit der ersten großen monetär bedingten Inflation der deutschen Geldgeschichte verbunden sind. Der Grund für diese Entwicklung liegt in der Edelmetallknappheit und im Gewinnstreben der Münzherren. Der Wiener Pfennig war in der ersten Hälfte des 15. Jh. in Österreich und Bayern, das 1395 den Münzfuß des Wiener Pfennigs übernommen hatte, eine wichtige Umlaufmünze. Es kamen aber Klagen auf, daß die Ingolstädter, Münchener, Landshuter, Augsburger und Oettinger Pfennige um 1/5 schlechter seien als die Wiener Pfennige. Im Jahr 1457 begann der Graf von Oettingen unterwertige Pfennige in größeren Stückzahlen zu prägen. Der Erzbischof von Salzburg, der Bischof von Passau und die Landgrafen von Hals schlossen sich der Prägung von "bösen Schwarzpfennigen" (Böse Halser) an. Kaiser Friedrich III., der durch den Erbstreit mit seinem Bruder, Erzherzog Albrecht, in Geldverlegenheit geriet, verpachtete seinen Gläubigern und Kämmerern noch Ende 1457 das Münzrecht, die nicht zögerten, in Wien, Wiener Neustadt, Graz, St. Veit und wohl auch in Laibach (Ljubljana) große Mengen verschlechterter Pfennige und auch Kreuzer herzustellen. Sie scheuten nicht davor zurück, die Münzbilder des längst verstorbenen Königs Albrecht zu verwenden, um die minderwertigen Geldstücke leichter in Umlauf bringen zu können. Sein Bruder und Kontrahent, Erzherzog Albrecht, ließ in den neu errichteten Münzstätten in Linz und Enns minderwertige Stücke ausprägen. Schließlich beteiligten sich auch die Herzöge Albert (seit 1460 auch Johann und Sigmund) zu Bayern-München, Ludwig zu Bayern-Landshut, der Pfalzgraf Otto in Neumarkt und Graf Johann zu Görz an der Prägung der "bösen Schwarzpfennige", die schließlich 1460 mancherorts nur noch aus Kupfer bestanden und vom Volk "Schinderlinge" genannt wurden. Bis 1458 hielt sich die Verschlechterung der Pfennige noch einigermaßen im Rahmen des Erträglichen. Um 1455 gingen in Wien noch 240 Pfennige auf den ungarischen Goldgulden, Ende 1458 waren es 300 Pfennige. Aber 1459 und vor allem 1460 erreichte die Geldentwertung dramatische Ausmaße: Ende 1459 lag der Kurs des ungarischen Goldguldens in Wien bei 960 Pfennigen und am 17.04.1460 bei 3686 Pfennigen. Dies hatte rasante Preissteigerungen zur Folge. Im Mittelalter waren für Preissteigerungen allenfalls Mißernten und andere nicht-monetäre Ereignisse verantwortlich. Bis zur Zeit der Schinderlinge hatte sich der Silbergehalt eines Pfennigs im Lauf eines Menschenlebens höchstens auf die Hälfte verringert und selbst dies kannte man nur von anderen Währungsgebieten, denn der Wiener Pfennig war seit dem 13. eine äußerst stabile Münze gewesen und hatte sich über die Grenzen Österreichs hinaus größter Beliebtheit erfreut. Nun aber zeigten sich täglich spürbare Münzverschlechterungen verantwortlich für immense Preissteigerungen. Schließlich wollte niemand mehr die kupfernen Pfennige annehmen, der Handel stockte und die Bevölkerung verarmte. Wer hingegen noch gute (alte) Pfennige oder Prager Groschen besaß, konnte sich dafür alles kaufen. Als man am 28.04.1460 in Wien die Münzprägung wieder an die Wiener Hausgenossenschaft übertrug, die sich nicht an der Prägung der Schinderlinge beteiligt hatten, setzte eine Geldstabilisierung ein. Mit Unterstützung des reichen Wiener Kaufmanns Wilhelm Teschler ging die Hausgenossenschaft zur Prägung silberner Pfennige (300/1000 fein) über, die den Wiener Kreuzschild zwischen den Buchstaben "W(iener) H(ausgenossen) T(eschler)" trugen. Auch andernorts stellte man die Prägung der Schinderlinge ein. Aber der Pfennig hatte durch die Schinderlinge seinen Kredit als Währungsmünze für immer verloren. Größere Nominale traten an seine Stelle und der Pfennig wurde zur Klein- und Scheidemünze. zurück "Schlägel und Eisen" sind die Wahrzeichen des Bergbaus und werden aus sich kreuzenden Schlägeln oder Hämmern und einem Spitzmeißel gebildet. Das Zeichen erscheint auf den meisten Ausbeutemünzen. auf dem Kopf stehend bedeutet es, daß die Grube stillgelegt ist. Ähnlich sieht auch das Münzzeichen der norwegischen Münzstätte in Kongsberg aus, das durch ein sich mit einem Hammer kreuzenden Schlägel gebildet wird. zurück Schlesisch für Schlesien. zurück Dies ist eine spöttische Bezeichnung für den sehr seltenen sächsischen Konventionstaler von 1816, der auf der Vorderseite das Brustbild des Königs Friedrich August I. (1763-1827, seit 1806 König) von Sachsen in sehr weitem Uniformrock (ohne Epauletten) zeigt. Die Rückseite zeigt einen gekrönten, mit einer Lorbeergirlande behängten ovalen Wappenschild zwischen gekreuzten Palmzweigen. zurück Der "Schlagschatz" ist der Reingewinn, den der Münzherr oder die Regierung mit der Münzprägung macht. Der "Schlagschatz" einer Prägung ergibt sich, wenn man von der Summe ihres Nennwert den Metallwert und die Kosten, die durch ihre Herstellung entstehen (u.a. Prägekosten, Herstellungskosten der Stempel, Transportkosten) abzieht. Der Schlagschatz fiel bei den verschiedenen Münzsorten unterschiedlich aus. Bei Hauptwährungsmünzen war der Schlagschatz immer knapper bemessen, um die Währung nicht zu gefährden. Bei Klein-, Scheide- oder Landmünzen, die aus Legierung mit geringerem Edelmetallgehalt geprägt wurden, könnte man auf den ersten Blick einen höheren Gewinn erwarten. Aber oftmals wurden die Gewinnerwartungen, zumindest teilweise, durch höhere Prägekosten zunichte gemacht, denn bei den Kleinmünzen war der Arbeitsaufwand zur Herstellung einer bestimmten Summe Geldes relativ hoch. So mußte beispielsweise eine preußische Münzstätte in der 2. Hälfte des 18. Jh. 288 Pfennige oder 24 Gute Groschen herstellen, um auf dieselbe Summe zu kommen, die mit der Prägung eines Talers schon erreicht war. Der Schlagschatz lag in Friedenszeiten in der Regel zwischen 0,25 und 2,5 Prozent, konnte sich aber in Kriegs- und Notzeiten steigern. Zur Zeit der Schinderlinge und zur Kipper- und Wipperzeit stieg der Schlagschatz gewissenloser Münzenhersteller auf über 50 Prozent. Französisch wird der Schlagschatz als Seigneuriage, englisch als Seignorage und italienisch als Signoraggio bezeichnet. zurück "Schlagstempel" sind Stempel aus Werkzeugstahl, mit denen einzelne Buchstaben und Zahlen mit Hilfe eines Hammers in Werkstoffe eingeprägt werden können. zurück Alternative Bezeichnung für Klippwerk. zurück &&Schlesien&& (schlesisch: Schläsing; slowakisch: Slunsk; polnisch: Slask; tschechisch: Slezsko; lateinisch und englisch: Silesia; französisch: Silesie) ist eine Region in Mitteleuropa beiderseits des Ober- und Mittellaufs der Oder. Schlesien gehörte zunächst zum Großmährischen Reich, wurde dann von dem deutschen Kaiser eingesetzten Herzog Boleslav II. aus Böhmen regiert. Als dieser jedoch Meißen besetzt hielt, zogen thüringisch-sächsische Truppen des Kaisers Otto III. zusammen mit Mieszko, dem ersten Herzog der Polanen, 986 (987, 989, 990) gegen Böhmen. Daraufhin wurde Mieszko I., der ebenfalls Lehnsmann des Kaisers war, für seine Hilfe als Herzog Schlesiens eingesetzt. 1161 teilte der Kaiser das Herzogtum Schlesien auf in Ober- und Niederschlesien. Mit dem Anschluß an die Krone von Böhmen 1348 wurde Schlesien Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Kulturell waren die Verbindungen nach Westen ausgeprägter als es der politischen Bindung an Böhmen bzw. Österreich entsprochen hätte. Von 1740/45 (Schlesische Kriege Friedrichs II.) bis 1945 gehörte der größte Teil Schlesiens zum Königreich Preußen und damit von 1871 bis 1945 zum Deutschen Reich. Seit 1945 gehört Schlesien größtenteils faktisch zu Polen und seit dem Deutsch-Polnischen Grenzvertrag auch völkerrechtlich. Ein kleiner Teil des südlichen Schlesiens, die Region Tschechisch-Schlesien (früher Österreichisch-Schlesien), gehört zu Tschechien und ein weiterer Teil der ehemaligen preußischen Provinz Schlesien liegt heute im Freistaat Sachsen, dieses Gebiet gehört jedoch historisch ebenfalls zur Oberlausitz und wird heute als Schlesische Oberlausitz bezeichnet (Niederschlesischer Oberlausitzkreis). zurück Schlesien gehörte - wie Böhmen - formal zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, war aber nicht in Reichskreise eingeteilt, so daß die Münzstände und ihre Prägezeiten gesondert aufgeführt werden: Bistum Breslau/Fürstentum Neiße (von 1505-1796), die Herzogtümer Jägerndorf (1560-1621), Liegnitz-Brieg (1503-1675), Münsterberg-Öls (1502-1623), Württemberg-Öls (1671-1785), Oppeln-Ratibor (1622-1664), Teschen (1559-1653) und Troppau (1614-1629), ferner die Grafschaft Glatz (1505-1554), die Herrschaft Reichenstein, Grafschaft (seit 1592 Fürstentum) Rosenberg (1532, 1582-1595). Ferner prägten die Städte Breslau (1505-1723), Brieg (1622/23), Glogau (1622), Goldberg (1622/23), Liegnitz (1622/23), Schweidnitz (1506, 1517-1527 und 1621/22) und Striegau (1622). zurück Das &&Herzogtum Schleswig&& (dänisch: Hertugdømmet Slesvig; friesisch: Slasvig) existierte bis 1864. Hauptstadt war die Stadt Schleswig. Vorläufer des Herzogtums war im frühen Mittelalter das Jarltum Südjütland (Sønderjylland). Das Jarltum Schleswig bildete sich im Hochmittelalter innerhalb Dänemarks als Lehen heraus. Im 12. und 13. Jh. nahmen die Jarle nach deutschem Vorbild den Herzogtitel an und behaupteten zunehmend ihre Autonomie gegenüber dem dänischen Königshaus. Nach dem Aussterben des Abelgeschlechts im 14. Jh. gelang es den Schauenburgern, die erbliche Belehnung mit dem Herzogtum Schleswig zu erhalten. Die dynastische Verflechtung zwischen dem Herzogtum Schleswig, der Grafschaft Holstein und dem Königreich Dänemark sollte von da an 500 Jahre lang die Geschichte bestimmen. Nach der Unterwerfung der Sachsen durch Karl dem Großen wurden das Frankenreich und Dänemark zu Nachbarn. Karl der Große und der Dänenkönig Gudfred vereinbarten 808 als Grenze die Eider, die daraufhin über ein Jahrhundert unangetastet festlag. Unter den Kolonisationsbestrebungen des sächsischen Königs Heinrich I. wurde 934 das Gebiet zwischen Eider und Schlei mit der Stadt Schleswig erobert und diente den Kaisern des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation Otto I., Otto II., Otto III., Heinrich II. und Konrad II. unter dem Namen Mark Schleswig (auch Dänische Mark) als Grenzmark. Nachdem Kaiser Konrad II. bei seiner Heirat mit der Tochter Knuts des Großen von England, Dänemark, Schottland und Norwegen diesem Teile von Norddeutschland überlassen hatte, fiel 1025 die Mark Schleswig wieder an Dänemark und die Eidergrenze wurde erneut zur Grenze zwischen dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und Dänemark. Die Schauenburger Grafen, die seit dem frühen 12. Jh. mit dem zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gehörenden benachbarten Holstein belehnt waren, unterstützten die Selbständigkeitsbestrebungen Schleswigs. Graf Gerhard III. von Holstein nötigte 1326 Waldemar III. von Dänemark zur Constitutio Valdemariana, die eine gemeinsame Regierung von Dänemark und Schleswig verbot. Nach dem Aussterben des Schleswiger Herzogsgeschlechts 1386 erzwangen die Schauenburger ihre erbliche Belehnung mit dem Herzogtum Schleswig durch das dänische Königshaus und der holsteinische Adel begann verstärkt, Besitz in Schleswig zu erwerben und die Kolonisierung voranzutreiben. Als das Schauenburger Geschlecht 1459 mit dem Tod Adolfs VIII. ausstarb, war dem Adel in beiden Territorien daran gelegen, daß in beiden Gebieten weiterhin derselbe Herrscher regieren solle. Darum wählten sie König Christian I. von Dänemark, Norwegen und Schweden aus dem Hause Oldenburg, einen Neffen Adolfs VIII., zum Landesherrn. Im Vertrag von Ripen (Ribe) 1460 – der Wahlkapitulation Christians I. – stand unter anderem, "dass se bliwen tosamende up ewig ungedelt". Obwohl dieser weit hinten in der Urkunde stehende Paragraf im zeitgenössischen Kontext nichts mit einer territorialen Unteilbarkeit zu tun hat, wurde "op ewig ungedeelt" das Leitmotto der schleswig-holsteinischen Bewegung des 19. Jh., die eine Loslösung vom dänischen Gesamtstaat anstrebte. zurück &&Schleswig-Holstein&& (dänisch: Slesvig-Holsten, friesisch: Slaswik-Holstiing, niederdeutsch: Sleswig-Holsteen) ist das nördlichste Land Deutschlands. Bis zum März 1864 wurde dort die dänische Währung verwendet. Im frühen 13. Jh. versuchte der dänische König, - neben Schleswig - auch Holstein in sein Reich zu integrieren. Er scheiterte nach anfänglichen Erfolgen jedoch 1227 in der Schlacht von Bornhöved am Widerstand norddeutscher Fürsten. Ab 1250 entwickelte sich die Hanse zu einem bedeutenden Macht- und Wirtschaftsfaktor und Lübeck wurde zu einer der bedeutendsten Städte Nordeuropas. Ab 1386 zeigten sich Schleswig und Holstein erstmals vereint im Wappen, als die Schauenburger Grafen Schleswig als dänisches Lehen erhielten. Nachdem holsteinische Grafen im 14. Jh. ihren Einfluß weit nach Jütland hinein ausdehnen konnten, gelang es Margrete I. um 1400, wieder die dänische Lehnshoheit in Schleswig zu erlangen. Aber auch sie mußte die Besitzansprüche der holsteinischen Adligen in Schleswig anerkennen. 1460 wählte die Schleswig-Holsteinische Ritterschaft nach dem Aussterben der Schauenburger in direkter Linie den dänischen König Christian I. aus dem Haus Oldenburg zum Landesherrn. Er war ein Neffe des letzten Schauenburgers Adolf VIII. Die im Vertrag von Ripen beschlossene Regelung bestimmte für die Herzogtümer, "dat se bliven ewich tosamende ungedelt" (deutsch: "Daß sie ewig ungeteilt zusammenbleiben"). Der dänische König regierte Schleswig und Holstein nicht in seiner Eigenschaft als König, sondern als Herzog der beiden Gebiete, wobei das Herzogtum Schleswig ein königlich-dänisches Lehen blieb, während das Herzogtum Holstein zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gehörte und damit ein Reichslehen war. Die dänische Vorherrschaft bestand bis 1864. 1848–1851 kam es zum Schleswig-Holsteinischen Krieg, in dem deutschgesinnte Schleswig-Holsteiner versuchten, die dänische Oberhoheit zu beenden. Der dänische Sieg bei Idstedt 1850 beendete vorerst die deutschen Hoffnungen auf ein deutsches Schleswig-Holstein. Am 02.07.1850 wurde schließlich der Frieden von Berlin zwischen dem Deutschen Bund und Dänemark geschlossen. Eine Antwort auf die Schleswig-Holsteinische Frage konnte jedoch nicht gefunden werden. Im dänischen Gesamtstaat herrschte seit Einführung des Grundgesetzes 1849 eine konstitutionelle Monarchie im Königreich und Absolutismus in Holstein, jedoch mit einem gemeinsamen Staatsrat, was die Gesetzgebung erschwerte. Dänemark verabschiedete im November 1863 eine Verfassung, die neben den einzelnen Verfassungen des Königreichs und des Herzogtums Schleswigs für die gemeinsamen Angelegenheiten der beiden gelten sollte. Da die Friedensbestimmungen von 1851 damit gebrochen waren, ergriff der preußische Kanzler Bismarck die Chance, die schleswigsche Frage im deutschen Sinne zu lösen. Nach der Verstreichung eines sehr kurzen Ultimatums erklärten Preußen und Österreich Dänemark den Krieg. Den Deutsch-Dänischen Krieg konnten Preußen und Österreich im April 1864 für sich entscheiden. Verhandlungen über eine Teilung Schleswigs führten nicht zu einer Lösung, so daß Schleswig und Holstein von den Siegern zunächst gemeinsam als Kondominium verwaltet wurden. Nach der Gasteiner Konvention 1865 kamen Schleswig und Lauenburg unter preußische Verwaltung, Holstein unter die Österreichs. Nur kleine Teile im Norden Schleswigs blieben dänisch, wie die Insel Ærø, sieben Kirchspiele südlich von Kolding und ein Streifen um Ribe. Dafür gab Dänemark seine Ansprüche auf die königlichen Enklaven an der schleswigschen Westküste auf. Nach dem Preußisch-Österreichischen Krieg 1866 wurde Schleswig-Holstein 1867 als Ganzes eine preußische Provinz. 1871 wurde das Deutsche Reich gegründet. Die Schleswig-Holsteinische Frage war ein zentraler Aspekt der Politik Bismarcks, die schließlich zur Reichseinigung führte. zurück Das herzogliche Haus Schleswig-Holstein-Gottorp (ab dem 18. Jh. nur noch Holstein-Gottorf genannt) war eine Nebenlinie des Hauses Oldenburg. Sie wurde benannt nach Schloß Gottorf bei Schleswig, dem Stammsitz der Familie. Die Gottorfer Herzöge regierten von 1544 bis zum Beginn des 18. Jh. das gleichnamige, territorial verstreute Teilherzogtum in Schleswig-Holstein, von 1713 bis 1773 nur noch in Holstein. Aus dem Haus Gottorp gingen zwischen 1751 und 1818 vier schwedische Könige und seit 1762 die russischen Zaren hervor. zurück Schleswig-Holstein-Hadersleben war eine Linie des Fürstengeschlechtes Haus Oldenburg. Sie wurde 1544 mit Johann II. begründet, als dieser für den entgangenen dänischen Thron mit Teilen Schleswigs und Holsteins entschädigt wurde. Johann II. blieb kinderlos, und die Linie erlosch wieder 1580 mit seinem Tod. Im Herzogtum Schleswig gehörten die Ämter Hadersleben, Tondern (mit Sylt und dem Osterland-Föhr) und Lügumkloster sowie die Landschaften Nordstrand und Fehmarn zum Haderslebener Anteil, in Holstein die Ämter Rendsburg und Bordesholm sowie ab 1559 der Mittelteil von Dithmarschen. zurück Schleswig-Holstein-Sonderburg war der Name einer Nebenlinie aus dem Haus Oldenburg und zugleich die Bezeichnung für deren Herrschaftsgebiet. Schleswig-Holstein-Sonderburg war kein Territorialherzogtum, sondern ein personengebundenes Teilherzogtum innerhalb der Herzogtümer Schleswig und Holstein. Es verteilte sich auf mehrere einzelne Herrschaftsgebiete, die vor allem im Südosten und Norden Schleswig-Holsteins und zum Teil auf dem Gebiet des heutigen Dänemarks lagen. Nach diversen Erbteilungen zerfiel es in zahlreiche Kleinstterritorien, die im 18. Jh. im dänischen Gesamtstaat aufgingen. zurück Hierbei handelt es sich um ein Verkaufsangebot zu wesentlich unter dem üblichen Preis liegenden Konditionen. Ursachen sind ein Verkauf unter Zeitdruck, Räumung von Restposten oder auch Preisdumping. zurück Der "Schleuderguß" ist ein gußtechnisches Verfahren, das in der Zahntechnik, von Goldschmieden, aber auch von Falschmünzern benutzt wird. Eine Gußform wird in eine schnelle Rotation versetzt, wobei die dadurch entstehenden Fliehkräfte genutzt werden, um das Metall mit hohem Druck eng an die Form zu pressen. zurück   Die Prägungen der Grafen Schlick sind vor allem auf Grund der Bedeutung der Joachimstaler, die auch Schlicktaler oder Schlicksche Taler genannt wurden, international ein beliebtes Sammelgebiet. Dazu gehören auch die späteren Prägungen der gräflichen Familie. In nur acht Jahren (1520-1528) hatten der mit dem Münzrecht ausgestattete Stephan Schlick und seine Brüder in Joachimsthal die für damalige Verhältnisse immense Anzahl von ca. 2 Mio. Joachimstalern (und in geringeren Mengen auch Mehrfach- und Teilstücke) ausgemünzt. Dies begründete das international so hohe Ansehen der Joachimstaler, deren Bezeichnung namengebend für die Taler wurde. Im Jahr 1528 fiel das Münzrecht wieder an die böhmische Krone zurück. Die Prägungen der Grafen Schlick sind vor allem auf Grund der Bedeutung der Joachimstaler, die auch Schlicktaler oder Schlicksche Taler genannt wurden, international ein beliebtes Sammelgebiet. Dazu gehören auch die späteren Prägungen der gräflichen Familie. In nur acht Jahren (1520-1528) hatten der mit dem Münzrecht ausgestattete Stephan Schlick und seine Brüder in Joachimsthal die für damalige Verhältnisse immense Anzahl von ca. 2 Mio. Joachimstalern (und in geringeren Mengen auch Mehrfach- und Teilstücke) ausgemünzt. Dies begründete das international so hohe Ansehen der Joachimstaler, deren Bezeichnung namengebend für die Taler wurde. Im Jahr 1528 fiel das Münzrecht wieder an die böhmische Krone zurück.Im 17. Jh. erhielt die gräfliche Familie Schlick das Münzrecht für ihre Herrschaft Plan in Böhmen. Graf Heinrich IV. (1612-1650) begann 1627 mit der Prägung von Halbtalern und Talern (zwei Jahre später), die auf den Vorderseiten die heilige Anna Selbdritt (Madonna mit dem Jesuskind und Anna) über dem Schlickschen Wappen zeigen. Die Rückseite trägt den gekrönten Doppeladler, der mit dem böhmischen Brustbild (doppelt geschwänzter Löwe) belegt ist. Der Typ wurde mit Varianten (u.a. Madonna mit Kind ohne Anna, später vorwiegend Anna Selbdritt in den Wolken) bis zum Ende der "Schlickschen Prägungen" (auch für Dukaten und Kreuzer) beibehalten. Seit 1632 gab es auch Mehrfachtaler, (teilweise in Form von Klippen) sowie einfache (nur 1630) und dreifache (1628-1638) Kreuzer. Als Handelsmünzen in Gold wurden seit 1628 Dukaten und 5-fache Dukaten (seit 1634) geprägt. Die Schlickschen Prägungen des 17. und 18. Jh. erreichten nicht mehr die Bedeutung der früheren Joachimstaler und endeten mit den Talern und Dukaten von 1767, dem einzigen Prägejahr unter Graf Leopold Heinrich Schlick (1766-1770). zurück Alternative Bezeichnung für Joachimstaler. zurück Alternative Bezeichnung für Joachimstaler. zurück E. Schlöser veröffentlichte 1883 in Hannover sein Buch "Die Münztechnik", das eigentlich auch heute noch recht aktuell ist. Mit über 120 Illustrationen erläutert es ausführlich die Schritte von der Grundeinrichtung einer Münzstätte bis zur Prüfung und Sortierung des Endproduktes. zurück  August Ludwig von Schlözer (auch unter dem Pseudonym "Johann Joseph Haigold" schreibend; geb. 05.07.1735 Gaggstatt/Grafschaft Hohenlohe-Kirchberg, heute Kirchberg an der Jagst; gest. 09.09.1809 in Göttingen) war ein deutscher Historiker, Staatsrechtler, Schriftsteller, Publizist, Philologe, Pädagoge und Statistiker der Aufklärung. August Ludwig von Schlözer (auch unter dem Pseudonym "Johann Joseph Haigold" schreibend; geb. 05.07.1735 Gaggstatt/Grafschaft Hohenlohe-Kirchberg, heute Kirchberg an der Jagst; gest. 09.09.1809 in Göttingen) war ein deutscher Historiker, Staatsrechtler, Schriftsteller, Publizist, Philologe, Pädagoge und Statistiker der Aufklärung.Er war Sohn des Pfarrers Johann Georg Friedrich Schlözer (gest. 1740) und begann 1751 ein Theologiestudium an der Universität Wittenberg. Dem Ruf des berühmten Orientalisten Johann David Michaelis folgend, setzte er seine Studien in Göttingen fort. Um sein Bibelverständnis zu vertiefen, studierte er Geographie und Sprachen des Orients zur Vorbereitung einer Reise nach Palästina. Er studierte auch Medizin und Staatswissenschaften. Drei Jahre als Hauslehrer in Schweden genügten ihm, um in schwedischer Sprache wissenschaftliche Arbeiten schreiben zu können. Sein Versuch einer allgemeinen Geschichte der Handlung und Seefahrt in den ältesten Zeiten (1758), 1761 ins Deutsche übersetzt, ist ein Beispiel seiner Geschichtsschreibung, die lebensweltliche mit ökonomischen und politischen Faktoren verbindet, um zu einer vollständigeren geschichtlichen Erkenntnis zu gelangen. Von 1761 bis 1770 in Rußland, zunächst als Hauslehrer, dann als Adjunkt der Petersburger Akademie der Wissenschaften und Lehrer für russische Geschichte, nahm er sehr schnell die Anforderungen seiner neuen Umgebung auf und vertiefte sich in die Quellen zur russischen Geschichte. Aus dieser Beschäftigung entstand sein Hauptwerk, die Edition der altrussischen Nestorchronik (1802-1809), die genaue Kenntnis und Reflexion der historischen Methode belegt. Zar Alexander I. würdigte seine Verdienste um die russische Geschichte durch Nobilitierung. Mit seiner Berufung zum ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der Göttinger Universität hatte Schlözer seine Bestimmung gefunden. Er lehrte zunächst Universalgeschichte, nach dem Tod Gottfried Achenwalls auch Statistik, Politik, neuere Staatengeschichte und Staatsrecht. Als Lehrer faszinierte er seine Studenten, unter ihnen künftige Politiker und Beamte wie Heinrich Friedrich Karl vom Stein und Karl August von Hardenberg, durch sein didaktisches Geschick, die Gegenwartsbedeutung historischer Erkenntnis offenzulegen, seine freimütige Kritik an jeder obrigkeitlichen Willkür und sein leidenschaftliches politisches Temperament. In seiner Vorstellung seiner Universalgeschichte (1772) schreibt Schlözer die Fortentwicklung der Menschheit dem verantwortungsvollen Handeln des Menschen zu. Geschichte und Politik waren in seinem Verständnis aufeinander bezogen. Schlözer hat als Lehrer, Schriftsteller und Publizist die öffentliche Diskussion über die Normen und Werte der Politik und des menschlichen Zusammenlebens angeregt und die Entwicklung bürgerlicher Emanzipation gefördert, eine Leistung, die er selbst - müde und verbittert am Ende seines Lebens - kritisch beurteilte. Seine "Geschichte des russischen Geldwesens" (1791) ist deshalb numismatisch bedeutend, da er nicht nur die Münzen, sondern auch den wirtschaftlichen Hintergrund und die russischen Bergwerke behandelt. zurück Der "Schlüssel" ist eine symbolische Wappenfigur des Heiligen Petrus in den Wappen von Bremen, Genf und Regensburg (gekreuzte Schlüssel). zurück Dies ist die zeitgenössische Bezeichnung für beschnittene Groschenmünzen, im Gegensatz zu den breiten Groschen. zurück Der im Jahr 1531 in Schmalkalden gegründete Bund protestantischer Fürsten und Städte unter Führung des Kurfürsten von Sachsen und des Landgrafen von Hessen hatte die Wahrung des Glaubens und der Selbstständigkeit zum Ziel. Zwischen 1541 und 1546 wurden in Goslar die sog. "Schmalkaldische Bundesmünzen" geprägt. Es handelte sich dabei um Taler, Halb- und Vierteltaler, die auf einer Seite das Hüftbild des Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen (1532-1547) und auf der anderen Seite das des Landgrafen Philipp von Hessen (1509-1567) zeigen. Im Jahr 1546 verhängte Karl V. die Reichsacht über die beiden Fürsten. Mit dem Schmalkaldischen Krieg und der Gefangennahme der Geächteten endete der Bund im Jahre 1547. zurück Andere Bezeichnung für Tiegel. zurück Beim "Schmetterlingstaler" handelt es sich um eine Talermünze des Kurfürsten Friedrich August I. von Sachsen (1694-1733) mit einem Schmetterling auf der Rückseite und dem gekrönten Monogramm des Herrschers auf der Vorderseite. Die Prägung soll Gräfin Cosel, die Mätresse des Herrschers, veranlaßt haben. Es gibt von der auch Teilstücke. zurück Schmöllnitz ist ein Ort in der heutigen Ostslowakei. Er liegt im Tal des gleichnamigen Flusses imd im Gebirge Volovské vrchy.
Die schon vorher bestehende slawische Siedlung wurde von deutschen Kolonisten im 13. Jhl. vergrößert und 1327 als "Semelnech" zur Königlichen Freistadt erhoben. Die Bergleute förderten vor allem Gold, Silber, Kupfer und später Eisenerz und Pyrit. Zu österreichischer Zeit existierte auch eine Münzstätte. zurück Beim "Schmuckgeld" handelt es sich um Zahlungsmittel, die sich aus Schmuck entwickelt haben oder gleichzeitig als Schmuck und Geld Verwendung fanden. Schmuck wird von jeher von Menschen aller Völker als Zierrat getragen und ist sehr begehrt. Schmuck und Wert waren schon früher eng miteinander verbundene Begriffe, denn noch heute wird Schmuck als Kapitalanlage, Wert- und Statussymbol gesehen, Würde- oder Kriegsschmuck dient zur Auszeichnung des Besitzers. Oftmals dient Schmuck auch dazu, das Vermögen oder den Reichtum des Besitzers zur Schau zu stellen (Reichtumsanzeiger). Schmuckobjekte, die als Amulette getragen werden, erfüllen die Funktion, vor Unheil und Krankheit zu schützen oder magische Kräfte zu übertragen. Ringgelder in Form von Arm-, Hals-, Finger-, Bein- oder Fußringen stellen einen wichtigen Bestandteil des Schmuckgeldes dar. Im alten Ägypten hatten um 1490 v.Chr. aus Gold und Silber gegossene Ringe Zahlungscharakter, wie u.a. ein bemaltes Relief aus dem Grab des Benia-Prahekamen (Theben) über das Abwiegen von Gold- und Silberringen zeigt. Auch bei den Kelten und wohl auch bei den Germanen, später vor allem in Schwarzafrika, fanden Ringgelder aus verschiedenen Metallen Verwendung. In Asien, Amerika, Australien und den Inseln der Südsee wurden Schmuckgelder aus Perlen, Muschelschalen, Glas oder Steinen hergestellt. In Westafrika und der Südsee wurden Glasperlen aus europäischer Produktion als Tausch- und Zahlungsmittel verwendet. Perlen, Muschel- und Seeschneckenschalen erhielten erst ihren Geldcharakter, wenn sie in bestimmter Reihenfolge auf Schnüre aufgezogen waren. Seltener konnten auch Zähne, Pflanzenfasern, Federn u.ä. als Bestandteile oder Ornamente für Geldschnüre oder Schmuckgeldobjekte dienen. Solche teilweise kunstvoll gefertigten "Schmuckgelder" kommen vor allem im Bereich der Inselwelt Papua-Neuguineas, Melanesiens und Mikronesiens vor. zurück Die "Schmula-Sammlung" ist bis heute eine der bedeutendsten Sammlungen zum Thema Ausbeutemünzen. Die Sammlung von Dagobert Schmula wurde 1914 in Halle/Saale versteigert. zurück 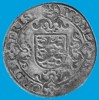 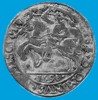 "Schnapphahn" (niederländisch: Snapphaan) ist die Bezeichnung für die (ersten) Schillinge in den Niederlanden. Gemeint sind damit niederländisch-niederrheinische Silbermünzen im Wert von 6 Stuivern (deutsch: Stüber), die erstmals von Herzog Karl von Geldern 1509 geprägt wurden. Die Vorderseite zeigt den reitenden Herzog mit geschwungenem Schwert, den das Volk als Raubritter (deutsch: "Schnapphahn", niederländisch: "Snapphaan") deutete. Die Münze wurde auch von anderen Münzständen wie Lüttich und Nimwegen und der Mark nachgeprägt und nach 1581 auch auf wertgleiche Schillinge der niederländischen Provinzen übertragen. "Schnapphahn" (niederländisch: Snapphaan) ist die Bezeichnung für die (ersten) Schillinge in den Niederlanden. Gemeint sind damit niederländisch-niederrheinische Silbermünzen im Wert von 6 Stuivern (deutsch: Stüber), die erstmals von Herzog Karl von Geldern 1509 geprägt wurden. Die Vorderseite zeigt den reitenden Herzog mit geschwungenem Schwert, den das Volk als Raubritter (deutsch: "Schnapphahn", niederländisch: "Snapphaan") deutete. Die Münze wurde auch von anderen Münzständen wie Lüttich und Nimwegen und der Mark nachgeprägt und nach 1581 auch auf wertgleiche Schillinge der niederländischen Provinzen übertragen.zurück Beim "Schnapphahnschilling" handelt es sich um einen niederländischen Schilling, ähnlich dem Schnapphahn, der ab 1581 von verschiedenen Provinzen geprägt wurde. zurück Schneeberg ist eine Stadt im Erzgebirge in Sachsen. Die über 500-jährige Geschichte Schneebergs ist vor allem vom Bergbau geprägt, dem die Stadt ihre Gründung am 06.02.1471 verdankt. Der ursprüngliche Silberbergbau wich seit Mitte des 16. Jh. dem Abbau von Cobalt und Wismut. In den Jahren 1492 und 1493 wurde in Schneeberg der sog. Bartgroschen geprägt. zurück   Beim "Schnepfenheller" handelt es sich um eine dem Heller ähnliche Münze, die die Fürsten von Isenburg seit dem beginnenden 19. Jh. zur Erinnerung an die Teilnahme bei Schnepfenjagden verteilten. Die Erinnerungsstücke tragen auf einer Seite den Namen des Fürsten, die andere Seite zeigt eine Schnepfe. Sie zählen zu dem Sammelgebiet der Jagdmünzen und -medaillen. Beim "Schnepfenheller" handelt es sich um eine dem Heller ähnliche Münze, die die Fürsten von Isenburg seit dem beginnenden 19. Jh. zur Erinnerung an die Teilnahme bei Schnepfenjagden verteilten. Die Erinnerungsstücke tragen auf einer Seite den Namen des Fürsten, die andere Seite zeigt eine Schnepfe. Sie zählen zu dem Sammelgebiet der Jagdmünzen und -medaillen.zurück Im Mittelalter bedeutete "Schock" eine Anzahl von 60 Stück. Der Name wurde auf die ersten Prager und Meißner Groschen übertragen, von denen 60 Stück auf eine Mark kamen. Die später von Friedrich II. und Wilhelm III. zwischen 1444 und 1451 geschlagenen, im Gewicht verminderten Meißner Sechshellergroschen (auch als "kleinen Landsberger" mit dem Landsberger Schild bekannt) nannte man "neue Schockgroschen", weil 60 Stück auf den rheinischen Gulden gingen. Diese in Freiberg in Sachsen geprägten Groschen zeigten auf der Vorderseite ein Lilienkreuz und den darauf liegenden Landsberger Schild im Vierpaß und auf der Rückseite einen Löwen mit verschiedenen Beizeichen. zurück Von "schön" beim Erhaltungsgrad einer Münze spricht man, wenn diese deutliche Abnutzungsspuren mit noch erkennbaren Reliefkonturen ("s" = schön) aufweist (englisch: fine, französisch: beau, italienisch: molto bello, niederländisch: fraai, spanisch: bien conservado). zurück Dies ist die Bezeichnung für eine Talermünze, die Herzog August der Jüngere von Braunschweig-Wolfenbüttel (1635-1666) kurz vor seinem Tod in den Jahren 1665/66 schlagen ließ. Die Münze zeigt auf der Vorderseite. einen Engel mit Posaune, der einen Lorbeerkranz über das mit einer Mütze versehene Haupt des Herzogs hält. Die Rückseite zeigt den von Wilden Männern gehaltenen behelmten Schild und den Wahlspruch des Herzogs "ALLES MIT BEDACHT" und die Jahresangabe. zurück Bezeichnung für eine geringe Beeinträchtigung der Erhaltung von Münzen etc., die noch nicht als Qualitätsfehler gilt. Der Abschlag vom Wert beträgt ca. 10-20 Prozent. zurück Die Farbe "schokoladen" ist eine bräunliche Farbe, die recht selten bei Banknoten vorkommt (dänisch: chokolade, englisch, portugiesisch und spanisch: chocolate, französisch: chocolat, italienisch: cioccolato, niederländisch: chocolade). zurück Der "Schoolgirl Dollar" ist ein bekannter Typ des US-Dollars, der 1879 von George T. Morgan entworfen wurde. zurück Alternative Bezeichnung für Schoter. zurück Das "Schoter" (auch: Skot) war ursprünglich ein osteuropäisches Silbergewicht und vom 13. bis ins 15. Jh. auch eine Rechnungsmünze (1/24 der Gewichtsmark = 30 Pfennige) in Polen, Preußen und Schlesien. Der ganze "Schoter" wurde nie ausgeprägt, aber das Halbschoter genannte Halbstück kam durch den Hochmeister des Deutschen Ritterordens Winrich von Kniprode (seit etwa 1370) in Ostpreußen zur Ausprägung, wenn auch in geringen Mengen. Die Gewichtsmark (Mark I) zerfiel dabei nicht wie üblich in sechzehn Teile (Lot), sondern in 24 Teile (Skot). zurück &&Schottland&& (englisch und schottisch: Scotland, gälisch: Alba, lateinisch-keltisch: Caledonia) ist ein Landesteil des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und ein Land im Nordwesten Europas. Schottland besteht aus dem nördlichen Teil der größten europäischen Insel Großbritannien sowie mehreren Inselgruppen. Bis 1707 war es ein eigenständiges Königreich. In diesem Jahr wurde es mit dem Königreich England - mit dem es bereits seit 1603 in Personalunion regiert wurde - vereinigt. Amtssprache: Englisch, Schottisch-Gälisch, Scots Hauptstadt: Edinburgh Staatsform: Konstitutionell-parlamentarische Monarchie Fläche: 78.772 qkm Einwohnerzahl: 5,094 Mio. (2002) Bevölkerungsdichte: 64 Einwohner pro qkm BIP: 130 Mrd. US-Dollar (2002) BIP/Einwohner: 25.546 US-Dollar (2002) Zeitzone: UTC +0, Sommerzeit: UTC +1 Währung: Pfund Sterling, £, GBP mit eigenen schottischen Noten der Bank of Scotland, Royal Bank of Scotland (beide Edinburgh) und Clydesdale Bank (Glasgow); Münzen wie in England. zurück Vor Vereinigung mit England im Jahre 1603 prägte das Königreich Schottland eigene Münzen und auch noch bis 1709 im geringen Umfang in der Münzstätte in Edinburgh. Zeitweise gab es bis zu 22 Münzstätten, wovon sich sogar vier während der mittelalterlichen Grenzkriege in England befanden. Die sehr schönen Goldmünzen wurden allerdings nur in der Hauptstadt Edinburgh geprägt. Kirchliche Prägungen sind auf St. Andrews beschränkt und gab es nur in der Mitte des 15. Jh. Die Münzgeschichte von Schottland begann mit David I. (1124-1153), der silberne Pennies schlagen ließ, die den englischen sehr ähnlich waren. Gegen Ende des 12. Jh. gab es einen markanten Penny unter Wilhelm I., bei dem auch die französische Form des Königstitels, "Le Rei Willame", als Inschrift vorkommt. Unter David II. (1329-1371) gab es dann den ersten Groat und das erste Goldstück (als Nobel). Unter Robert III. (1390-1406) wurde dann das erste Goldstück geprägt, das einen eigenen Charakter hatte und sich nicht an englischen Vorbildern orientierte, eine Crown zu 5 Shillings, die im Volksmund auch als "Lion" (deutsch: "Löwe") bezeichnet wurde. Überhaupt vermehrten sich die Typen im 15.Jh., denn in Gold kam ein Rider hinzu sowie eine Billonmünze, der Plack. Unter Jakob V. (1613-1542) gab es eine weitere Billonmünze, den Bawbee, und einen seltenen goldenen Dukaten, das Bonnet Piece. Die meisten Münzen gab es allerdings unter Maria Stuart (1542-1567) und unter ihrem Sohn Jakob VI. mit insgesamt acht verschiedenen Ausgaben. Im 17. Jh. gab es nur eine eigene Münze in Kupfer, den Turner. Die anderen Ausgaben unterschieden sich von der englischen nur durch das Münzzeichen, die Distel. Zur Zeit Karls I. weilte Nicolas Briot in Schottland und durch ihn entstanden einige schöne Stücke. Ab 1675 gab es einen schottischen Dollar zu 4 Merk mit mehreren Teilstücken zu 2, 1 und 1/2 Merk sowie 1/2, 1/4 und 1/8 Dollar. Münzen aus Gold gab es nicht mehr, mit Ausnahme der Pistole von 1702. Unter Königin Anna I. wurde 1707 das schottische Parlament abgeschafft und die Bindung an England vertieft. 1709 wurde die Münzstätte in Edinburgh aufgelöst. zurück Andere Bezeichnung für "schief". zurück Bezeichnung für eine schräg verlaufende Schrift, die man auch als "Kursivschrift" bezeichnet (dänisch: kursiv, englisch: italics, französisch: italique, italienisch: italico, niederländisch: cursief, portugiesisch: itálico, spanisch: itálica). zurück Schraplau liegt zwischen Halle (Saale) und der Lutherstadt Eisleben im Tal der Weida. In früherer Zeit gab es dort auch eine gräflich Mansfeldsche Münzstätte, die seit dem 16. Jh. das Münzzeichen "S" verwendete. zurück   Die Schraubtaler waren im 17. und 18. Jh. so beliebt, daß man darauf verfiel, die Stücke speziell als "Schraubmedaillen" herzustellen, ohne bereits vorhandene Talermünzen oder Medaillen zu bearbeiten. Diese Typen enthalten oft ganze Serien von Bildern, meist auf Papier, manchmal auch auf Marienglas gemalt. Auch Gravierungen und geschriebene Texte kommen vor, seltener sind feine, in Öl gemalte Miniaturbildnisse. Ein Bedeutendster Hersteller der Schraubtaler war im 18. Jh. der Augsburger Silbertreiber Abraham Remshart. Im 19. Jh. wurden manchmal Bilder fototechnisch auf die polierten Innenseiten der Schraubtaler oder -medaillen geätzt. Es handelt sich oftmals um Bildergeschichten, die sich inhaltlich auf private, modische, religiöse oder politische Themen beziehen. In Kriegszeiten sollen die Münzkapseln auch zum Transport von Geheimbotschaften gedient haben. Die Schraubtaler waren im 17. und 18. Jh. so beliebt, daß man darauf verfiel, die Stücke speziell als "Schraubmedaillen" herzustellen, ohne bereits vorhandene Talermünzen oder Medaillen zu bearbeiten. Diese Typen enthalten oft ganze Serien von Bildern, meist auf Papier, manchmal auch auf Marienglas gemalt. Auch Gravierungen und geschriebene Texte kommen vor, seltener sind feine, in Öl gemalte Miniaturbildnisse. Ein Bedeutendster Hersteller der Schraubtaler war im 18. Jh. der Augsburger Silbertreiber Abraham Remshart. Im 19. Jh. wurden manchmal Bilder fototechnisch auf die polierten Innenseiten der Schraubtaler oder -medaillen geätzt. Es handelt sich oftmals um Bildergeschichten, die sich inhaltlich auf private, modische, religiöse oder politische Themen beziehen. In Kriegszeiten sollen die Münzkapseln auch zum Transport von Geheimbotschaften gedient haben.zurück Als "Schraubmünzen" (auch: Schraubtaler oder Schraubmedaillen) bezeichnet man Geldstücke, die aus zwei mit einem Gewinde versehenen Teilen bestehen. Die Herstellung von "Schraubmünzen" reicht vom Ende des 16. bis zur ersten Hälfte des 20. Jh., wobei der Großteil in Augsburg produziert wurde sowie in Nürnberg und Wien. Die meisten Exemplare sind kreisrund und bestehen aus zwei Teilen. Es kommen aber auch diverse Varianten vor. zurück 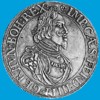 Hierbei handelt es sich um halbierte, ausgedrehte und mit einem Schraubgewinde versehene Taler, die in ihrem Hohlraum Bilder aufnehmen können. "Schraubtaler" wurden zwischen dem ausgehenden 16. und dem 19. Jh. vorwiegend in Süddeutschland (vor allem in Augsburg) gefertigt. Sie wurden auf zwei verschiedene Arten aus einem oder aus zwei Talern hergestellt. Bei der frühesten Machart wurden aus zwei Talern die Rückseiten und der Großteil des Münzmaterials herausgedreht, ohne den Rand zu verletzen. Es entstanden zwei flache Schalen mit Münzrändern, an deren Innen- bzw. Außenseite Gewinde eingeschnitten wurden, so daß die beiden ausgedrehten Taler miteinander verschraubt werden konnten. Die Innenseiten wurden oft mit Miniaturmalereien versehen, meist mit Porträts, gelegentlich auch mit eingelegten einzelnen Bildern. Bei der anderen Machart zersägte man einen Taler in Vorder- und Rückseite und lötete zwischen beide Seiten ein verschraubbares Zwischenstück. Hierbei handelt es sich um halbierte, ausgedrehte und mit einem Schraubgewinde versehene Taler, die in ihrem Hohlraum Bilder aufnehmen können. "Schraubtaler" wurden zwischen dem ausgehenden 16. und dem 19. Jh. vorwiegend in Süddeutschland (vor allem in Augsburg) gefertigt. Sie wurden auf zwei verschiedene Arten aus einem oder aus zwei Talern hergestellt. Bei der frühesten Machart wurden aus zwei Talern die Rückseiten und der Großteil des Münzmaterials herausgedreht, ohne den Rand zu verletzen. Es entstanden zwei flache Schalen mit Münzrändern, an deren Innen- bzw. Außenseite Gewinde eingeschnitten wurden, so daß die beiden ausgedrehten Taler miteinander verschraubt werden konnten. Die Innenseiten wurden oft mit Miniaturmalereien versehen, meist mit Porträts, gelegentlich auch mit eingelegten einzelnen Bildern. Bei der anderen Machart zersägte man einen Taler in Vorder- und Rückseite und lötete zwischen beide Seiten ein verschraubbares Zwischenstück.zurück Als "Schreckenberger" oder "Engelgroschen" wurden die ursprünglich guthaltigen sächsischen Silbergroschen bezeichnet, die seit 1498 aus den kurz zuvor entdeckten reichen Silbervorkommen des Schreckenberges bei St. Annaberg geschlagen wurden. Sie zeigen auf den Vorderseiten den von einem Engel gehaltenen sächsischen Kurschild (gekreuzte Schwerter) und auf den Rückseiten das Wappen der Herzöge von Sachsen. Sie wogen zunächst ca. 4,5 g (ca. 933/1000 fein) und seit 1558 etwa 5 g (908/1000 fein). Anfangs gingen sieben, seit 1558 sechs "Engelgroschen" auf einen Gulden. Die bis 1571 geprägten "Schreckenberger" waren über Sachsen und Thüringen hinaus beliebte Münzen. Wegen ihrer Größe wurden sie auch Mühlsteine benannt. Ihren schlechten Ruf erhielt die Münzsorte, als man in der Kipper- und Wipperzeit (1618-1623) in Massen unterwertige Schreckenberger im Nominalwert von 4 Groschen oder 12 Kreuzern prägte. Ihr Gewicht betrug ebenfalls etwa 5 g, aber bei einem Feingehalt, der (anfangs) nur bei ca. 370/1000 lag und noch weiter fiel. Ihre Vorderseiten waren ähnlich wie die des ursprünglichen Typs und die Rückseiten zeigten zwei Engel und drei Schilde. Sie wurden nicht nur von sächsischen Münzständen geprägt, sondern von umliegenden Münzständen noch schlechter nachgeahmt und überschwemmten das ganze Land. Der Name "Schreckenberger" wurde auf ähnliche Sorten mit anderen Geprägen übertragen und wurde schließlich zum Inbegriff und Schimpfwort für die schlechten Münzen der Kipper- und Wipperzeit. zurück Andere Bezeichnung für "Kurrentschrift" (dänisch: kursiv, englisch: script, französisch: écriture, italienisch: scrittura, niederländisch: handschrift, portugiesisch: letra cursiva, spanisch: cursiva). zurück Bezeichnung für ein System von Zeichen, um sprachliche Äußerungen festzuhalten (englisch: handwriting, französisch: écriture). zurück Bezeichnung für die in ihrem Erscheinungsbild unterschiedlichen, an typischen Merkmalen unterscheidbaren Schriften. zurück zurück In der alten Münztechnik wurde die ausgestanzte, aber noch ungeprägte Münze als "Schrötling" bezeichnet (von schroten = zerhacken, zerteilen, ausstanzen). Seit dem 18. Jh. haben sich andere Namen wie Plättchen, Platte oder Ronde eingebürgert. zurück Bei "Schrötlingsfehlern" handelt es sich um Fehler, die schon vor der Prägung dem Schrötling anhafteten. Diese konnten schon beim Gießen, Strecken oder Walzen der Zaine entstanden sein. zurück Diese entstehen durch die Ausdehnung der Schrötlinge beim Prägevorgang durch Risse am Rand oder im Feld der Münze. "Schrötlingsrisse" traten früher durch die Materialbeanspruchung bzw. -verunreinigung oder bei sprödem Material auf, vorwiegend an extrem dicken antiken Münzen oder besonders dünnen mittelalterlichen Brakteaten. Seit der Ringprägung, spätestens aber seit der Einführung des Kniehebelprägewerkes kommen diese Schönheitsfehler, die wertmindernd sein können, nicht mehr vor. zurück Friedrich Freiherr von Schrötter (geb. 1862; gest. 1944) war Nationalökonom, Historiker und Numismatiker mit dem Schwerpunkt auf dem Gebiet des neuzeitlichen Münzwesens Brandenburg-Preußens, zu dem er zwischen 1904 und 1925 ein mehrbändiges Werk herausgab. Auch zu dem neuzeitlichen Geldwesen von Brandenburg-Franken, des Kurfürstentums Trier und Magdeburg liegen Veröffentlichungen vor. Das von ihm 1930 herausgegebene "Wörterbuch der Münzkunde" zählt noch heute zum Standardwerk der numismatischen Literatur, wenn es auch stellenweise etwas veraltet ist. Besondere Verdienste erwarb er sich als Mitarbeiter am Berliner Münzkabinett, an dem er seit 1927 Kustos war. zurück "Schrot" bezeichnete ursprünglich das Rau- bzw. Gesamtgewicht einer Münze, während Korn für das Feingewicht der Münze stand, das heißt für ihren Anteil an Edelmetall. zurück Das Verb "schroten" bedeutet das Ausstückeln oder Ausstanzen der Schrötlinge aus den Zainen. Das Substantiv "Schroten" bezeichnet die Reste, die nach dem Ausschneiden oder Ausstanzen der Schrötlinge von den Zainen übrig blieben. Diese Rückstände wurden meist wieder eingeschmolzen. zurück Die traditionelle Redewendung "von echtem Schrot und Korn" stammt aus der Welt der Münzen. "Schrot" bezeichnete ursprünglich das Rau- bzw. Gesamtgewicht einer Münze, während "Korn" für das Feingewicht der Münze stand, das heißt für ihren Anteil an Edelmetall. Besonders in Krisenzeiten wurde an diesen beiden Größen gerne manipuliert, weshalb unverfälschte Münzen von echtem Schrot und Korn hoch angesehen waren. Im übertragenen Sinne ist damit ein aufrichtiger Mensch gemeint. Der Ausdruck erschien erstmals im Jahr 1530 auf Talermünzen des albertinischen Herzog Georg dem Bärtigen (1500-1539). Dieser weigerte sich, den verschlechterten Münzfuß des Kurfürsten Johann zu übernehmen und setzte den Ausdruck "Nach altem Schrot und Korn" auf seine Münzen, um zu verdeutlichen, daß die betreffenden Münzen nach dem (guten) alten Münzfuß geprägt waren. zurück "Schuerken" war die niederländische Spottbezeichnung für eine Silbermünze von Brabant im Wert eines halben Groot. Die Vorderseite zeigt die verunglückte Darstellung der Peterskirche von Leuven, die im Volksmund zu "Schuerken" (deutsch: "Scheuer" bzw. "Scheune") verballhornt wurde. zurück "Schüsselpfennige" (auch: gehulchte Pfennige) sind einseitig beprägte Pfennige, deren Ränder (meist Perlränder) sich durch den Hammerschlag bei der Pfennige teller- oder schüsselartig hochwölbten. Auf der leicht nach außen gewölbten ungeprägten Seite drückte sich das Münzbild teilweise konkav durch. Vorläufer der Schüsselpfennige wurden schon im 14. Jh. in Straßburg, Trier und der Pfalz (seit 1374) in großen Mengen geschlagen. Durch die Aschaffenburger Konvention von 1424 wurde der Münzfuß der Schüsselpfennige auf ein Raugewicht von 0,39 g (Feingewicht ca. 0,2 g) festgelegt. Ihr Gepräge zeigt meist einen Wappenschild. Seltener sind auch Halbstücke im Gewicht von 0,21 g (0,1 g fein) geschlagen worden. Die beliebten Pfennige wurden bis ins 18. Jh. hergestellt, u.a. in der Pfalz, in Bayern, Mainz, Speyer, Fulda, Ulm, in württembergischen und braunschweigischen Münzstätten sowie in der Schweiz. zurück Eine "Schützenmedaille" ist eine an einen erfolgreichen Schützen ausgeteilte Prämienmedaille. Vorläufer waren im 16. Jh. die goldenen Schmuckketten der fürstlichen Jagdgesellschaften. zurück Eine "Schützenmünze" ist eine an einen erfolgreichen Schützen ausgeteilte Prämienmünze. Die ersten Schützenmünzen kamen im 17. Jh. in zahlreichen Varianten auf. zurück Alternative Bezeichnung für Schützenmedaille. zurück Alternative Bezeichnung für Sycee-Silber. zurück Niederländisch für "schief" (dänisch: skrâ, englisch: oblique bzw. slanting, französisch: oblique bzw. incliné, italienisch und portugiesisch: obliquo, spanisch: oblicuo). zurück Alternative Bezeichnung für Schulpfennig. zurück Der "Schulpfennig" ist ein Typ der Rechenpfennige. zurück 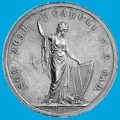  "Schulprämienmedaillen" (auch: Schulpreismedaillen) wurden von Schulen und Universitäten zur Belohnung fleißiger Schüler und Studenten ausgegeben und waren (später) teilweise auch mit Geldpreisen verbunden. Sie wurden meist am Ende des Schuljahrs, nach Abschluß von Examina oder auf Grund besonderer Preisaufgaben vergeben. Sie verbreiteten sich im späten 16. Jh. von der Schweiz (Altdorf, Bern) aus und wurden früher Brabeon (wörtlich: "Kampfpreis") genannt. Im 17. und 18. Jh. wurden sie auch an deutschen Schulen und Universitäten (bis ins 20. Jh.) ausgegeben. Auch in Frankreich und den USA waren Schulprämienmedaillen weit verbreitet. "Schulprämienmedaillen" (auch: Schulpreismedaillen) wurden von Schulen und Universitäten zur Belohnung fleißiger Schüler und Studenten ausgegeben und waren (später) teilweise auch mit Geldpreisen verbunden. Sie wurden meist am Ende des Schuljahrs, nach Abschluß von Examina oder auf Grund besonderer Preisaufgaben vergeben. Sie verbreiteten sich im späten 16. Jh. von der Schweiz (Altdorf, Bern) aus und wurden früher Brabeon (wörtlich: "Kampfpreis") genannt. Im 17. und 18. Jh. wurden sie auch an deutschen Schulen und Universitäten (bis ins 20. Jh.) ausgegeben. Auch in Frankreich und den USA waren Schulprämienmedaillen weit verbreitet.zurück Alternative Bezeichnung für Schulprämienmedaillen. zurück Georg Schultes (geb. ca. 1520; gest. 1556) war der erste Nürnberger Rechenpfennigmacher, dessen Signaturen (u.a. "GEORG" oder "IORG SCHULTES") auf Nürnberger Rechenpfennigen auftauchte. Hans Schulte (geb. 1553; gest. 1583), der eine Vielzahl von verschiedenen Typen von Rechenpfennigen schlug, war vermutlich sein Sohn. zurück Otto Schultz (geb.1848; gest. 1911) war ein deutscher Medailleur und Stempelschneider, der nach seiner Ausbildung in Berlin und London seit 1881 an der Loos'schen Münzanstalt in Berlin arbeitete. Von 1889 an war er an der Berliner Münzstätte angestellt und schnitt die Stempel einer Reihe von Münzen des Deutschen Reiches. Auch einige Entwürfe gehen auf Otto Schultz zurück, u.a. das 2- und 5-Mark-Stück von 1904 zur Vermählung des Großherzogs Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-Schwerin (1897-1818) mit Alexandra, Princess Royal von Großbritannien und Irland, Herzogin von Braunschweig-Lüneburg. zurück Dies ist der zeitgenössische Name für leichte Pfennigmünzen, die im 11./12. Jh. von ostfriesischen und niederländischen Münzständen geschlagen wurden. zurück Schwabach ist eine Stadt in Bayern, in der Städteachse Nürnberg-Fürth-Erlangen-Schwabach gelegen. In früherer Zeit gab es dort auch eine Münzstätte, die Münzen für den Fränkischen Kreis prägte und das Münzzeichen "S" verwendete. zurück "Schwaben" steht sowohl für die Volksgruppe der Schwaben (altdeutsch: Suaben), die teils mit den Alemannen gleichgesetzt, teils als Untergruppe derselben betrachtet wird, als auch für die Landschaft Schwaben, die im Mittelalter auch politisch – als Herzogtum Schwaben – existierte. zurück Schwäbisch Gmünd ist eine Stadt im Osten des heutigen Bundeslandes Baden-Württembergs, ca. 50 km östlich von Stuttgart. In mittelalterlicher Zeit gab es dort auch eine Münzstätte. zurück Schwäbisch-Hall ist eine Stadt im Nordosten des heutigen Landes Baden-Württemberg. In mittelalterlicher Zeit gab es dort auch eine Münzstätte. zurück Name eines bedeutenden deutschen Zubehörherstellers mit Sitz in Bempflingen. zurück Zu den neuzeitlichen Prägungen des schwäbischen Reichskreises (bis 1806) zählen die Münzen des Markgrafen Christoph I. von Baden (Stammhaus) und die von seinen Söhnen in seinem Namen geprägten Münzen (1501-1525) sowie die der Markgrafen von Baden-Baden (nach 1536-1714) und Baden-Durlach (1572-1803, 1803-1806 Kurfürstentum). Ferner gehören dazu die Prägungen der Herzöge von Württemberg (1501-1803, seit 1803 Kurfürstentum), der Grafen und Fürsten von Hohenzollern (ca. 1505-2544), Hohenzollern-Hechingen (1606-1804) und Hohenzollern-Sigmaringen (1621-22), die ihre Prägungen 1838/39 fortführten, ferner der Fürsten von Fürstenberg (ca. 1621-1804) und der Grafen (seit 1674 Fürsten) von Öttingen (1499-1759). Die Prägungen der Neufürsten von Liechtenstein zählten zwischen 1728 und 1778 zum "Schwäbischen Kreis", die Haupt- und Seitenlinien der Grafen/Neufürsten Fugger nahmen nur vereinzelt ihr Prägerecht wahr. Ferner prägten Graf Johann Jakob von Ebernstein, die Grafen von Welfenstein-Gundelfingen (1562-1623), Königsegg (1756, 1759), Montfort (nach 1520-1763), Sulz(1621-1675) und Waldburg (anonym, 1657, 1675). Die Reichsstädte Augsburg (1515- ca. 1564) und Nördlingen (1503-1572) unterhielten Reichsmünzstätten, die unmittelbar der obersten Reichsgewalt unterstanden. Weitere Prägungen stammen aus den Reichsstädten Augsburg (1521-1805), Biberach, (1619/39), Breisach (1499-1600, 1633), Buchhorn (1700-1704), der Stadt Freiburg im Breisgau (1498-1739), Schwäbisch-Hall (1494-1798), Isny (1508-1702), Kaufbeuren (1540-55, 1622), Kempten (1572-1748), Konstanz (1498-1727), Menningen (1622-1716), Ravensburg (1550-1701), Rottweil (1506-1623), Überlingen (1694-1704) und Ulm (Anfang 16. Jh.- ca. 1780). Die beiden letztgenannten Orte prägten auch gemeinsam (1501-1503) und mit Ravensburg (1501/02) in der Münzstätte Ulm. Auch Lindau, Isny, Wangen und Leutkirch prägten gemeinschaftlich 1732 in Langenargen. Die Gemeinschaftsprägungen des "Schwäbischen Kreises" aus den Jahren 1694 und 1737 wurden von Württemberg und dem Bistum Konstanz ins Leben gerufen. Die Bischöfe von Konstanz ließen in der Neuzeit zwischen 1508 und 1772 Münzen prägen, das Stift Kempten zwischen 1572 und 1748, die Fürstprobstei Ellwangen zwischen 1621 und 1765 und schließlich das Johanniter-Großpriorat Heitersheim 1659. zurück Der "Schwäbischer Münzbund" war im Spätmittelalter einen Münzverein auf schwäbischem Gebiet. Schon im Jahr 1404 kam es zu einer Vereinbarung zwischen Württemberg und den Bodenseestädten, nach der Schillinge im Wert von 1/25 des (rheinischen) Goldguldens und Hellers geschlagen wurden. zurück Der Schwäbische Münzverein wurde 1423 durch einen Riedlinger Vertrag zwischen den Bodenseestädten, den württembergischen Städten und den Grafen von Württemberg gegründet. Später gehörten diesem Münzverein auch Ravenburg, Biberach und schweizerische Städte an. Neben Schillingen und Hellern wurden nun auch die einseitigen Hörnleinspfennnige zu zwei Hellern geprägt. Außerdem kam es 1475 zur ersten Gemeinschaftsprägung mit Baden. In Tübingen wurden Schillinge geprägt, die auf der einen Seite das Wappen von Baden und auf der anderen Seite das württembergische Wappen zeigen. Im Jahr 1495 wurde Württemberg zum Herzogtum erhoben und führte seitdem die Turmfahne im Wappen. Der "Schwäbische Münzbund" hatte bis ins beginnende 16. Jh. Bestand. zurück Bezeichnung für eine ins Schwarze gehende Farbgebung (dänisch: morkgrâ, englisch: blackish, französisch: noirâtre, italienisch: nerastro, niederländisch: zwartachtig, portugiesisch: enegrecido, spanisch: negruzco). zurück Dies ist die Sammlerbezeichnung für die Münzen des 19. Jh., die vor der Einführung der Reichswährung in Deutschland geprägt wurden. Die Bezeichnung entstand durch die Kataloge des sächsischen Sammlers C. Schwalbach "Die neuesten deutschen Münzen unter Talergröße vor Einführung des Reichsgeldes sowie die neuesten österreichischen und ungarischen Münzen vor Einführung der Kronenwährung" (Leipzig 1879, 1895, 1904). Die Kataloge wurden später ergänzt durch "Die neuesten deutschen Taler, Doppeltaler und Doppelgulden vor Einführung der Reichswährung". Obwohl es mittlerweile genauere Kataloge zu diesem Gebiet gibt, wird der Schwalbach-Katalog gelegentlich immer noch zitiert. zurück Hugo Schwaneberger (geb. 23.05.1853 in Neumarkt/Schlesien), gest. 31.08.1934 in Bückeburg) war ein bekannter deutscher Philatelist und Numismatiker, Bearbeiter und Herausgeber des nach ihm benannten Schwaneberger-Albums, das ab 1879 erschien. Er machte sich auch um das Organisationsleben um die Jahrhundertwende des 19./20. Jh. verdient, gründete u.a. 1882 die Selektion Leipzig des Internationalen Philatelistenverbandes Dresden und war bis zu seinem Tod dort Vorsitzender. zurück Dies ist der Name des bedeutendsten deutschen Verlages. Die "Schwaneberger Verlag GmbH" für Kataloge und Zubehör hat ihren Sitz in München und ist Herausgeber der weltbekannten Michel-Kataloge. Im Internet ist die Firma unter der Adresse »www.michel.de« erreichbar. zurück Alternative Bezeichnung für Zopfdukaten. zurück Die Benennung "Schwaren" leitet sich vermutlich von der Bezeichnung sware Penninge (schwere Pfennige) ab, die im 14. Jh. in Bremen gebräuchlich war. Damit waren ursprünglich aber nicht die eigenen leichten Hohlpfennige gemeint, sondern die schweren westfälischen Dickpfennige, die im Verhältnis 1:3 in Bremen umliefen. Im Jahr 1369 verpfändete Erzbischof Albrecht II. der Stadt Bremen das Münzrecht. Demnach dürften die ersten bremischen Schwaren nicht vor dem ausgehenden 14. Jh. geprägt worden sein. Das Vorbild waren wohl die bischöflichen Pfennige von Münster, die den hl. Paulus zeigen (Paulusmünzen). Die ersten bremischen Schwaren zeigen den hl. Petrus mit Schlüssel und den segnenden Bischof. Ein zweiter Typ mit dem Wappenschild von Bremen und dem hl. Petrus mit Schlüssel und Schwert folgte. Ihr Raugewicht schwankte ursprünglich wohl um ca. 1 g (etwa 0,5 g fein). Fünf Schwaren galten einen Groten. Unter Erzbischof Heinrich II. von Schwarzenburg (1463-1496) wurden erstmals auch erzbischöfliche "Schwaren" geschlagen. Die bremischen Schwaren fielen im Laufe der Zeit im Gewicht und wurden 1719 erstmals in Kupfer geschlagen. Sie zeigen auf den Vorderseiten den bremischen Schlüssel zwischen der Jahresangabe und auf der Rückseite die Wertzahl und Angabe "I/SCHWA/REN" in drei Zeilen. Es wurden auch 2 1/2-Schwaren-Stücke ausgegeben, zuletzt 1866. Etwa zur selben Zeit wie in Bremen begann in Oldenburg die Prägung von Schwaren. Die oldenburgischen Schwaren zeigen allerdings den hl. Lambert, der mit Schwert dargestellt ist. zurück Die Farbe "schwarz" ist eine Farbe, die auch bei Banknoten gelegentlich vorkommt (dänisch: sort, englisch: black, französisch: noir, italienisch: nero, niederländisch: zwart, portugiesisch: preto, spanisch: negro). zurück Der gebürtige Augsburger Hans Schwarz gilt als der erste deutsche Medailleur und ist gleichzeitig auch einer der bedeutendsten Vertreter seiner Zunft. Geburts- und Todesjahr sind nicht genau bekannt. Seine Hauptschaffenszeit liegt zwischen 1516 und 1527. Heute sind über 130 Medaillen aus seiner Hand bekannt. Am berühmtesten ist wohl das Porträt, das seinen Künstlerkollegen Albrecht Dürer zeigt. Außerdem ließen sich u.a. Kaiser Maximilian, Herzog Georg von Sachsen und Jakob Fugger von Schwarz modellieren. Seine Modelle sind meist einseitig aus Buchsbaumholz geschnitzt. zurück Schwarzburg ist ein Ort in Thüringen, im Norden des Thüringer Waldes und am Fluß Schwarza. In alter Zeit gab es dort auch eine Münzstätte. zurück Schwarzburg-Sondershausen ist der Name eines Fürstentums in Thüringen, das 1599 zunächst als Grafschaft Schwarzburg-Arnstadt gebildet wurde. zurück  && Schwarzburg-Rudolstadt&& ist der Name eines Fürstentums in Thüringen, das 1599 zunächst als Grafschaft Schwarzburg-Rudolstadt gebildet wurde und ab 1697 bis 1918 ein Fürstentum war. && Schwarzburg-Rudolstadt&& ist der Name eines Fürstentums in Thüringen, das 1599 zunächst als Grafschaft Schwarzburg-Rudolstadt gebildet wurde und ab 1697 bis 1918 ein Fürstentum war.Die Geschichte des Fürstentums geht auf das Geschlecht der Grafen von Schwarzburg zurück, die erstmals im 11. Jh. erwähnt wurden. Durch verschiedene Erbteilungen und Erwerbungen veränderte die Grafschaft bis zum 16. Jh. häufig ihre Gestalt. Nach dem Tod von Graf Günther XLI. im Jahr 1583 teilten seine beiden Brüder die Grafschaft Schwarzburg und bildeten ab 1584 die beiden Hauptlinien Schwarzburg-Arnstadt und Schwarzburg-Rudolstadt. Mit dem Stadtilmer Vertrag vom 21.11.1599 wurden die schwarzburgischen Territorien neu aufgeteilt und die beiden Grafschaften und späteren Fürstentümer erhielten ihre Gestalt, die bis 1920 im Wesentlichen unverändert blieb. 1815 trat das Fürstentum dem Deutschen Bund bei, nachdem es 1807 Mitglied des Rheinbunds geworden war und damit bis 1813 unter der Protektion Napoleon Bonapartes gestanden hatte. Nachdem 1866 Schwarzburg-Rudolstadt gegen die von Österreich im Bundestag des Deutschen Bundes beantragte Mobilmachung gegen Preußen gestimmt hatte, trat das Fürstentum dem neuen Norddeutschen Bund bei, wodurch 1867 die Militärhoheit an Preußen überging. Seit dem 18.01.1871 gehörte das Land dem Deutschen Reich an. zurück  Das Fürstentum &&Schwarzburg-Sondershausen&& in Thüringen wurde im Jahre 1599 zunächst als Grafschaft Schwarburg-Arnstadt gebildet und war seit 1697 ein Fürstentum, das von 1716 bis 1918 die Bezeichnung Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen trug. Das Fürstentum &&Schwarzburg-Sondershausen&& in Thüringen wurde im Jahre 1599 zunächst als Grafschaft Schwarburg-Arnstadt gebildet und war seit 1697 ein Fürstentum, das von 1716 bis 1918 die Bezeichnung Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen trug.Die Geschichte des Fürstentums geht auf das Geschlecht der Grafen von Schwarzburg zurück, die erstmals im 11. Jh. erwähnt wurden. Durch Erbteilungen und Erwerbungen veränderte die Grafschaft Schwarzburg bis zum 16. Jh. häufig ihre Gestalt. Nach dem Tod von Graf Günther XLI. im Jahre 1583 teilten seine beiden Brüder die Grafschaft Schwarzburg und bildeten ab 1584 die beiden Hauptlinien Schwarzburg-Arnstadt und Schwarzburg-Rudolstadt. Mit dem Stadtilmer Vertrag vom 21.11.1599 wurden die schwarzburgischen Territorien neu aufgeteilt. Die beiden Grafschaften und späteren Fürstentümer erhielten ihre Gestalt, wie sie bis 1920 im Wesentlichen unverändert blieben. Der letzte Fürst verstarb 1925 in Sondershausen. Seine Gemahlin Anna-Luise von Schwarzburg verstarb 1951 ebenda. Sie war neben dem Herzog Ernst II. von Sachsen-Altenburg und der geschiedenen Frau von Ernst II., Adelheid (1875–1971), die einzige Fürstin, die in der Deutschen Demokratischen Republik blieb. zurück Dies ist der Sammelbegriff für die unter Bischof Gerhard von Schwarzburg (1372-1400) geschlagenen Pfennige und deren Beischläge. zurück Alternative Bezeichnung für Schwarzpfennige. zurück Alternative Bezeichnung für Schwarzpfennige. zurück "Schwarzpfennige" (auch: "schwarze Pfennige") sind ungesottene Münzen, die schwarz oder dunkelfarbig aussehen, im Gegensatz zu den Weißpfennigen, die an der Oberfläche weißlich-silbrig glänzen. Der Unterschied liegt nicht im Silbergehalt, denn beide Pfennigsorten enthalten wenig Silber, sondern im Verfahren des Weißsiedens. Der Albus oder "Weißpfennig", wie ihn z. B. einige fränkische Münzstände im 14. Jh. ausgaben, wurde gesotten, so daß eine silbrigglänzende Oberfläche entstand, die sich im Umlauf aber bald abrieb. Die Schwarzpfennige waren von vornherein ungesotten, sahen dunkler aus und nahmen durch Oxidation nach einiger Zeit sogar eine schwarze Farbe an. Im Jahr 1533 bildete sich in Augsburg ein Münzverein (vor allem aus dem Raum Bayern und Oberpfalz), der sich geradezu als "Verein der schwarzen Münze" bezeichnete. Die Prägung der Schwarzpfennige hielt sich in diesem Raum bis ins 17. Jh. In Österreich wurden von der Mitte des 14. bis zur Mitte des 15. Jh. Schwarzpfennige geprägt. Bei der Bevölkerung waren die schwarzen Münzen natürlich unbeliebt und wurden mit Bezeichnungen wie z. B. Möhrchen verspottet. zurück  &&Schweden&& (schwedisch: Konungariket Sverige; deutsch: Königreich Schweden) ist eine Monarchie in Nordeuropa. »Schweden« grenzt im Südwesten an das Skagerrak (Nordsee), das Kattegat (Ostsee) und den Sund, im Süden und Osten an die offene Ostsee und den Bottnischen Meerbusen, im Nordosten an Finnland und im Westen an Norwegen. &&Schweden&& (schwedisch: Konungariket Sverige; deutsch: Königreich Schweden) ist eine Monarchie in Nordeuropa. »Schweden« grenzt im Südwesten an das Skagerrak (Nordsee), das Kattegat (Ostsee) und den Sund, im Süden und Osten an die offene Ostsee und den Bottnischen Meerbusen, im Nordosten an Finnland und im Westen an Norwegen.Fläche: 449.964 qkm Einwohner: (1999) 8,892 Mio. Hauptstadt: Stockholm Verwaltungsgliederung: 21 Län (Bezirke) Amtssprache: Schwedisch Weitere, offizielle (Minderheiten-)Sprachen: Finnisch, Samisch (was eigentlich mehrere stark verschiedene Sprachen sind) und Meänkieli (eine Art altertümliches Finnisch; wird im Tornedalen gesprochen) Nationalfeiertag: 6. Juni Zeitzone: MEZ Währung: 1 Schwedische Krone (skr) = 100 Öre zurück Im frühen Mittelalter war das Gebiet des heutigen Schweden von Svear und Goten besiedelt, wobei die Goten während der Zeit der Völkerwanderung in den Mittelmeerraum zogen. Es gab schon recht früh Handelsbeziehungen zum Römischen Reich, wobei die gefundenen Münzen meist aus dem 2. Jh. stammten. Danach gelangten erst wieder im 5. und 6. Jh. römische Münzen nach Schweden, wobei es sich um oströmische Solidi aus Gold handelte. Anfangs des 1. Jh. bis zum Ende des 10. Jh. tauchten große Mengen arabischer, kufischer Silberdirhems auf. Als sich die Handelsbeziehungen der Wikinger mehr vom östlichen in den westlichen Raum verschoben, kam nach 950 bis 1100 verstärkt westliches Geld auf. Angelsächsische Pennies wurden nicht nur im Baltikum und sonstigen Skandinavien, sondern auch in Schweden nachgeprägt. Als Münzstätte gilt Sigtuna und als Münzherr der schwedische König Olof Skötkonung. Die Nachahmungen sind die ersten in Schweden geprägten Münzen. Im Geldverkehr spielten sie aber neben den ausländischen Münzen und dem Hacksilber nur eine geringe Rolle. Erst um 1140 wurde die Prägung an verschiedenen Orten wieder aufgenommen. Bis 1363 schlug man nur Pennnige. 1364 kam neben den Penningen auch der Örtug hinzu, der bis zum Ende der Prägezeit unter Johann III. 1591 den Drei-Kronen-Schild zeigte. Schon zu Beginn der Kalmarer Union (Vereinigung der drei nordischen Königreiche unter Margaretha von Dänemark) im Jahre 1389 mußten die Schweden hohe Steuern für die dänischen Kriege zahlen und 1434 erhoben sich die Bauern, die 1439 den dänischen König Erich von Pommern absetzten. Danach kamen zwar noch dänische Könige auf den Thron, führte dieser Aufstand letztendlich zur Auflösung der Union. Karl Knutsson Bondes (1448-1470) und die Reichsverweser aus dem Hause der Sture setzten die Unabhängigkeitsbestrebungen fort. Als Dänemark diese Bestrebungen blutig beenden wollte, kam 1523 Gustav Eriksson Wasa auf den Thron. Er führte 1522 die Öre, 1536 die Mark und 1534 den Taler ein. Mit der Einführung von Kupfergeld im Jahre 1624 wollte König Gustav II. Adolf auf dem Weltmarkt den Kupferpreis hochhalten, da Schweden zu dieser Zeit zwei Drittel des europäischen Bedarfs deckte. Dennoch fiel der Kupferpreis und Silbermünzen wurden höherwertiger. Weil man zuwenig Kupfer für die Prägung verbrauchte, begann man ab 1644 große Kupferplatten zu prägen. Hinzu kamen 1715 bis 1719 die ersten Görtzschen Notdaler. Erst die Münzreform von 1776 brachte eine Besserung im schwedischen Geldverkehr, indem man den Silbermünzfuß festsetzte. Der Rigsdaler wurde in 48 Skilling eingeteilt und diese in 12 Runstycke. 1775 bis 1777 wurden Münzen in doppelter Wertbezeichnung geprägt (1 Riksdaler = 3 Daler S.M.). Die Geldscheine und Scheidemünzen aus Kupfer wurden auf den halben Wert gesetzt. Durch diese Reform konnte allerdings die Bildung von Parallelwährungen nicht verhindert werden, da Schweden seit 1661 als erstes europäisches Land Banknoten verwendete. Es gab diese von der Bank Johan Palmstruch, der Rikets Ständers Bank und dem Riksgäldkontor, das 1789 eröffnet wurde. Als Deutschland zum Goldmünzfuß überging, wurde die Skandinavische Münzunion gegründet, der Dänemark und Schweden 1873 und Norwegen 1875 beitraten. Die Krone ersetzte fortan den Riksdaler und zählte 100 Öre. zurück Dies ist die Bezeichnung für Prägungen der schwedischen Könige in deren Besitzungen in Deutschland, Polen und im Baltikum. Dazu zählen die Münzen der Städte Tallinn/Reval (1561-1681), Narva (1670-72), Riga (1621-1707), Elbing (1627-35, 1656-60), Thorn (1654-1658) und die Münzen Livlands (1644-1669). Letztere wurden in der Münzstätte in Riga geprägt. Durch die schwedische Einmischung im Dreißigjährigen Krieg und durch seine Folgen kam es zwischen 1631 und 1635 zu einer ganzen Reihe von schwedischen Münzprägungen in den deutschen Städten Augsburg, Erfurt, Fürth, Mainz, Nürnberg, Osnabrück und Würzburg. Hinzu kommen die Münzprägungen aus der königlich-schwedischen Münzstätte in Stralsund (auch Wolgast und Stettin) für das schwedische Herzogtum Pommern (1633-1814), von Wismar (1648-1803), Bremen-Verden und Stade (1648-1719). Die schwedischen Besitzungsmünzen sind nach den regionalen Münzfüßen der besetzten Gebiete ausgeprägt und unterscheiden sich stilistisch von den Münzen Schwedens. In der Mehrzahl handelt es sich um 1/24-Taler (Dreipölker) und Solidi (Schillinge). Letztere wurden in der Fälscherwerkstatt der Burg Suczava in großen Mengen gefälscht (Suczava-Fälschungen). zurück Die "Schwedische Krone" (ISO-4217-Code: SEK; Abkürzung: Skr) ist die Währung von Schweden. Sie ist frei konvertierbar. Die Krone wurde 1873 eingeführt und war damals sowohl in Schweden als auch Dänemark, Norwegen und dem heutigen Island gültig. Die selbstständige schwedische Variante gibt es seit 1924. Im Laufe der Geschichte und abhängig von der jeweiligen wirtschaftlichen Lage wurde die schwedische Währung sowohl an den Gold-, Silber- und Papierstandard als auch an das Britische Pfund und den US-Dollar angebunden, um ein stabiles Preisniveau zu schaffen. Die Münzen und Banknoten werden von der Schwedischen Reichsbank (schwedisch: Sveriges Riksbank) ausgegeben. Münzen gibt es zu 1, 2, 5 und 10 Kronen und Banknoten zu 20, 50, 100, 500 und 1.000 Kronen. zurück Deutsche Bezeichnung für die Svenska Numismatiska Föreningen. zurück Die "Schwedische Reichsbank" (schwedisch: Sveriges Riksbank) ist die Zentralbank von Schweden. Sie ist eine Behörde des schwedischen Reichstags. Die Schwedische Reichsbank wird von einer Direktion geleitet, die aus sechs Mitgliedern besteht. Die Direktionsmitglieder werden vom Reichsbankausschuß für sechs Jahre gewählt, wobei jährlich ein Mitglied gewählt wird. Die elf Mitglieder des Reichsbankausschusses werden vom Reichstag gewählt, wobei die Zusammensetzung des Ausschusses die politische Zusammensetzung des Reichstags widerspiegelt. Die Schwedische Reichsbank hat die alleinige Verantwortung für die schwedische Geldpolitik, aber nicht für die Währungspolitik. Die allgemeinen Richtlinien für die Währungspolitik werden von der Regierung getroffen, die Reichsbank ist aber für deren Umsetzung verantwortlich. Die Reichsbank hat auch das Monopol auf die Emission von Banknoten und Münzen. In der Durchführung ihrer Aufgaben ist die Reichsbank selbständig und darf keine Weisungen entgegennehmen. Die Schwedische Reichsbank ist die älteste noch existierende Zentralbank der Welt. Sie entstand durch die Übernahme der 1656 von Johan Palmstruch gegründeten Palmstruck-Bank oder Stockholms Banco. Die Bank von Palmstruch bekam 1656 das Recht, Banknoten herauszugeben. Auf Grund einer Überemission ab 1661 ging die Bank 1668 in Konkurs und wurde vom schwedischen Reichstag übernommen, um das Vertrauen in das Bankwesen wieder herzustellen. Die Herausgabe von Banknoten wurde erst 1701 vorsichtig wieder aufgenommen. Im 19. Jh. wurde auch Privatbanken erlaubt, Banknoten herauszugeben, die aber gegen Reichsbankscheine einlösbar waren. 1897 bekam die Reichsbank das Monopol auf die Emission von Banknoten und von 1904 an galten nur mehr die Banknoten der Reichsbank als Zahlungsmittel. Damit übernahm die Reichsbank auch die Kontrolle über die Geldpolitik in Schweden. zurück Das Silbersulfid (Ag2S) ist eine Salzverbindung des Silbers, die meist durch den Schwefelwasserstoff-Gehalt in der Luft entsteht und sich als bläulich-schwarzer Belag auf Münzen niederschlägt. Die Schwefelsilber-Beläge treten vor allem in Städten mit hohem Schwefeldioxid-Gehalt in der Luft auf oder in Wohnungen, die mit Kohleöfen beheizt sind. Die Reaktion verstärkt sich, wenn die Münzen starken Licht- und Temperaturschwankungen ausgesetzt sind (photochemische Reaktion). Vielen Sammlern moderner Münzen, die eine silberglänzende Oberfläche ihrer Stücke bevorzugen, mögen das Auftreten von "Schwefelsilber" auf ihren Münzen nicht. Die Beläge lassen sich zwar im Tauchbad oder durch Abwaschen mit einer Salmiaklösung leicht entfernen, treten aber auf den empfindlicheren frisch gereinigten Silberoberflächen bald wieder auf. Langsam gewachsene Schwefelsilber-Beläge bilden eine Silberpatina, die bei Sammlern älterer Münzen beliebt ist und nicht entfernt werden sollte. zurück Schweidnitz ist eine Stadt in Niederschlesien im heutigen Südwesten Polens. 1506, 1517-1527 und 1621/22 wurden dort auch Münzen geprägt. zurück Alternative Bezeichnung für Birok. zurück Dies ist die Bezeichnung für eine Rupie, die 1911 unter König Georg V. (1910-1936) in Britisch-Indien geprägt wurde. Die Bezeichnung geht auf den mißglückten Stempelschnitt des Elefanten (vom Elefantenorden) zurück. Die Darstellung des Tiers mit verkürztem Rüssel und kurzen Beinen wurde von der Bevölkerung als Schwein gedeutet, das in Indien als "unrein" angesehen wird. Nachdem etwa 700.000 Stück in den Umlauf gelangt waren, kam es zu Protesten. Die britische Kolonialregierung sah sich zur Verrufung der "Schweine-Typ-Variante" veranlaßt, obwohl die Münzstätten in Bombay und Kalkutta bereits etwa 9,6 Mio. Stück geprägt hatten. Sie wurden mit dem Großteil der bereits ausgegebenen Stücke eingeschmolzen und durch eine Emission ersetzt, die eindeutig einen Elefanten zeigt. zurück Das "Schweineschnauzengeld" ist ein Typ des sog. Tok money. Es zeichnet sich durch eine vergleichsweise höherwertige Legierung aus Silber aus. Auch hier ist die Oberseite hoch aufgewölbt. zurück Schweinfurt ist eine Stadt in Unterfranken. Vom 12. Jh. bis 1802 war die Stadt eine freie Reichsstadt. Im Mittelalter gab es dort auch eine Münzstätte. zurück Alternative Bezeichnung für den Saudukat. zurück Als "Schweißpatina" bezeichnet man die häßliche Oberfläche auf Münzen, die glatt und fettig wirkt und besonders bei Münzen auftritt, die längere Zeit als Schmuck auf der Haut oder auch auf Textilien getragen wurden (wie z. B. Amulettmünzen). Münzen mit "Schweißpatina" wirken selbst dann noch unansehnlich, wenn das Relief noch gut erhalten ist. Sie sollten nur Eingang in Sammlungen finden, wenn es sich um seltene Stücke oder numismatisch besonders bedeutsame Objekte handelt. Die "Schweißpatina" wirkt sich meistens als wertmindernd auf die betreffenden Stücke aus. zurück  Die &&Schweiz&& (französisch: Suisse, italienisch: Svizzera, bündnerromanisch: Svizzra, amtliche Namen: Schweizerische Eidgenossenschaft, Confédération Suisse, Confederazione Svizzera, lateinisch; Confoederatio Helvetica) ist ein Bundesstaat in Mitteleuropa. Das Land grenzt im Westen an Frankreich, im Norden an Deutschland, im Osten an Liechtenstein und Österreich und im Süden an Italien. Die &&Schweiz&& (französisch: Suisse, italienisch: Svizzera, bündnerromanisch: Svizzra, amtliche Namen: Schweizerische Eidgenossenschaft, Confédération Suisse, Confederazione Svizzera, lateinisch; Confoederatio Helvetica) ist ein Bundesstaat in Mitteleuropa. Das Land grenzt im Westen an Frankreich, im Norden an Deutschland, im Osten an Liechtenstein und Österreich und im Süden an Italien.Fläche: 41.285 qkm Einwohner: 7.164.000 Bevölkerungsdichte: 124.412 Einwohner/qkm Hauptstadt: Bern Staatsform: Parlamentarischer Bundesstaat, seit 1848 unabhängig, de facto aber schon seit dem 22.09.1499 (Basler Friede), anerkannt 24.10.1648 (Westfälischer Friede) Verwaltungsgliederung: 20 Vollkantone, 6 Halbkantone Amtssprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch Nationalfeiertag: 1. August Währung: 1 Schweizer Franken (SFr.) = 100 Rappen (Rp) / Centimes (c) zurück Die Gründung der Schweiz geht auf den Bund der drei Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden zurück. 1798 umfaßte der Bund dreizehn souveräne Orte, die von 1798 bis 1803 durch die französischen Eroberer in einen Einheitsstaat gezwungen wurden und danach wieder einen Staatenbund bildeten. Am 12.08.1848 gab es eine neue Bundesverfassung, die zur heutigen Form der Eidgenossenschaft führte. die meisten schweizerischen Kantone, Städte und Bistümer hatten bis zu dieser Zeit eigene Münzen geprägt, so daß es ein großer Wirrwarr gab. Mit der neuen Bundesverfassung wurde auch das Münzwesen vereinheitlicht. Es galt fortan 1 Franken zu 100 Rappen. Anfangs wurde der Bedarf an Münzen durch die Münzstätten in Paris und Straßburg gedeckt, wo 5, 2, 1 und 1/2 Franken in Silber, 20, 10 und 5 Rappen in Billon sowie 2 und 1 Rappen in Bronze geprägt wurden. Die Einführung des neuen Geldes erfolgte schrittweise nach Kantonen, wobei man am 01.08.1851 in der Westschweiz begann und ein Jahr später die beiden letzten Kantone Graubünden und Tessin versorgte. Betreffend Gewicht, Gehalt und Form hatte sich die Schweiz 1865 der Lateinischen Münzunion angeschlossen, die am 10.01.1927 ihre Wirkung verlor. Der Münzumlauf in der Schweiz war sehr international, da z. B. 1898 63 Prozent der 5-Franken-Stücke aus Italien, 24 Prozent aus Frankreich, 9 Prozent aus Belgien, 1 Prozent aus Griechenland und nur 3 Prozent aus der Schweiz selbst stammten. Erst ab 1927 waren ausschließlich eigene Münzen zugelassen. 1931 gab es ein neues Münzgesetz, das das 5-Franken-Stück von 37 auf 31 mm verkleinerte und das Gewicht von 25 auf 15 g. 1936 wurde der schweizerische Franken um 30 Prozent abgewertet und es gab die ersten Gedenkmünzen. zurück Der Medaillen- und Münzkünstler Jacob Stamper schuf die als "Schweizer Bundestaler" bekannte Schaumünze, die auf der Vorderseite die Schilde der dreizehn Kantone und der sieben ihnen zugewandten Orte zeigt und auf der Rückseite den Rütlischwur darstellt. zurück Der "Schweizer Franken" (französisch: Franc suisse, italienisch: Franco svizzero, rätoromanisch: Franc scizzer; ISO-4217-Code: CHF; Abkürzung: SFr. bzw. Fr.) ist die Währung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und des Fürstentums Liechtenstein. Er wird in 100 Rappen (französisch: Centimes, italienisch: Centesimi, rätoromanisch: Raps) unterteilt. Außerdem ist der Schweizer Franken die amtliche Währung in der italienischen Exklave Campione d'Italia und in Büsingen am Hochrhein, der deutschen Gemeinde in der Schweiz, wird überwiegend mit Schweizer Franken gezahlt. zurück Offizielle (deutsche) Bezeichnung für die Schweiz. zurück "Schwere Pfennige" (auch: "sware Penninge") sind die sog. Schwaren, die es zunächst in Bremen und später auch in Oldenburg gab. zurück Als "Schwergeld" (auch: "Schwerkupfer") bezeichnet das italisch-römische Aes grave. zurück Alternative Bezeichnung für Schwergeld. zurück Das "Schwert" ist eine Hieb- und Stichwaffe mit gerader oder gebogener, ein- oder zweischneidiger Klinge, Griff und, je nach Epoche und Herkunftsland, Parierstange und Knauf. Das Wort "Schwert" ist aus dem althochdeutschen Wort "swert" oder auch "swerd" entstanden. Der Ursprung dieses altgermanischen Substantivs ist jedoch unbekannt. Es wird häufig auch auf Münzen abgebildet. zurück Dies ist die Bezeichnung für einen Meißner Groschen, welcher 1457-1464 unter Kurfürst Friedrich II., dem Sanftmütigen geprägt wurde und in der Umschrift einen Schild mit gekreuzten Kurschwertern zeigt. Halbstücke zu 6 Pfennigen bzw. 12 Hellern wurden auch noch nach 1464 geprägt. zurück Dies ist die alternative Bezeichnung für Säbelmünze. zurück Dies ist der Beiname der bayerischen Kronentaler von 1809 bis 1825, die auf der Rückseite ein Schwert und ein Zepter gekreuzt zeigen. zurück Alternative Bezeichnung für "Kümmerformen". zurück Durch das Zusammenziehen des Metalls beim Erkalten entsteht eine Differenz zwischen den ursprünglichen Maßen des Modells und dem gegossenen (erkalteten) Stück, die als "Schwundmaß" bezeichnet wird. In welchem Umfang sich das Schwundmaß bewegt, hängt von dem Schmelzpunkt des Metalls ab (im Durchschnitt etwa 1 1/2 Prozent). Wenn Stücke in einem genau festgelegten Maß gewünscht werden (Maßanfertigungen), so muß das Modell um das "Schwundmaß" größer angefertigt werden. zurück Die Schwyz zählt zu den drei schweizerischen Urkantonen. Um 1622 wurde dort eine eigene Münzstätte errichtet, wobei Münzpächter bis 1624 zahlreiche Batzen fertigten. Von 1623 bis 1656 gab es sporadisch auch Dicken und 1653 die einzigste Talermünze. 1730 wurde in Bäch am Zürichsee eine Münzstätte eröffnet, die 20-Kreuzer-Stücke prägte. Da es aus Zürich Reklamationen gab, wurde sie nach kurzer Zeit wieder geschlossen. Erst 1776 wurden wieder Münzen geprägt. Das letzte Prägejahr war 1846. zurück Irische Bezeichnung für Schilling. Südirland wurde 1922 Freistaat mit Dominionstatus (Irischer Freistaat) und nach Inkrafttreten der Verfassung am 29.12.1937 unabhängige Republik. Der irische "Scilling" wurde seit 1928 im Gewicht von 5,6552 g ausgegeben und zeigt auf der Vorderseite die irische Harfe und auf der Rückseite einen Stier. Das gleichzeitig geprägte Doppelstück im Gewicht von 11,3104 g (rückseitig: Atlantischer Lachs) wird landessprachlich als "Flóirín" bezeichnet. Beide Stücke wurden bis 1942/43 in 750er Silber und nach dem 2. Weltkrieg (erstmals 1951) in Kupfer-Nickel geprägt und behielten ihre Münzbilder bis zu zum Prägeende 1968 bei. Wie beim englischen Shilling war das Ende des "Scilling" durch die Umstellung auf die Dezimalwährung im Jahre 1972 bedingt. Es galten 100 Nua Pingin bzw. New Pence = 1 Irisches Pfund bzw. 1 Pfund Sterling. Die Währungsparität 1 Irisches Pfund = 1 Pfund Sterling galt noch bis zum 30.03.1979. zurück Italienisch für "beschädigt" (dänisch: beskadiget, englisch: damaged, französisch: abîmé, niederländisch: beschadigd, portugiesisch: estragado, spanisch: defectuoso). zurück Englisch für Schottland. zurück ISO-4217-Code für die Seychellen-Rupie. zurück Englisch für "Schreibschrift" (dänisch: kursiv, französisch: écriture, italienisch: scrittura, niederländisch: handschrift, portugiesisch: letra cursiva, spanisch: cursiva). zurück Mehrzahl von Scripulum. zurück "Scripulum" (auch: "Scrupulum"; deutsch: "Steinchen") ist die lateinische Bezeichnung eines kleinen und beliebten römischen Gewichts zu 1/288 des römischen Pfunds (Libra) bzw. 1/24 Uncia, umgerechnet 1,137 g. Der Sesterz, die kleinste Silbermünze zur Zeit der Römischen Republik, wurde um 211/210 v.Chr. im Gewicht des Scripulums ausgeprägt. zurück Italienisch für "Schreibschrift" (dänisch: kursiv, englisch: script, französisch: écriture, niederländisch: handschrift, portugiesisch: letra cursiva, spanisch: cursiva). zurück Alternative Bezeichnung für Scripulum. zurück Mehrzahl von Scudo. zurück Mehrzahl von Scudo d'argento. zurück Mehrzahl von Scudo della croce. zurück Mehrzahl von Scudo d'oro. zurück Mehrzahl von Scudo stretto. zurück   "Scudo" ist die vom italienischen Wort "Schild" abgeleitete Bezeichnung, die zunächst allgemein jede italienische Münze aus Gold oder Silber bezeichnete, die einen heraldischen Wappenschild zeigte. "Scudo" ist die vom italienischen Wort "Schild" abgeleitete Bezeichnung, die zunächst allgemein jede italienische Münze aus Gold oder Silber bezeichnete, die einen heraldischen Wappenschild zeigte.Der goldene "Scudo" (Scudo d'oro) war weniger bedeutend und wurde zwischen 1350 und 1800 (vor allem im 16. und 17. Jh.) von einigen Münzständen in Italien geprägt. Die "Scudi d'oro" waren vor allem in Form von Vielfachstücken als prachtvolle Schaumünzen beliebt, wie sie z. B. Francesco I. d'Este (1629-1658) zwischen 1631 und 1633 (Vielfache bis 24 Scudi d'oro) prägen ließ. Auch die Könige von Savoyen und Sardinien, Vittorio Amadeo I. (1630-1637) und Carlo Emanuele II. (1638-1675) gaben prächtig Scudi d'oro aus. Vittorio Amadeo I. ließ zwischen 1633 und 1636 (Vielfache bis 30 Scudi), Carlo Emanuele II. zwischen 1639 und 1671 (bis 40 Scudi) diese Stücke prägen. Der silberne Scudo (Scudo d'argento) entwickelte sich im Laufe des 16. Jh. zur Großsilbermünze in ganz Italien. U.a. wurden "Scudi d'argenti" in Ancona, Bergamo, Bologna, Florenz, Genua, Lucca, Mantua, Mailand, Modena, Turin und Venedig geschlagen. Bekannte Scudo-Typen sind der seit 1596 in Genua geprägte Scudo stretto (gekröntes Tor/Kreuz mit Sternen in den Winkeln), dem der Typ Madonnina folgte. Der venezianische Haupttyp Scudo della croce (Blumenkreuz/Löwenwappen) wurde bis herunter zum Achtelstück und bis zum Ende der Republikzeit geprägt. Die Reihe der päpstlichen Silber-Scudi erstreckt sich von der Mitte des 16. Jh. über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahrhunderten. zurück zurück Der venezianische "Scudo della croce" (mit Blumenkreuz/Löwenwappen) war ein Typ des italienischen Scudo und wurde bis herunter zum Achtelstück bis zum Ende der Republikzeit geprägt. zurück zurück Der seit 1596 in Genua geprägte Scudo stretto (gekröntes Tor/Kreuz mit Sternen in den Winkeln) war ein Typ des Scudo. zurück zurück Alternative Bezeichnung für Scudomünze. zurück Abkürzung für "sculpsit". zurück Lateinisch für "hat gestochen" bei einem Stecherzeichen. Dies weist auf den Künstler hin, der das Stück entwarf und modellierte, nicht aber den Stempel schnitt. zurück Alternative Bezeichnung für Skyphate. zurück ISO-4217-Code für das Sudanesische Pfund. zurück zurück Englisch für "Siegel" (französisch: cachet de cire bzw. sceau, italienisch: timbro, portugiesisch: carimbo, spanisch: sello). zurück Die "Seated Liberty" ist ein Haupttyp der Darstellung der Liberty, der die Personifikation der Freiheit sitzend zeigt. Der Entwurf geht auf Christian Gobrecht zurück. Der Typ "Seated Liberty" ist auf mehreren US-amerikanischen Silbermünzen des 19. Jh. zu sehen. Die zwischen 1836 und 1891 geprägten Half Dimes (1837-1873), Dimes (1837-1891), 20-Cent-Stücke (1875-1878), Quarter Dollars (1838-1891), Half Dollars (1839-1891) und Dollars (1836-1873) zeigen die sitzende Freiheitsgöttin. zurück Dies ist die Bezeichnung eines seltenen Typs des Guldens der Reichsstadt Nürnberg, der auf der Rückseite den hl. Sebaldus als stehende Figur mit Kirchenmodell darstellt. Die Sebalduskirche in Nürnberg beherbergte bis zur Reformationszeit die Reliquien des Stadtpatrons, dem Peter Vischer zwischen 1508 und 1519 ein kunstvolles Grabmal schuf. Die "Sebaldusgoldgulden" wurden bereits 1429 und von 1623 bis 1646 geprägt. Die frühen Goldstücke zeigen auf der Vorderseite das Wappen im Dreipaß, die späteren einen Adler mit dem Zeichen "N" (für Nürnberg) auf der Brust. Sie wurden nach dem Fuß der Stadtwährung geprägt, den der Fränkische Münzverein von 1407 festgelegt hatte (ca. 924/1000 fein) und waren damit feiner als der zur gleichen Zeit in Nürnberg häufiger geprägte Laurentiusgoldgulden. zurück Neben den Sebastianstalern ließen die Fürsten von Öttingen-Wallerstein-Spielberg auch (gleichnamige) Gulden prägen. zurück Hierbei handelt es sich um eine Talermünze des Fürsten Johann Aloys I. zu Öttingen-Wallerstein-Spielberg (1737-1780) von 1759 mit der Darstellung des Martyriums des heiligen Sebaldus, der nach der Legende von Pfeilen durchbohrt wurde. Die Rückseite zeigt den Patron der Schützen und Schutzheiligen gegen die Pest auf einer Wolke von mehreren Pfeilen durchbohrt vor einem Baumstumpf. Die Vorderseite zeigt den Wappenschild von zwei Bracken (Wappentier der Öttinger) gehalten. Darunter ist die Wertigkeit "X/EINE FEINE/MARCK" ("10 Sebastianstaler sollten aus der Gewichtsmark geschlagen werden") in einer Kartusche angegeben, die die Jahresangabe 1759 teilt. Es gibt auch typengleiche "Sebastiansgulden" zu 60 Kreuzern, die sich durch die Angabe "XX/EINE FEINE/MARCK" als Halbstücke des "Sebastianstalers" ausweisen. Sebastianstaler und -gulden zählen zu den letzten Prägungen des Geschlechts der Öttinger, die ihre Besitzungen (zwischen Donau und Main, Kerngebiet im Nördlinger Ries) zeitweise zum größten weltlichen Herrschaftsgebiet in Ostschwaben ausdehnen konnten. zurück Hierbei handelt es sich um ein römisches Pontifikalgerät, ein einschneidiges Opfermesser, mit dem der Priester die Stirnhaare des Opfertiers abschnitt. zurück Der "Sechsbätzner" zu 24 Kreuzern (6 Batzen) wurde seit dem beginnenden 17. Jh. im österreichischen und süddeutschen Raum geprägt. In der Kipper- und Wipperzeit (1619-1623) wurden sie in großen Mengen weit unter ihrem Nominalwert geprägt. Neben den Dreibätznern und den mitteldeutschen Schreckenbergern waren die verschlechterten Sechsbätzner die typischen Kippermünzen. zurück Dies ist die volkstümliche Bezeichnung für eine Reihe von Münzen, die das Sechsfache einer kleinen Münzeinheit darstellen, wie Sechspfennig-Stücke, Sechsbätzner und Sechsgröscher und Sechskreuzer. Letzterer wurde als Halbstück des Pfundners (zuerst auch Halbpfundner, später "Sechser" genannt) im Wert von 6 Kreuzern etwa zeitgleich mit dem Ganzstück um 1483 in Tirol unter Erzherzog Sigismund im Raugewicht von 3,19 g (Feingewicht ca. 2,99 g) eingeführt. Unter dessen Nachfolger (seit 1490) als Landesfürst von Tirol, dem späteren Kaiser Maximilian I. (1508-1519) erlangte der "Sechser" im ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jh. eine große Bedeutung für den Zahlungsverkehr. zurück Hierbei handelt es sich um eine polnisch-preußische Silbermünze, polnisch als Szostak bezeichnet. König Sigismund I. führte sie im Jahr 1526 im Gewicht von ca. 5,3 g (868/1000 fein) ein. Unter König Sigismund III. (1587-1632) verschlechterten sich die "Sechsgröscher", im Laufe des 17. und 18. Jh. wurden sie u.a. auch in Königsberg geprägt. Die letzten Dreigröscher um 1764/5 waren Billonmünzen im Gewicht von etwa 3,1 g (ca. 333/1000 fein). zurück Der "Sechshellergroschen" war eine sächsische Groschenmünze, die unter Kurfürst Friedrich II. und Landgraf Wilhelm III. von Thüringen zwischen 1444 und 1451 geprägt wurde. Drei "Sechshellergroschen" galten einen Groschen der sächsischen Oberwähr, 60 Stück gingen auf den rheinischen Gulden, demnach auch als neue Schockgroschen bezeichnet. zurück Der "Sechskreuzer" wurde als Halbstück des Pfundners (zuerst auch Halbpfundner, später Sechser genannt) im Wert von 6 Kreuzern etwa zeitgleich mit dem Ganzstück um 1483 in Tirol unter Erzherzog Sigismund im Raugewicht von 3,19 g (Feingewicht ca. 2,99 g) eingeführt. zurück Der "Sechsling" (niederdeutsch: Sösling oder Sesling) galt 6 Pfennige oder 1/2 Schilling und wurde seit dem beginnenden 15. Jh. als Billonmünze in Lübeck, Hamburg, Mecklenburg und Holstein geschlagen. Nach dem Hamburger Vertrag von 1622 gingen westlich der Elbe nach wie vor 64 Sechslinge auf einen Reichstaler, in den ostelbischen Gebieten entsprachen 96 Sechslinge dem Reichstaler. Die letzten "Sechslinge" prägte Hamburg 1855. zurück zurück zurück zurück Ein "Sechstelstück" ist eine Münze, die den sechsten Teil der "normalen" Münze ausmacht. zurück zurück 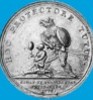 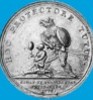 Dies ist die Bezeichnung für das Tagegeld, das in Bern an Ostern dem Wahlkollegium ausgezahlt wurde, das die oberste Behörde der Stadt wählte. Der Name entstand, weil sich der Wahlausschuß, außer den Mitgliedern des kleinen Rats, auch noch aus 16 gewählten Mitgliedern des großen Rats zusammensetzte, urkundlich erstmals 1485 erwähnt. Damals betrug das Tagegeld 4 Berner Plapparte (5 Schillinge), später 2 Batzen (5 1/2 Schillinge), einen Dicken und einen Doppeldicken. Im Jahr 1666 kam erstmals der eigens geschaffene Sechzehnertaler zur Ausprägung. Das Münzbild zeigt meist das Berner Wappen (Bär) und zwei Arme mit Schwertern in den Händen. Dies ist die Bezeichnung für das Tagegeld, das in Bern an Ostern dem Wahlkollegium ausgezahlt wurde, das die oberste Behörde der Stadt wählte. Der Name entstand, weil sich der Wahlausschuß, außer den Mitgliedern des kleinen Rats, auch noch aus 16 gewählten Mitgliedern des großen Rats zusammensetzte, urkundlich erstmals 1485 erwähnt. Damals betrug das Tagegeld 4 Berner Plapparte (5 Schillinge), später 2 Batzen (5 1/2 Schillinge), einen Dicken und einen Doppeldicken. Im Jahr 1666 kam erstmals der eigens geschaffene Sechzehnertaler zur Ausprägung. Das Münzbild zeigt meist das Berner Wappen (Bär) und zwei Arme mit Schwertern in den Händen.zurück Im Jahr 1666 kam erstmals der eigens geschaffene "Sechzehnertaler" zur Ausprägung, der in der Tradition des Sechzehnerpfennigs stand. Das Münzbild zeigt meist das Berner Wappen (Bär) und zwei Arme mit Schwertern in den Händen. zurück Der "Sechzehnteltaler" ist eine Münze, die den Wert des sechzehnten Teiles eines ganzen Talers besitzt. Als Beispiel sei hier der nach 1623 ausgebrachte Sechzehnteltaler des Wendischen Münzvereins genannt. zurück Als "Securis" wurde in Rom das Liktorenbeil bezeichnet, mit dem zur Zeit der Römischen Republik die Strafe der Enthauptung vollzogen wurde. Zur römischen Kaiserzeit trat das Schwert an dessen Stelle. Daneben gab es auch noch das Pontifikalgerät, ein einschneidiges Opferbeil, das zum Töten der geopferten Tiere diente. zurück   Die Securitas gilt als römische Personifikation der Sicherheit des römischen Volkes. Sie wurde auf Münzen der römischen Kaiserzeit vor allem mit den Attributen Stab, Lanze, Füllhorn und Palmzweig dargestellt. Als sitzende Figur stützt sie meist den Kopf mit dem Arm ab. Als stehende Figur ist sie oft an eine Säule angelehnt dargestellt. Die Securitas gilt als römische Personifikation der Sicherheit des römischen Volkes. Sie wurde auf Münzen der römischen Kaiserzeit vor allem mit den Attributen Stab, Lanze, Füllhorn und Palmzweig dargestellt. Als sitzende Figur stützt sie meist den Kopf mit dem Arm ab. Als stehende Figur ist sie oft an eine Säule angelehnt dargestellt.zurück Englisch für Sicherheitsrand. zurück  "Sedisvakanzmünzen" wurden von bestimmten Verwaltern in der Interrimszeit zwischen dem Tod eines geistlichen Münzherren und der Wahl eines neuen Amtsinhabers geprägt. Im Vatikan wurde die zeitlich begrenzte Prägeberechtigung in der Regel durch die Kardinalkämmerer, in Deutschland durch die Stifts- und Domkapitulare wahrgenommen. Sedisvakanzmünzen sind oft an der Beschriftung "SEDE VACANTE" oder ähnlichen Hinweisen zu erkennen. Sie wurden nur selten aus einem finanziellen Bedürfnis heraus geprägt, sondern stellten für die Prägeberechtigten eine oft willkommene Gelegenheit dar, ihre temporäre Souveränität und Bedeutung auszudrücken. Die Münzen sind deshalb oft besonders dekorativ gestaltet und sorgfältig gearbeitet.
Die bekanntesten "Sedisvakanzmünzen" sind die des Kirchenstaates bzw. des Vatikans, die von vielen Sammlern weltweit sehr begehrt sind. "Sedisvakanzmünzen" wurden von bestimmten Verwaltern in der Interrimszeit zwischen dem Tod eines geistlichen Münzherren und der Wahl eines neuen Amtsinhabers geprägt. Im Vatikan wurde die zeitlich begrenzte Prägeberechtigung in der Regel durch die Kardinalkämmerer, in Deutschland durch die Stifts- und Domkapitulare wahrgenommen. Sedisvakanzmünzen sind oft an der Beschriftung "SEDE VACANTE" oder ähnlichen Hinweisen zu erkennen. Sie wurden nur selten aus einem finanziellen Bedürfnis heraus geprägt, sondern stellten für die Prägeberechtigten eine oft willkommene Gelegenheit dar, ihre temporäre Souveränität und Bedeutung auszudrücken. Die Münzen sind deshalb oft besonders dekorativ gestaltet und sorgfältig gearbeitet.
Die bekanntesten "Sedisvakanzmünzen" sind die des Kirchenstaates bzw. des Vatikans, die von vielen Sammlern weltweit sehr begehrt sind.Bei den deutschen Sedisvakanzmünzen handelte es sich meist um Taler, deren Teilstücke und Vielfachstücke. Ihre Münzbilder zeigen oft Stiftsheilige, andere religiöse Darstellungen, Ansichten von Kirchengebäuden oder Wappen. Wenn Art und Umfang der Prägung von Stiften oder Abteien die Ausgabe von regulären Sedisvakanzmünzen als nicht sinnvoll erscheinen ließen, wurden Schaumünzen und Medaillen geschlagen (vor allem im 18. Jh.). Mit der Säkularisation geistlicher Güter verloren die letzten Fürstbischöfe im beginnenden 19. Jh. das Münzrecht (Reichsdeputationshauptschluß). Eine der letzten deutschen Sedisvakanzprägungen stellen Taler (Speciestaler, 2/3- und 1/3-Reichstaler) von 1801 des Hochstiftes Münster dar, die auf den Rückseiten Karl den Großen mit Schwert und Reichsapfel zeigen. Die vorläufig letzten Sedisvakanzmünzen des Vatikans erschienen 1978, als es - auf Grund der kurzen Amtszeit von Papst Johannes Pauls I. (26.8.1978-18.9.1978) - zu zwei Sedisvakanzprägungen durch Kardinal Jean Villot kam: Die 500-Lire-Stücke zeigen auf den Rückseiten die Taube des Heiligen Geistes und auf den Vorderseiten das Wappen des Kardinals und die römische Jahreszahl. Die Münzen der Sedisvakanz II sind mit dem Zusatz "SEPTEMBER" versehen. zurück Lateinisch für Sitten. zurück Nicolas Seeländer (geb. ca. 1683 in Erfurt; gest. ???) war Medailleur und Kupferstecher. Im Jahre 1716 kam er auf Bitten von Leibniz als Kupferstecher an die kurhannoversche Bibliothek. Dort illustrierte er das Werk von Leibniz über die Geschichte der Welfen (Origines Guelficae) und stach 151 Kupfertafeln der Welfenmünzen des Abtes Molan, dessen Münzen die Grundlage der von dem Numismatiker Eduard Fiala beschriebenen Sammlung der Könige von Hannover bildete. Numismatische Berühmtheit erlangte Seeländer als Fälscher durch sein 1743 veröffentlichtes Werk "Zehen Schriften von Teutschen Münzen mittlerer Zeiten". Diese Schriften auf dem noch jungen Gebiet der Brakteatenforschung enthielten eine Reihe von Zeichnungen von Brakteaten, die hundert Jahre später als falsche Brakteaten enttarnt wurden. Ungeklärt ist dabei, ob es sich um beabsichtigte oder unbeabsichtigte Irrtümer des Autodidakten handelt. Jedenfalls ging Seeländer durch die nach diesen Zeichnungen gefertigten falschen Brakteaten, die er auch verkaufte, als "Münzfälscher" in die Geschichte der Numismatik ein. zurück Alternative Bezeichnung für Kissi-Penny. zurück Dänisch für "Stempel" (englisch: cancel, französisch: oblitération, italienisch: timbro, niederländisch: stempel, portugiesisch: carimbo, spanisch: sello). zurück Italienisch für "Zeichen" (dänisch: tegn, englisch: mark bzw. sign, französisch: signe, niederländisch: teken, portugiesisch: sinal, spanisch: signo). zurück Segovia war königlich-spanische Münzstätte seit dem Jahr 1497. 1586 erhielt sie auf Veranlassung Phillips II. die ersten mechanischen Einrichtungen. Die von dort stammenden Prägungen nennt man Monedas de molino. Die Maschinen und Arbeiter kamen damals aus Augsburg. Das Münzzeichen von Segovia war ein Aquädukt. zurück Dies ist die Bezeichnung für normale Abnutzungserscheinungen an den höchsten Stellen des Reliefs und der Legende. Die numismatische Abkürzung lautet "ss" (englisch: very fine, französisch: très beau, italienisch: bellissimo, niederländisch: zeer frai, spanisch: muy bien conservado). zurück Alternative Bezeichnung für Sycee-Silber. zurück Alternative Schreibweise für saigern. zurück Französisch für "Schlagschatz" (englisch: Seignorage, italienisch: Signoraggio, den Gewinnanspruches der Münzherren an der Prägung. Der "Seigneuriage" sank in Frankreich zu Gunsten einer höheren Besteuerung seit der unter König Franz (François) I. 1540 durchgeführten Münzreform zur Bedeutungslosigkeit herab. In Mailand schaffte das Edikt des Galeazzo Maria Sforza schon 1474 den Schlagschatz ab. Anders verfuhr König Heinrich (Henry) VIII. von England, der zwischen 1544 und 1547 den Feingehalt der Goldmünzen bei gleichem Nominalwert um drei Karat (von 958 auf 833 Promille) verringerte. Bei den Silberprägungen war der Gewinn durch die Verringerung des Silbergehaltes noch beträchtlicher und vergrößerte den königlichen Schlagschatz erheblich. zurück zurück Beim "Seiseno" handelt es sich um eine kleine Kupfermünze zu 6 Dineros, die von den aufständischen Katalanen, dem spanischen König Philipp IV. und französischen Königen (Ludwig XIII. und XIV.), zwischen 1640 und 1652 ausgegeben wurden. Ursprünglich wurden schon spätmittelalterliche katalanische Silbermünzen zu 6 Dineros, die als Teilstücke des Croat ausgeprägt wurden, als "Seisenos" bezeichnet. zurück Dies ist die spiegelverkehrte Wiedergabe der Originalzeichnung (englisch: reverse, französisch: inverte). zurück ISO-4217-Code für die Schwedische Krone. zurück Zusammenfassende Bezeichnung für Arbeitsgemeinschaften oder sonstige Unterorganisationen eines Verbandes. Früher auch übliche Bezeichnung für die örtliche Organisation eines großen Vereins oder Verbands. zurück Selangor gehörte zu den malaiischen Staaten. zurück Deutsche Bezeichnung für einen altgriechischen Autokrator. zurück Die Seldschuken (1040–1194) waren eine türkische Fürstendynastie, die das Reich der Großseldschuken begründete, das sich über Mittelasien, den Iran, Irak, Syrien, Anatolien und Teile der arabischen Halbinsel erstreckte. Einige Seldschuken-Fürsten beherrschten das gesamte Großseldschukenreich, andere Teilgebiete wie Kerman und Syrien (bis zum Anfang des 12. Jh.) oder Anatolien (Sultanat von Rum bis zum Anfang des 14. Jh.). Die Seldschuken waren sunnitische Muslime und leiteten mit ihrem Sieg in der Schlacht von Manzikert im Jahr 1071 die türkische Landnahme Anatoliens ein. zurück Selene ist die griechische Mondgöttin, deren Büste oder Kopfbild auf griechischen Geprägen meist zusammen mit einer Mondsichel dargestellt ist. Ihre römische Entsprechung ist Luna. zurück 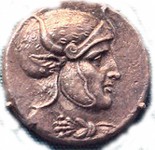 Das &&Seleukidenreich&& (305–129 v.Chr.) gehörte zu den Diadochenstaaten, die sich nach dem Tod Alexanders des Großen gebildet hatten. Während des 3. und 2. Jh. v.Chr. beherrschte das Reich den Vorderen Orient und erstreckte sich in seiner größten Ausdehnung vom europäischen Thrakien bis zum Industal auf dem Territorium der heutigen Staaten Türkei, Syrien, Libanon, Irak, Kuwait, Iran, Afghanistan, Armenien, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Israel und Palästina. Das &&Seleukidenreich&& (305–129 v.Chr.) gehörte zu den Diadochenstaaten, die sich nach dem Tod Alexanders des Großen gebildet hatten. Während des 3. und 2. Jh. v.Chr. beherrschte das Reich den Vorderen Orient und erstreckte sich in seiner größten Ausdehnung vom europäischen Thrakien bis zum Industal auf dem Territorium der heutigen Staaten Türkei, Syrien, Libanon, Irak, Kuwait, Iran, Afghanistan, Armenien, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Israel und Palästina.Nach dem Tod Alexanders kam es zu den so genannten Diadochenkriegen. In diesen setzte sich im Osten ein Weggefährte Alexanders, Seleukos I. durch. Der Iran war während des Hellenismus jedoch nur teilweise und unvollständig unter der Kontrolle der Seleukiden. Dies war zum einen der Größe des Raumes, andererseits der geringen Anzahl von Griechen bzw. Makedonen geschuldet, die diese Region kontrollieren mußten. Die Seleukiden auch eine gezielte Urbanisierungspolitik, vor allem in Syrien und Mesopotamien. Die ersten Zerfallserscheinungen traten mit dem Abfall Baktriens (ca. 256 oder 240 v.Chr.) auf. So beschränkten die Seleukiden ihre Herrschaft auf den westlichen Teil des heutigen Irans sowie auf Mesopotamien, Syrien und Kleinasien. Im Osten traten in dieses Machtvakuum die Parther, die um 240 v. Chr. den Nordosten des Irans in Besitz nahmen. Antiochos III. versuchte noch durch seine berühmte "Anabasis" (deutsch: „Hinaufmarsch“; gemeint ist ein Feldzug in die Oberen Satrapien, der von etwa 212 bis 205/04 v.Chr. dauerte), diese Regionen wieder unter die Oberhoheit der Zentralregierung zu zwingen, musste sich jedoch letztendlich mit einer formalen Oberherrschaft zufrieden geben. In den nächsten Jahrzehnten (zw. 141–138 v.Chr.) verloren die Seleukiden, bedingt durch interne Auflösungserscheinungen ihres Staates und stärkeres Engagement im Westen gegen das Römische Reich und seine Verbündeten, fast sämtliche östlichen Territorien. Antiochos VII. trat den Parthern noch einmal kraftvoll entgegen, doch fiel er nach ersten Anfangserfolgen im Jahr 129 v.Chr. im Kampf gegen sie. Mit dem darauffolgenden endgültigen Verlust Mesopotamiens ging auch die östliche Residenzstadt der Seleukiden, Seleukeia am Tigris, an die Parther verloren, womit die Seleukiden auf ihre westlichen Randbesitzungen mit dem Zentrum im heutigen Syrien beschränkt wurden. zurück   Die Seleukiden waren eine Diadochendynastie in Vorderasien, die nach dem Gründer des Seleukidenreichs Seleukos I. "Nikator" (geb. 358/354, ermordet 281 v.Chr.) benannt wurde, der einer vornehmen Makedonenfamilie entstammte. Er beteiligte sich am Asienzug Alexanders des Großen und erhielt bei der Aufteilung des Erbes nach dessen Tod die Satrapie Babylon. Von dem Diadochen Antigonos I. vertrieben, floh er 316 v.Chr. zu Ptolemaios I., mit dessen Hilfe er nach 312 v.Chr. nach Babylonien zurückkehren und die vorläufige Hauptstadt Seleukeia (am Tigris) gründen konnte. Die Seleukiden waren eine Diadochendynastie in Vorderasien, die nach dem Gründer des Seleukidenreichs Seleukos I. "Nikator" (geb. 358/354, ermordet 281 v.Chr.) benannt wurde, der einer vornehmen Makedonenfamilie entstammte. Er beteiligte sich am Asienzug Alexanders des Großen und erhielt bei der Aufteilung des Erbes nach dessen Tod die Satrapie Babylon. Von dem Diadochen Antigonos I. vertrieben, floh er 316 v.Chr. zu Ptolemaios I., mit dessen Hilfe er nach 312 v.Chr. nach Babylonien zurückkehren und die vorläufige Hauptstadt Seleukeia (am Tigris) gründen konnte.Zwischen 311 und 304 v.Chr. dehnte sich seine Herrschaft nach Osten bis zum Indus aus. Um 305 v.Chr. nahm er den Königstitel an und begann später den Herrscherkult aufzubauen, nach dem der König als Gott verehrt wurde. Danach wandte er sich nach Westen und gewann 301 v.Chr. Syrien, jedoch ohne Koilesyrien, das (neben Phönizien) zum Zankapfel mit den Ptolemäern wurde. Der Schwerpunkt des Reiches verlagerte sich seitdem nach Nordsyrien mit der Hautstadt Antiochia (heute Antakya), die Seleukos I. um 300 v.Chr. am Orontes gründete. Im Jahr 298 v.Chr. heiratete er - ohne sich von seiner ersten Frau Apame zu trennen - Stratonike, die Tochter des Antigoniden Demetrios I. "Poliorketes", den Seleukos I. 285 v.Chr. in Gefangenschaft setzte. Nach dessen Tod vermählte er Stratonike 283 v.Chr. mit seinem Sohn und Mitregenten Antiochos I. "Soter". Nach der Eroberung großer Teile West- und Süd-Kleinasiens erreichte das Seleukidenreich seine größte Ausdehnung. Mit Ausnahme Ägyptens, Thrakiens und Makedoniens war der Großteil des Erbes des Alexanderreiches an Seleukos I. gefallen. Beim Versuch Thrakien und Makedonien zu erobern, wurde er von Ptolemaios Keraunos 281 v.Chr. ermordet. Der Reichsgründer Seleukos ließ zunächst Münzen nach dem Vorbild Alexanders des Großen prägen, die meist Alexander, griechische Götter und Heroen zeigen. Seleukos I. gab eine breit angelegte Reihe von Bronzemünzen heraus. Diese sind in ihrer Vielfalt nur mit den später unter Antiochos IV. (175-164 v.Chr.) und den in der kurzen Regierungszeit unter Alexander I. "Balas" (150-145 v.Chr.) ausgegebenen Münzen vergleichbar. Eine Besonderheit der Bronzeprägung sind dicke, gezahnte Münzen mit einem sägeähnlichen Rand, die im 2. Jh. v. Chr. ausgebracht wurden. Goldmünzen kommen bei den Seleukiden seltener vor. Die Darstellung eines mit Horn und Zügel versehenen Pferdekopfes zeigen schon silberne Drachmen unter Seleukos I. Das Pferdekopfmotiv ist auch auf Münzen seines Sohnes und Nachfolgers Antiochos I. zu sehen, u.a. als Rückseitendarstellung auf Prägungen, die er zu Ehren seines Vaters ausgab. Die Vorderseiten zeigen das Porträt seines Vorgängers mit einem Horn über dem Ohr als Zeichen seiner Göttlichkeit. Auffallend oft finden sich seit Antiochos I. Darstellungen des Gottes Apollon (meist unbekleidet mit Pfeil oder Bogen als Attribute) als stehende Figur, auf einem Omphalos (hl. Stein von Delphi) sitzend oder als Kopfbild. Das Geschlecht der Seleukiden führte seine Abstammung auf Apollon zurück. Unter Antiochos I. erscheint auch zum ersten Mal das eigene Porträt mit Diadem um den Kopf. Schöne Herrscherporträts sind typisch für die Prägung der Seleukiden und wurden als Meisterleistungen der hellenistischen Kunst gewürdigt. Später zeigen einige Porträtdarstellungen König und Königin gemeinschaftlich (u.a. Demetrios I. und Laodike, Kleopatra I. und Antiochos VIII.). Die Münzen der Seleukiden kommen aus verschiedenen Münzstätten, die sich u.a. durch ihre Rückseiten unterscheiden. Die Stücke sind teilweise nach der seleukidischen Ära datiert, die im Jahr 312 v.Chr. begann. Die Münzen der letzten Seleukiden lassen in Gestaltung und Stil nach und sind auch im Feingehalt verringert. zurück Selge war eine antike Stadt in der kleinasiatischen Landschaft Pisidien in der heutigen Türkei. Der Überlieferung nach soll Selge nach dem Krieg um Troja durch den Seher Kalchas gegründet und durch Griechen aus Sparta besiedelt worden sein. Auf Münzen ist der Ort seit dem 5. Jh. v.Chr. nachweisbar. Politisch bestanden zu Aspendos gute Beziehungen. Als Alexander der Große durch Kleinasien zog, verbündete sich die Stadt mit ihm. 25 v.Chr. verlor Selge die Selbstständigkeit und wurde in die römische Provinz Galatien eingegliedert. Seine größte Blüte erreichte Selge in der Römischen Kaiserzeit. Im Jahr 339 kam es zu einer erfolglosen Belagerung durch die Goten. In byzantinischer Zeit war Selge Bischofssitz. Die Stadt wurde später in seldschukischer Zeit aufgegeben. zurück Beim "Seligkeitstaler" handelt es sich um eine beidseitig beschriftete Talermünze, die Herzog Ernst von Sachsen-Gotha (1640-1675) im Jahr 1672 verausgabte. Die Vorderseite zeigt eine elfzeilige und die Rückseite eine zehnzeilige Inschrift. zurück Das antike Selinus war eine griechische Stadt im Süden Siziliens. Sie besaß - neben Himera - die älteste Münzstätte der Insel. zurück Spanisch für "Siegel" (englisch: seal, französisch: cachet de cire bzw. sceau, italienisch: timbro, portugiesisch: carimbo). Spanisch für "Stempel" (dänisch: segl, englisch: cancel, französisch: oblitération, italienisch: timbro, niederländisch: stempel, portugiesisch: carimbo). zurück Allgemeine Bezeichnung für etwas, was nicht häufig vorkommt und deshalb rar, sowie häufig auch recht teuer ist (dänisch: sjaelden, englisch und französisch: rare, sowie englisch: scare, italienisch, portugiesisch und spanisch: raro, niederländisch: zeldzaam). zurück Französisch für ähnlich. zurück zurück Der "Semilibralfuß" (vom lateinischen Wort "semi libra" = 1/2 Pfund abgeleitet) ist eine Reduktionsstufe des Aes grave der Römischen Republik. Der As wurde nur noch im (reduzierten) Gewicht eines halben römischen Pfundes (Libra) ausgebracht. Der reduzierte As schwankte im Gewicht etwa zwischen 160 und 132 g. Mit der Verminderung des Gewichts der Asses wurden auch die anderen Wertstufen der römischen Bronzemünzen im Gewicht auf den "Semilibralfuß" (englisch: Semilibral Standard) gebracht. Die Gewichtsverringerung erlaubte die Herstellung der kleinen Werte (Sextans und Uncia) im Prägeverfahren, während die höheren Werte weiterhin im aufwendigeren Gußverfahren hergestellt werden mußten. Der genaue Zeitpunkt der Umstellung auf den Semilibralfuß ist nicht gesichert. In der neueren numismatischen Literatur wird die Einführung des Semilibralfußes meist in die (ausgehenden) 20er Jahre des 3. Jh. v.Chr. datiert. Der Gewichtsstandard hatte nicht lange Bestand, denn bald wurden die Bronzemünzen im Gewicht weiter reduziert. zurück Englisch für Semilibralfuß. zurück Mit "Semis" (vom lateinischen Wort "semi as" = 1/2 As abgeleitet) bezeichnet man den halben Wert des römischen As. Bei der Teilung des Duodezimalsystems (1 As = 12 Unciae) der Bronzeprägung in der Zeit der Römischen Republik war der Wert des "Semis" 6 Unciae. Der "Semis" wurde in allen Reduktionsstufen ausgegeben, ursprünglich als gegossene Münze des Aes grave, zuletzt als geprägte Bronzemünzen. Die Stücke sind meist mit dem Wertzeichen "S" versehen. Sie zeigen auf den Vorderseiten das Kopfbild des Jupiter oder Saturn und auf den Rückseiten die Prora. Zur Römischen Kaiserzeit wird der Semis unter den Kaisern Augustus und Nero als kleine Bronzemünze zu 1/2 As im Durchmesser von 18 bis 19 mm geprägt. Die Vorderseiten zeigen das Porträt des Herrschers und die Rückseiten Altar, Spieltisch und andere Darstellungen sowie im Abschnitt "SC", teilweise auch noch das Wertzeichen "S" im Feld. Der "Semis" der Kaiserzeit wurde aber nur noch vereinzelt ausgebracht und durch den Quadrans ersetzt. Im 4. Jh. n.Chr. wird der Ausdruck "Semissis" gebräuchlich, der sich aber auf das Halbstück des neu geschaffenen goldenen Solidus bezieht und nicht mit dem "Semis" verwechselt werden darf. zurück Der "Semissis" war das Halbstück des Straßburger Assis. Zum ersten Mal erscheint der Ausdruck "Semissis aureorum" in der Biographie des Kaisers Alexander Severus (222-235 n.Chr.) in der Bedeutung "die Hälfte des Aureus" belegt. Seit konstantinischer Zeit wurde die Münzbezeichnung "Semissis" für das Halbstück (1/144 römisches Pfund) des Solidus (1/72 Pfund) gebräuchlich, der unter Kaiser Konstantin I. als Standardgoldmünze des spätrömischen Reichs eingeführt wurde. Die "Semisses" zeigen meist auf den Vorderseiten die Büsten der Kaiser und auf den Rückseiten die geflügelte Victoria, die auf ein Schild ("VOT X...") schreibt. Auch im frühen Byzantinischen Reich wurde das Halbstück des Solidus noch geprägt. zurück Der Ausdruck "Semissis aureorum" taucht erstmals in der Biographie des Kaisers Alexander Severus (222-235 n.Chr.) auf und bedeutet soviel wie "die Hälfte des Aureus", denn der Semissis war ein Halbstück des Solidus. zurück Der "Semiuncialfuß" entstand, als der Uncialfuß (27,3 g) und somit der der As auf 13,6 g ausgebracht wurde. zurück "Semuncia" (abgeleitet vom lateinischen Wort "semi uncia" = 1/2 Uncia) bezeichnet den Wert einer halben Uncia (1/24 As). Ursprünglich war die "Semuncia" eine kleine und selten gegossene Wertstufe des Aes grave der Römischen Republik. Sie wurde nicht in allen Aes-grave-Reihen zwischen ca. 269 bis 222 v.Chr. gegossen. Ihr typisches Münzbild zeigt die Eichel und das griechische Zeichen für Sigma (auch spiegelverkehrt). Im Zuge der Reduktionen des As wurden die nach 222 v.Chr. erscheinenden Semunciae nicht mehr gegossen, sondern geprägt. Sie zeigen verschiedene Münzbilder, oft auf den Vorderseiten das Kopfbild des Merkur und auf den Rückseiten die Prora. Nach 180 v.Chr. wurden keine Semunciae mehr geprägt. zurück Mehrzahl von Semuncia. zurück Der "Sen" ist Teil des japanischen Münzsystems, wobei 1 Yen = 10 Rin = 100 Sen zählt. Mit dem im Jahr 1870 unter Kaiser Mitsuhito (1868-1812) in Japan eingeführten modernen Münzsystem wurde der "Sen" erstmals als Münzeinheit eingeführt. Die einfachen (und halben) "Sen" wurden seit 1873 in Kupfer geprägt. Mehrfachstücke zu 5, 10, 20 und 50 Sen wurden seit 1870/71 zunächst als Silbermünzen ausgemünzt, später nach und nach auch in unedlen Metallen. Schon seit einigen Jahrhunderten wurden auch gegossene Lochmünzen als "Sen" bezeichnet. Der Ausdruck bedeutete im alten Japan "Münze" oder "Geld" schlechthin. zurück  Der &&Senegal&& (französisch: République du Sénégal) ist ein Staat in Westafrika am Atlantik. Senegal liegt im äußersten Westen Afrikas. Es liegt im Übergang der Sahelzone zu den Tropen. Östliches Nachbarland ist Mali. Im Norden grenzt Senegal mit dem Grenzfluß Senegal an Mauretanien und im Süden an Guinea und Guinea-Bissau. Senegal umschließt das ebenfalls am Atlantik liegende Gambia vollständig. Der &&Senegal&& (französisch: République du Sénégal) ist ein Staat in Westafrika am Atlantik. Senegal liegt im äußersten Westen Afrikas. Es liegt im Übergang der Sahelzone zu den Tropen. Östliches Nachbarland ist Mali. Im Norden grenzt Senegal mit dem Grenzfluß Senegal an Mauretanien und im Süden an Guinea und Guinea-Bissau. Senegal umschließt das ebenfalls am Atlantik liegende Gambia vollständig.Das Land war französische Kolonie, die ab 1944 postalisch zu Französisch-Westafrika gehörte. Am 17.01.1959 wurde es zusammen mit Französisch-Sudan zur Föderation Mali vereinigt, trat aber am 20.08.1960 aus der Föderation wieder aus und wurde dann eigenständige Republik. Amtssprache: Französisch Hauptstadt: Dakar Staatsform: Präsidialrepublik Fläche: 197.722 qkm Einwohnerzahl: 11,126 Mio. (2005) Bevölkerungsdichte: 56 Einwohner pro qkm Unabhängigkeit von Frankreich: 20.08.1960 Zeitzone: UTC Währung: CFA-Franc BCEAO zurück "Seniti" ist die kleine Münzeinheit von Tonga seit dem Jahr 1967. Es gelten 100 Seniti (Cents) = 1 Pa'anga. zurück Abkürzung für "senkrecht" in der deutschsprachigen numismatischen Literatur. zurück Bezeichnung für eine vertikale, in einem Winkel von 90 Grad von oben nach unten verlaufende Linie (englisch und französisch: vertical). zurück Die "Senkung von Transaktionskosten" gehört zu den Zielen der Währungspolitik. Es gibt zwei Arten von Transaktionskosten, die durch eine währungspolitische Strategie gesenkt werden können. Wirtschaftssubjekte müssen sich weniger gegen Wechselkursschwankungen absichern und sie können ggf. zu geringeren Kosten umtauschen: - Erreichen einer hohen Wettbewerbsfähigkeit: Während der Nutzen stabiler Wechselkurse in einer Senkung der Inflation besteht, können auch Auf- oder Abwertungen einen Nutzen für die Volkswirtschaft generieren. Wertet eine Währung ab, so macht dies inländische Produkte im Ausland billiger (kompetitive Abwertung). Man spricht in einem solchen Fall von einer höheren Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft. - Erreichen einer hohen inländischen Kaufkraft: Während eine abwertende Währung ausländische Güter teurer macht, werden diese durch eine Aufwertung billiger, da man sich so zu einem bestehenden Vermögen mehr ausländische Güter kaufen kann. Dies kann u. a. für solche Länder von Bedeutung sein, die wichtige Güter importieren müssen (beispielsweise Rohstoffe oder Investitionsgüter). zurück Als "Senkverfahren" (auch: Umsenkverfahren) wird ein münztechnischer Vorgang bezeichnet, der zur Herstellung der negativen Matrize dient. Dabei wird die positive Patrize mittels einer hydraulischen Presse mit einem Druck von mehreren hundert Tonnen in einen ungehärteten Stahlpfropfen eingesenkt. Daraufhin kann die somit entstandene negative Matrize (Prägestempel) gehärtet werden. zurück Englisch für "empfindlich" (französisch: vulnerable). zurück Als "Sent" wurde die kleinste Münzeinheit der Republik Estland zwischen 1928 und 1940 bezeichnet und seit der Währungsreform am 20.06.1992 bis zur Einführung des Euro am 01.01.2011. Es gelten 100 Senti = 1 Kroon (Krone). Die kleinen Werte wurden von 1 Sent bis 5 Senti wurden zwischen 1929 und 1939 in Bronze, die größeren Werte (10 bis 50 Senti) in Nickel-Messing ausgeprägt. Nach Wiederaufnahme der Prägung der aus dem Staatsverband der Sowjetunion ausgetretenen unabhängigen Republik Estland (1991) wurden Werte zwischen 5 und 50 Senti in Aluminium-Nickel-Bronze ausgeprägt. zurück Mehrzahl von Sent. zurück "Sentimo" ist die Bezeichnung der kleinen Münzeinheit auf den Philippinen seit 1967. Es gelten 1 Piso (früher: Peso) = 100 Sentimos (früher: Centavos). zurück Spanisch für "gelbbraun" (dänisch: gulbrun, englisch: yellow-brown, französisch und portugiesisch: bistre, italienisch: bistro, niederländisch: geelbruin). zurück  Lucius Septimius Severus (geb. 11.04.146 in Leptis Magna; gest. 04.02.211 in Eboracum) war vom 09.04.193 bis zum 04.02.211 römischer Kaiser. Er begründete die Dynastie der Severer und war einer der Kaiser des zweiten Vierkaiserjahres. Geboren wurde er als Sohn des Publius Septimius Geta und der Fulvia Pia. Obwohl er nicht die militärische Laufbahn durchlaufen hatte, wurde er auf Grund der Fürsprache eines seiner Verwandten von Kaiser Marc Aurel in den Senatorenstand erhoben. 170 war er quaestor in Rom, im Jahr darauf in Sardinien, 173/174 legatus proconsulis provinciae Africae, 178 Praetor und schließlich Legat der Legio IV Scythica. Anschließend verbrachte er einige Zeit in Athen. 190 wurde er Suffektkonsul und erhielt im Jahr darauf von Kaiser Commodus den Befehl über die Legionen in der Provinz Pannonien. Lucius Septimius Severus (geb. 11.04.146 in Leptis Magna; gest. 04.02.211 in Eboracum) war vom 09.04.193 bis zum 04.02.211 römischer Kaiser. Er begründete die Dynastie der Severer und war einer der Kaiser des zweiten Vierkaiserjahres. Geboren wurde er als Sohn des Publius Septimius Geta und der Fulvia Pia. Obwohl er nicht die militärische Laufbahn durchlaufen hatte, wurde er auf Grund der Fürsprache eines seiner Verwandten von Kaiser Marc Aurel in den Senatorenstand erhoben. 170 war er quaestor in Rom, im Jahr darauf in Sardinien, 173/174 legatus proconsulis provinciae Africae, 178 Praetor und schließlich Legat der Legio IV Scythica. Anschließend verbrachte er einige Zeit in Athen. 190 wurde er Suffektkonsul und erhielt im Jahr darauf von Kaiser Commodus den Befehl über die Legionen in der Provinz Pannonien.Nach der Ermordung von Commodus' Nachfolger Pertinax in Rom am 28.03.193 wurde Severus in Carnuntum am 9. April von den pannonischen Truppen zum Kaiser ausgerufen. Die Herrschaft des Septimius Severus hat sich trotz mancher Schrecken für Senat und Christen insgesamt stabilisierend auf das Reich ausgewirkt. Er sicherte die Grenzen, die Provinzen und die Wirtschaft profitierten von der Ruhe im Reich. Die Verdrängung von Senatoren aus der Reichsführung war eher eine folgerichtige Maßnahme als eine wirkliche Neuerung. Die Ausschaltung des Senats und die Bevorzugung des Militärs brachte Septimius Severus in der damaligen Geschichtsschreibung einen schlechten Ruf ein. zurück Alternative Bezeichnung für den venezianischen Zecchimo im Nahen Osten. zurück Der "Serafiner-Orden" ist ein hoher schwedischer Orden, der 1260 durch König Magnus I. Ladulas gegründet wurde. Friedrich I. erneuerte ihn am 28.04.1748 und ließ zu diesem Anlaß die sog. Serafimer-Riksdaler prägen. zurück Dies ist die Bezeichnung der schwedischen Riksdalers (deutsch: Reichstaler) und deren Viertelstücke mit dem Datum vom 17.04.1748. Sie wurden auf die Erneuerung des schwedischen Serafimer-Ordens durch König Friedrich (Frederick) I. (1720-1751) geprägt. Die Vorderseite zeigt die Büste des Königs und die Rückseite das gekrönte Wappen (drei Kronen auf rundem schraffierten Feld), darum das Ordensband mit Collane und das Datum. Seitdem ist der Orden, der ursprünglich von König Magnus I. Ladulas (1260-1285) gestiftet worden sein soll, bis ins 20. Jh. auf schwedischen Münzen abgebildet. zurück   Serapis (auch: Sarapis) war eine griechisch-ägyptische Gottheit, den der Gründer der hellenistischen Dynastie der Ptolemäer in Ägypten, Ptolemaios I. "Soter" (323-285 v.Chr.), als Reichsgott einführte und der sich über die Grenzen des Ptolemäerreiches im hellenistischen Osten bis weit in die römische Kaiserzeit verbreitete. Der vielgestaltige pantheistische Allgott Serapis ist eine Verschmelzung aus dem altägyptischen Totengott Apis-Osiris (Hauptkultstätte Serapeum bei Memphis) und dem griechisch-hellenistischen Gott der Unterwelt (Zeus-Pluto), dessen Kultstatue von der Handelsstadt Sinope (Paphlagonien) am Schwarzen Meer nach Alexandria (Ägypten) gebracht wurde. Die Vielgestaltigkeit des Gottes zeigt sich vor allem auf römischen Provinzial- und Lokalprägungen im 2. und 3. Jh. n.Chr. im östlichen Mittelmeerraum, besonders im ägyptischen Alexandria. Dort ist er oft bärtig mit Polos und Zepter dargestellt und ähnelt Zeus. Andere Darstellungen zeigen ihn mit Füllhorn, Strahlenkrone usw. im Stil des Sonnengottes (Helios), des römischen Genius oder des Nilgottes dargestellt. Auch mit Isis (Schwester des Osiris) oder Cerberus (Höllenhund des Pluto) ist er dargestellt. Im ausgehenden 3. Jh. ging der Serapiskult zugunsten des aufkommenden Christentums zurück und flackerte nur noch unter Julianus II. "Apostatus" (355-363 n.Chr.) auf, der sich selbst u.a. als "DEO SERAPIDI" bezeichnete und eine Reihe von AE-Bronzen mit Darstellungen von Serapis, Isis (auch zusammen) und Apis ausgab. Serapis (auch: Sarapis) war eine griechisch-ägyptische Gottheit, den der Gründer der hellenistischen Dynastie der Ptolemäer in Ägypten, Ptolemaios I. "Soter" (323-285 v.Chr.), als Reichsgott einführte und der sich über die Grenzen des Ptolemäerreiches im hellenistischen Osten bis weit in die römische Kaiserzeit verbreitete. Der vielgestaltige pantheistische Allgott Serapis ist eine Verschmelzung aus dem altägyptischen Totengott Apis-Osiris (Hauptkultstätte Serapeum bei Memphis) und dem griechisch-hellenistischen Gott der Unterwelt (Zeus-Pluto), dessen Kultstatue von der Handelsstadt Sinope (Paphlagonien) am Schwarzen Meer nach Alexandria (Ägypten) gebracht wurde. Die Vielgestaltigkeit des Gottes zeigt sich vor allem auf römischen Provinzial- und Lokalprägungen im 2. und 3. Jh. n.Chr. im östlichen Mittelmeerraum, besonders im ägyptischen Alexandria. Dort ist er oft bärtig mit Polos und Zepter dargestellt und ähnelt Zeus. Andere Darstellungen zeigen ihn mit Füllhorn, Strahlenkrone usw. im Stil des Sonnengottes (Helios), des römischen Genius oder des Nilgottes dargestellt. Auch mit Isis (Schwester des Osiris) oder Cerberus (Höllenhund des Pluto) ist er dargestellt. Im ausgehenden 3. Jh. ging der Serapiskult zugunsten des aufkommenden Christentums zurück und flackerte nur noch unter Julianus II. "Apostatus" (355-363 n.Chr.) auf, der sich selbst u.a. als "DEO SERAPIDI" bezeichnete und eine Reihe von AE-Bronzen mit Darstellungen von Serapis, Isis (auch zusammen) und Apis ausgab.zurück  &&Serbien&& (serbisch: Srbija) ist ein Binnenstaat in Südosteuropa und ging aus dem ehemaligen Jugoslawien. Die offizielle Bezeichnung lautet Republik Serbien (Republika Srbija). Das Land liegt im Zentrum der Balkanhalbinsel und grenzt im Norden an Ungarn, im Osten an Rumänien und Bulgarien, im Süden an Mazedonien und Albanien, im Südwesten an Montenegro und im Westen an Bosnien und Herzegowina (Republika Srpska) und Kroatien. Die längste Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 500 km, die längste Ost-West-Ausdehnung 350 km. &&Serbien&& (serbisch: Srbija) ist ein Binnenstaat in Südosteuropa und ging aus dem ehemaligen Jugoslawien. Die offizielle Bezeichnung lautet Republik Serbien (Republika Srbija). Das Land liegt im Zentrum der Balkanhalbinsel und grenzt im Norden an Ungarn, im Osten an Rumänien und Bulgarien, im Süden an Mazedonien und Albanien, im Südwesten an Montenegro und im Westen an Bosnien und Herzegowina (Republika Srpska) und Kroatien. Die längste Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 500 km, die längste Ost-West-Ausdehnung 350 km.Zu Serbien gehört auch die autonome Provinz Vojvodina im Norden. Früher zählte auch der neuerdings selbständige Kosovo im Süden des Landes zu Serbien. Amtssprache: Serbisch (regional auch einige Minderheitensprachen) Hauptstadt: Belgrad (serbisch Beograd) Staatsform: Republik Fläche: 88.361 qkm Einwohnerzahl: 9.396.411 Bevölkerungsdichte: 106.34 Einwohner pro qkm Gründung: 15.02.1835 Nationalfeiertag: 15. Februar Zeitzone: UTC+1 MEZ UTC+2 MESZ (März - Oktober) Währung: Serbischer Dinar (RSD) 1 Dinar = 100 Para zurück Serbien und Montenegro (serbisch: Srbija i Crna Gora), auch genannt "Serbien-Montenegro", war ein Staat in Südosteuropa. Er existierte vom 04.02.2003 bis zum 03.06.2006 und bestand aus den Teilstaaten Serbien und Montenegro. Serbien-Montenegro ging aus dem früheren Bundesstaat (Rest-)Jugoslawien hervor. Es handelte sich um einen Bundesstaat stark staatenbündischer Ausprägung. Dies war begründet einerseits in der kontinuierlichen Auseinanderentwicklung Serbiens und Montenegros während der Zeit der Balkankriege in den 1990er Jahren, andererseits im Wunsch der EU (die die Bildung Serbien-Montenegros forcierte), nicht noch mehr Staaten auf dem Balkan entstehen zu lassen. Rechtsnachfolger ist die Republik Serbien. Amtssprache: Serbisch Hauptstadt: Belgrad Staatsform: Republik Fläche: 102.350 qkm Einwohnerzahl: 10.829.175 (Juli 2005) Bevölkerungsdichte: 105 Einwohner pro qkm Gründung: 27.04.1992 (BR Jugoslawien), 04.09.2003 (Serbien-Montenegro) Zeitzone: UTC+1 Währung: Serbien Dinar, Montenegro und Kosovo Euro zurück Die Republik &&Serbische Krajina&& (serbokroatisch: Republika Srpska Krajina, Abkürzung: RSK) war ein international nicht anerkanntes De-Facto-Regime, das in den Jahren 1991 bis 1995 ca. ein Drittel des Gebietes der Republik Kroatien kontrollierte. Die Republika Srpska Krajina stellt kein historisches geographisches Gebiet dar. Am 19.12.1991 wurde dieses Gebiet im Gegenzug zur Unabhängigkeitserklärung Kroatiens als von Kroatien unabhängiger Staat proklamiert. Zur Hauptstadt der Republika Srpska Krajina wurde Knin erklärt. 1992 schlossen sich der RSK auch die zu diesem Zeitpunkt serbisch kontrollierten Gebiete im Osten Slawoniens und der Baranja an. Das Ziel war die Vereinigung dieses Gebietes mit der Republika Srpska (Serbische Republik, heute eine der beiden Entitäten in Bosnien und Herzegowina) und der Bundesrepublik Jugoslawien zu einem gemeinsamen großserbischen Staat. Die kurze Geschichte der Serbenrepublik ist im Zusammenhang mit dem Kroatien-Krieg und den anderen Jugoslawien-Kriegen zu sehen und zu bewerten. Der Großteil des Territoriums der Republika Srpska Krajina wurde 1995 im Zuge der Operation Oluja durch die kroatische Armee erobert. Der restliche Teil des Gebietes in Ostslawonien wurde im Rahmen der UNTAES-Mission friedlich in Kroatien integriert. zurück Die &&Serbische Republik Bosnien-Herzegowina&& (serbokroatisch: Republika Srpska) ist nach dem Dayton-Vertrag neben der bosniakisch-kroatischen Föderation Bosnien und Herzegowina eine von zwei Entitäten (Teilrepubliken) des Staates Bosnien und Herzegowina. Sie wurde kurz vor Ausbruch des Bosnienkrieges errichtet. Der Sitz der Verwaltung ist seit 1998 Banja Luka. Währung ist der jugoslawische Dinar, ab 1994 der Neue Dinar und seit 1999 1 Mark = 100 Fening. zurück Der "Serbische Dinar" (ISO-4217-Code: RSD; Abkürzung: Din.) ist die Währung von Serbien. Es gilt 1 Dinar = 100 Para unterteilt, wobei es heutzutage keine gültigen Para-Münzen mehr gibt. Ein "Serbischer Dinar" wurde erstmals vom König Stefan Nemanjic ungefähr im Jahre 1214 eingeführt. Danach prägten serbische Könige und Fürsten bis zum Ende des mittelalterlichen Serbiens 1459 den Dinar. Neben dem Dinar gab es noch eine Unterwährung, den Perper. Der Perper war in der Regel eine Kupfermünzen und der Dinar eine Silbermünze. Eine eigene Münze war im Mittelalter an sich ein wichtiges Symbol der staatlichen Unabhängigkeit. Mit der osmanischen Eroberung wurden dann verschiedene Währungen bis zur Mitte des 19. Jh. verwendet. Die Osmanen betrieben mehrere Münzprägesätten in Serbien, so z. B. in Novo Brdo im Kosovo, Kucajna und in Belgrad. Im 19. Jh. waren im Fürstentum Serbien an die 43 verschiedenen Währungen in Umlauf (so etwa zehn Währungen in Gold, 28 in Silber und fünf in Kupfer). Mit dieser Vielzahl von Währungen konfrontiert ordnete Fürst Mihailo Obrenovic an, daß eine nationale serbische Währung geprägt werden sollte. Die neuen Münzen aus Kupfer wurden als "Para" benannt und im Wert von 1, 5 und 10 Para ausgegeben. Die Vorderseite trug das Porträt des Fürsten und das Jahr 1868 als Prägung. 1875 wurde schließlich der silberne Dinar (wieder)eingeführt. Der silberne Dinar hatte einen Wert von 100 Para. Geprägt wurden 1875 Silbermünzen zu 50 Para, 1 Dinar und 2 Dinar. Die ersten Goldmünzen wurden im Jahr 1879 im Wert von 20 Dinaren ausgegeben. Mit der Krönung des Fürsten Milan II. Obrenovic zum serbischen König wurde die Prägung von Goldmünzen 1882 neu reguliert, und es kam der Milan d'or (französisch; deutsch: goldener Milan) im Wert von 10 Dinaren bzw. 2 Milan d'or im Wert von 20 Dinaren. Der Milan d'or wurde später wieder aufgegeben und die nationale Währung rein auf den Dinar und die Para festgelegt. Diese blieben als nationale Währungen auch in Jugoslawien erhalten. Bis 1999 verwendeten beide Teilrepubliken der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) den Jugoslawischen Dinar. Dieser wurde in Montenegro 1999 durch die Deutsche Mark und 2002 durch den Euro ersetzt. Im Kosovo wurde wie in Montenegro von 1999 bis Ende 2001 die Deutsche Mark und seit 2002 der Euro verwendet. Es gibt Münzen zu 1, 2, 5, 10 und 20 Dinar jeweils in verschiedenen Metallen und mit verschiedenen Wappen sowie Staatsbezeichnungen ("Republika Srbija", "SR Jugoslavija"). Die 50-Para-Münze ist seit dem 01.1.2008 kein gesetzliches Zahlungmittel mehr. Die Unterteilung in Para ist somit praktisch bedeutungslos geworden. Seit dem 01.01.2009 sind auch die Münzen zu 1, 2 und 5 Dinar mit der Prägung "Jugoslawien" nicht mehr gültig. Banknoten gibt es zu 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000 und 5.000 Dinar. zurück "Serebrnik" ist die alte kirchenslawische Bezeichnung für den "Silberling" (Silbermünze) in den Übersetzungen der Evangelien. Es fiel schwer, die Bezeichnung, einem bestimmten Münztyp zuzuweisen. Die Numismatik ist übereingekommen, diejenigen seltenen altrussischen Silbermünzen als Serebrniki zu bezeichnen, die zur Zeit des Großfürsten von Kiew, Wladimir dem Heiligen (978-1015 n.Chr.) und seinen Söhnen Jaroslaw (bis 1054) und Swatopolk (bis 1016) ausgegeben wurden. Es handelt sich um verschiedene Typen, meist barbarisierte Nachahmungen byzantinischer Vorbild, die im Gewicht sehr schwanken (etwa zwischen 1,7 und 4,7 g). Auf den Vorderseiten ist meist das Bildnis des Großfürsten zu sehen und auf den Rückseiten finden sich unbekannte Zeichen und die Schrift. zurück Mehrzahl von Serebrnik. zurück Numismatischer Begriff für eine Reihe von Münzen oder Medaillen, die über einen längeren Zeitraum zu einem gemeinsamen Ausgabeanlaß erscheinen (dänisch, italienisch, niederländisch und spanisch: serie, englisch: series, französisch und portugiesisch: série). zurück Französisch und portugiesisch für "Serie" (dänisch, italienisch, niederländisch und spanisch: serie, englisch: series). zurück Unter dem Begriff "Serienmedaillen" versteht man eine Serie von Medaillen zu einer bestimmten Thematik, wie z. B. über berühmte Künstler, Politiker oder Baudenkmäler, die besonders in jüngster Zeit hergestellt werden. Medaillen einer Serie gab es auch schon früher, wie z. B. die sog. Suiten-Medaillen im 18. und 19. Jh. vor allem in Frankreich. Die einzelnen Stücke einer Serie haben meist einheitliche Größe und Ausführung und sind größtenteils aus Bronze hergestellt. Der Vertrieb von Serienmedaillen zielt auf die bei den Sammlern ausgeprägte Leidenschaft, eine Serie vollständig oder komplett besitzen zu wollen. zurück Englisch für "Serie" (dänisch, italienisch, niederländisch und spanisch: serie, französisch und portugiesisch: série). zurück Englisch für "Serife" (französisch: empattement). zurück Dies ist ein waagerechter, geradliniger oder gekehlter Fußstrich an Buchstaben verschiedener Schriften (englisch: serif, französisch: empattement). zurück Dies ist die Bezeichnung für die am Rand sägeartig gezackt ausgeschnittenen römischen Denare aus der Zeit der Römischen Republik, die im Zeitraum von etwa hundert Jahren seit der Mitte des 2. Jh. v.Chr. hergestellt wurden. Nach Fertigung der Schrötlinge wurden die von den Römern als "nummi serrati" (lateinsch: "serratus", deutsch: "gesägt" bzw. "gezackt") bezeichneten Stücke noch vor der Prägung an den Münzrändern eingeschnitten. Zur Erklärung der arbeitsaufwendigen Herstellung der Serrati wird meist angeführt, die Einschnitte zeigten, daß es sich um Münzen handle, die nicht mit unedlen Metallen gefüttert seien. Diesen Grund gibt der römische Historiker Tacitus in der "Germania" an, um die Vorliebe der Germanen für die "Serrati" zu begründen. Diesem naheliegenden Argument steht die Tatsache gegenüber, daß es auch gefütterte "Serrati" gibt. Abgesehen von wenigen Ausnahmen waren die Typen der Serrati und die normalen Denare nicht identisch. Schon vor den römischen Serrati, etwa um 200 v.Chr., gaben die Karthager gezackt ausgeschnittene Münzen aus Elektron aus. Die dicken Bronzemünzen der Seleukiden im 2. Jh. v.Chr. waren bereits mit gezacktem Rand. zurück Hierbei handelt es sich um eine Goldmünze des Bhutan zu 100 Ngultrum (Rupien) seit 1966. Es gibt auch Mehrfachstücke (2- und 5-fache Stücke). zurück Mehrzahl von Sesino. zurück Beim "Sesino" handelt es sich um eine kleine italienische Münze zu 6 Denari oder 1/2 Soldo, die zwischen dem 14. und 18. Jh. in verschiedenen Orten Italiens aus Billon oder Kupfer geprägt wurden. Der "Sesino" lief im 14. Jh. in Genua, Mailand und Perugia um. Auch die Päpste prägten Sesini in Avignon und später in Parma. Die letzten Sesini wurden in den 90er Jahren des 18. Jh. in Mantua und Parma ausgegeben. zurück Niederdeutsch für Sechsling. zurück Lateinisch für Sesterz. zurück  Der "Sesterz" (lateinisch: Sestertius, abgeleitet von "semis tertius" = deutsch: Dritthalber = 2 1/2) war eine Münze, die es sowohl zur Zeit der Römischen Republik, als auch zur Römischen Kaiserzeit gab. Der Sesterz wurde ursprünglich als Silbermünze zu 2 1/2 Asse zusammen mit dem Denar (10 Asses) und dem Quinar (5 Asses) um 211 v.Chr. eingeführt. Der "Sesterz" (lateinisch: Sestertius, abgeleitet von "semis tertius" = deutsch: Dritthalber = 2 1/2) war eine Münze, die es sowohl zur Zeit der Römischen Republik, als auch zur Römischen Kaiserzeit gab. Der Sesterz wurde ursprünglich als Silbermünze zu 2 1/2 Asse zusammen mit dem Denar (10 Asses) und dem Quinar (5 Asses) um 211 v.Chr. eingeführt.Die ersten Münzbilder zeigen auf den Vorderseiten das Kopfbild der Roma und die reitenden Dioskuren. Hinter dem Kopf der Roma erscheint die Wertangabe "IIS" (2 Asses und 1 Semis = 2 1/2 Asses). Später war auch das Zeichen "HS" gebräuchlich. Der "Sesterz" wurde im Gewicht von 1/288 des römischen Pfundes (1,137 g) ausgebracht und entsprach damit genau dem Scripulum. Zwar wurde der silberne Sesterz in der Republikzeit nur sporadisch und in geringem Umfang geprägt, aber die Übereinstimmung mit dem beliebten Scripulum mag dazu geführt haben, daß der Sesterz und nicht der in großem Umfang geprägte Denar zur Rechnungsmünze des Römischen Reiches wurde. Große Summen, Vermögen, Steuern usw. wurden in Sesterzen ausgedrückt. Silberne Sesterze wurden nur noch sporadisch im 1. Jh. mit verschiedenen Darstellungen geprägt (vor allem um 48 bis 44 v.Chr. unter Caesar), allerdings mit veränderter Wertrelation zum As. Mit der Neutarifierung um 130 v.Chr. galt ein Sesterz nun 4 Asses. Das Wertverhältnis zum Denar veränderte sich nicht, auch nicht als der Sesterz im Rahmen der Neuordnung des Münzwesens unter Augustus um 23 v.Chr. als größte AE-Münze mit dem Gewicht einer Uncia (27 g) eingeführt wurde. Er wurde zunächst aus Aurichalkum (Messing) geprägt, bei sinkendem Gehalt an Zink, später auch aus Kupfer-Bronze. Die Sesterze der Kaiserzeit zählen zu den beliebtesten Sammelobjekten der antiken römischen Münzen. Dies mag im Zusammenhang stehen mit der Vielgestaltigkeit ihrer Münzbilder und dem großen Durchmesser der Großbronzen, der genug Platz für viele schöne Porträts und vielseitig gestaltete Rückseitendarstellungen bot. Gut erhaltene und seltene Spitzenstücke erzielen immer wieder Höchstpreise und auch häufiger vorkommende Stücke in mittelmäßiger Erhaltung sind allgemein höher bewertet als selbst relativ selten vorkommenden Denare oder Asse. Als einziger Kaiser ließ Decius (249-251 n.Chr.) Doppelsesterze im Gewicht von 34 bis 38 g schlagen, die die Strahlenkrone (als Symbol der Verdoppelung) tragen. Darstellungen des Kaiserhauptes mit der Strahlenkrone kommen auch auf normalgewichtigen Sesterzen des Rebellen-Kaiser Postumus (259-268 n.Chr.) vor. Seit der Regierungszeit Kaiser Valerians (253-255 n.Chr.) wurden die Sesterzen spärlicher geprägt. Die Inflation der höher bewerteten Antioniane aus Billon machte die Prägung der AE-Münzen unrentabel. Die letzten Sesterze wurden wohl in der Interregnumszeit nach dem Tod Kaiser Aurelians 275 n.Chr. geprägt. Als Rechnungsmünze bestand der Sesterz bis in die Zeit der diokletianischen Reformen im ausgehenden 3. Jh. n.Chr. zurück Mehrzahl von Sestino. zurück Der "Sestino" war eine neapolitanische Münze im Wert von 1/6 Tornese, die im ausgehenden 15. Jh. als Billonmünze eingeführt wurde. Bereits im beginnenden 16. Jh. wurden kupferne Sestini in Neapel geschlagen. Später prägte man kupferne Sestini im Wert von 1/6 Soldo oder 2 Denari in Lombardei-Venetien bis ins 18. Jh. geschlagen. zurück Englisch und französisch für "Satz". zurück Französisch für "Unikat" (englisch: unique item). zurück Dies ist die Bezeichnung einer britischen Goldmünze zu 7 Shillings (1/3 Guinea), die im 18. Jh. kurzfristig geprägt wurde. zurück Das Geschlecht der "Severer" stellte zwischen 193 und 235 v.Chr. die römischen Kaiser. Der erste Severer war der erste aus Nordafrika stammende Kaiser Septimus Severus, der nach der Ermordung des Pertinax 193 n.Chr. von seinen Soldaten zum Kaiser ausgerufen wurde und sich in den folgenden Jahren gegen seine Widersacher (Pescennius Niger im Osten und Clodius Albinus im Westen) durchsetzte. Nach dem Tod Septimius Severus 211 n.Chr. folgten die aus seiner zweiten Ehe mit Julia Domna hervorgegangen Söhne Caracalla und Geta. Noch zehnmonatiger gemeinsamer Regentschaft fiel Geta einem Anschlag seines Bruders Caracalla zum Opfer. Über Geta wurde eine Damnatio memoriae verhängt und sogar Bildnis und Namen auf Münzen getilgt (Erasion) bzw. die Münzen eingeschmolzen. Caracalla, dessen offizieller Kaisername Marcus Aurelius Antoninus sich auf Münzen findet, errichtete eine Terrorherrschaft. In seine Regierungszeit fiel die Verleihung der Bürgerrechte an alle freien Bürger des Römischen Reiches (Constitutio Antoniniana) und die Einführung des Doppeldenars, der später unter dem Namen Antoninian bekannt wurde. Nach der Ermordung Caracallas und dem Selbstmord seiner politisch einflußreichen Mutter Julia Domna 217 n.Chr. sorgte deren Schwester Julia Maesa dafür, daß die Severer an der Macht blieben. Sie gab Elagabal, den Sohn ihrer Tochter Soaemias als Sohn Caracallas (in Wahrheit sein Neffe) aus und erreichte, daß er 218 v. Chr. inthronisiert wurde. Elagabal (218-222 n.Chr.) erwies sich als religiös besessen, exzentrisch, zügellos und grausam. Nachdem er und seine politisch einflußreiche Mutter 222 n. Chr. ermordet und in den Tiber geworfen worden waren, war die Tyrannei beendet. Ein Jahr vor Beendigung der Schreckensherrschaft hatte Julia Maesa ihren Enkel Alexianus, ein Sohn ihrer anderen Tochter Julia Mammaea durch Adoption seines Cousins Elagabal als Nachfolger protegiert. Der vierzehnjährige Knabe folgte als Kaiser Alexander Severus (222-235 n.Chr.) auf den Thron. Der letzte Kaiser der Severer-Dynastie stand im Schatten seiner politisch einflußreichen Mutter. Von Senat und Volk akzeptiert, aber beim Heer unbeliebt, wurde er 235 n.Chr. zusammen mit seiner Mutter bei Mainz von Soldaten ermordet. In die Regierungszeit Alexander Severus fällt ein Ausprägestopp für Antoniniane (Doppeldenare), deren Prägung erst 238 n.Chr. wieder aufgenommen wurde. Die Severer hinterließen eine reichhaltige Prägung, allerdings um den Preis einer Währungsverschlechterung. Eine Besonderheit sind Überschneidungen der Legenden auf Münzen von Caracalla und Elagabal, die sich denselben Kaisernamen zulegten. zurück Dies ist die zeitgenössische Bezeichnung des im 18. Jh. in weiten Teilen Deutschlands als Handelsmünze umlaufende Souverain d'or, latinisiert auch Severinus genannt. zurück Lateinische Form von Severin. zurück  Severus Alexander (geb. 01.10.208 in Arca Caesarea im heutigen Libanon; gest. im März 235 in der Nähe von Mogontiacum) war vom 13. März 222 bis zu seinem Tod römischer Kaiser. Sein ursprünglicher Name war Bassianus Alexianus. Ab Juni 221 nannte er sich Marcus Aurelius Alexander, als Kaiser trug er den Namen Marcus Aurelius Severus Alexander. Severus Alexander (geb. 01.10.208 in Arca Caesarea im heutigen Libanon; gest. im März 235 in der Nähe von Mogontiacum) war vom 13. März 222 bis zu seinem Tod römischer Kaiser. Sein ursprünglicher Name war Bassianus Alexianus. Ab Juni 221 nannte er sich Marcus Aurelius Alexander, als Kaiser trug er den Namen Marcus Aurelius Severus Alexander.Im Juni 221 wurde der noch nicht dreizehnjährige Alexander von seinem nur vier Jahre älteren Vetter, Kaiser Elagabal, zum Caesar erhoben und damit zum Nachfolger bestimmt. Im folgenden Jahr trat er nach Elagabals Ermordung die Herrschaft an. Zeit seines Lebens stand er unter dem dominierenden Einfluss seiner Mutter Julia Mamaea. Sie war die eigentliche Herrscherin und arrangierte auch seine Ehe. Da sie sich aber weder bei den hauptstädtischen Prätorianern noch im Heer Autorität verschaffen konnte, war ihre Machtausübung stets prekär. Nach einem verlustreichen Perserkrieg mit unentschiedenem Ausgang mußte der Kaiser zur Abwehr eines Germaneneinfalls an den Rhein eilen. Dort wurde ihm seine Unbeliebtheit im Heer zum Verhängnis. Er fiel mit seiner Mutter einer Soldatenmeuterei zum Opfer. Mit Alexanders Tod endete die Dynastie der Severer. Es begann die Epoche der Soldatenkaiser und mit ihr die "Reichskrise des 3. Jh.", eine krisenhafte Verschärfung der von den Severern hinterlassenen strukturellen Probleme. zurück Sevilla ist heute die Hauptstadt der Autonomen Region Andalusien und der Provinz Sevilla in Spanien imd besaß eine bedeutende Münzstätte. Nach einer späten Legende wurde die Stadt von dem griechischen Helden Herakles gegründet. Sevilla war aber eventuell eine phönizische Gründung und bereits vor der Ankunft der Römer ein wichtiges Handelszentrum. Es soll die Hauptstadt des sagenhaften Reiches Tartessos gewesen sein. 428 wurde die Stadt von den durchziehenden Vandalen geplündert. Als während der Spätantike die Westgoten den größten Teil von Spanien beherrschten, spielte Hispalis/Sevilla eine wichtige Rolle als Bischofssitz. 553 wurde die Stadt offenbar zeitweilig von den oströmischen Truppen des Kaisers Justinian erobert, war aber spätestens um 580 wieder unter Kontrolle der Westgoten. Die islamischen Mauren eroberten die Stadt 712, ein Jahr nach der entscheidenden Niederlage der Westgoten, und machten sie zur Hauptstadt einer Provinz Išbiliya), woraus sich der Name Sevilla ableitet. Im Jahr 844 wurde die Stadt von den Normannen zerstört. Nach dem Sturz des Kalifats von Córdoba etablierte sich in Sevilla mit Abbad I. die Taifendynastie der Abbadiden, die die Stadt in ihre erste Glanzperiode führten. 1091 kam sie in den Besitz der berberischen Almoraviden, die 1147 von den Almohaden abgelöst wurden. Am 23.11.1248 wurde Sevilla nach mehrmonatiger Belagerung von Ferdinand III. von Kastilien erobert und blieb seitdem im Besitz der christlichen Spanier. Doch sank die Wirtschaftskraft, als mit der Zeit ca. 300.000 Mauren in die muslimischen Gebiete nach Granada und Nordafrika auswanderten. Peter I. ließ 1363 maurische Handwerker aus Granada kommen, die den Alcázar-Palast erbauten. 1391 wütete ein Pogrom gegen die jüdischen Stadtbewohner, die bis dahin unter königlichem Schutz stehend im Viertel Barrio de Santa Cruz in Nachbarschaft zum Alcázar-Palast lebten. zurück Das "Sexagesimalsystem" ist ein Stellenwertsystem mit dem Wert 60 (lateinisch: "sexagesimus" = der sechzigste) als Basiszahl. Erstmalige Nachweise eines schriftlichen sexagesimalen Rechensystems, das jedoch noch ein Additionssystem war, reichen in die Zeit der Sumerer um 3300 v.Chr. zurück. Im weiteren Verlauf wurde in der babylonischen Mathematik ab ca. 2000 v.Chr. ein sexagesimales Stellenwertsystem verwendet. Die Hauptquellen zur Mathematik stammen aus der Zeit 1900 v.Chr. bis 1600 v.Chr., die ältesten Tabellentexte sind jedoch noch aus neusumerischer Zeit. Die nachalexandrinische Zeit zeigt unter den Seleukiden zunehmend griechische Einflüsse, die eine Synergie mit den babylonischen Kenntnissen eingingen, um später die gesammelten Erfahrungen der Sumerer, Akkader, Assyrer und Babylonier vollends nach Griechenland zu exportieren. Arabische Astronomen benutzten in ihren Sternenkarten und -tabellen die Schreibweise des berühmten griechischen Astronomen Ptolemäus, die auf sexagesimalen Brüchen basierte. Auch frühe europäische Mathematiker wie Fibonacci benutzten solche Brüche, wenn sie nicht mit ganzen Zahlen operieren konnten. Als Motiv für die Einführung eines Sexagesimalsystems sehen viele Historiker in der Astronomie, da die babylonischen Jahre 12 Monate zu 30 Tagen umfaßten, es gab aber auch etwa alle 3 Jahre einen zusätzlichen 13. Schaltmonat. Weitere Hinweise finden sich in der frühen Zählung der Mondmonate, die bis in das Jahr 35.000 v.Chr. nachgewiesen werden können (Kalender-Stöckchen). In der Republik Tschechien wurde der Speichenknochen eines jungen Wolfes von etwa 30.000 v.Chr. entdeckt, der eine Reihe von insgesamt 55 Einkerbungen aufweist, wobei die 9., die 30. und die 31. Kerbe von oben rund doppelt so lang sind wie die anderen Kerben. Weil die mittlere Periode der Mondphasen 29,53 Tage beträgt, könnten die Markierungen mit den Mondphasen in Verbindung stehen. Andere Wissenschaftler sehen als Grund für die Wahl der Zahl 60 als Basis des Rechensystems die Absicht, möglichst viele der beim praktischen Zählen und Messen (Handel) auftretenden Teile einfach ausdrücken bzw. berechnen zu können. zurück "Sextans" ist ein Sechstel einer zwölfteiligen Maß- oder Gewichtseinheit. Als Münzbezeichnung taucht der Name im Zusammenhang mit der Unterteilung des römischen Aes grave auf. Der "Sextans" wurde als 1/6 As, also im Wert von 2 Unciae ursprünglich gegossen und seit der Einführung des Semilibralfusses als AE-Münzen geprägt. Die Münze kommt in nahezu allen Reduktionsstufen zwischen der Mitte des 3. Jh. bis in die 2. Hälfte des 2. Jh. vor. Sein Wertzeichen sind zwei Kugeln. Die frühen Münzbilder zeigen eine Muschel, später den Kopf des Merkur und die Prora. zurück Die frühen Münzen des Aes grave der Römischen Republik wurden im Gewicht schrittweise abgesenkt. Eine wichtige Stufe ist der "Sextantalfuß", in der anglo-amerikanischen numismatischen Literatur Sextantal Standard genannt. Dabei entsprach der As im "Sextantalfuß" im Gewicht 1/6 des römischen Pfundes (Libra) oder dem ursprünglichen Sextans (1/6 As), deshalb auch Sextantar-As genannt. Mit dem Erreichen des "Sextantalfußes" war man in der Lage, die Münzreihe (As und seine Unterteilungen) bis zum As zu prägen (zuvor waren sie gegossen worden). Seitdem spricht man nicht mehr vom Aes grave, sondern von den römischen Bronze- oder Kupferprägungen. Heute nimmt man an, daß der Sextantalfuß oder -standard gleichzeitig mit dem silbernen Denar etwa um 211 v.Chr. eingeführt wurde. 10 Sextantal-Asse galten 1 Denar. zurück Dies ist die in der englischen Literatur übliche Bezeichnung für den Sextantalfuß. zurück Der römische As im Gewicht von 1/6 des römischen Pfundes (Libra) wurde als "Sextantal-As" bezeichnet. Es wird angenommen, daß mit dem Erreichen dieser Reduktionsstufe (Sextantalfuß) der As nicht mehr gegossen, sondern geprägt wurde. Man glaubt, daß der Sextantalfuß während des 2. Punischen Kriegs (218-201 v.Chr.) um etwa 211 v.Chr. eingeführt wurde. zurück  Die Republik der &&Seychellen&& ist ein Inselstaat im Indischen Ozean. Dieser liegt östlich von Afrika und nördlich von Madagaskar und Mauritius. Zwischen Afrika und den Seychellen liegen die Komoren. Die Republik besteht aus 115 Inseln und gliedert sich in 32 Gebirgsinseln (hauptsächlich Granitstein), welche die eigentlichen Seychellen darstellen, und in zahlreiche kleine Koralleninseln, die sogenannten Outer Islands, die auf einer Meeresfläche von über 400.000 qkm verteilt liegen. Die Republik der &&Seychellen&& ist ein Inselstaat im Indischen Ozean. Dieser liegt östlich von Afrika und nördlich von Madagaskar und Mauritius. Zwischen Afrika und den Seychellen liegen die Komoren. Die Republik besteht aus 115 Inseln und gliedert sich in 32 Gebirgsinseln (hauptsächlich Granitstein), welche die eigentlichen Seychellen darstellen, und in zahlreiche kleine Koralleninseln, die sogenannten Outer Islands, die auf einer Meeresfläche von über 400.000 qkm verteilt liegen.Die Seychellen waren zunächst Teil der Kolonie Mauritius, die ab 13.08.1903 eigenständige britische Kolonie waren. 1965 wurden die Inseln Aldabra, Farquhar und Desroches aus- und 1976 wieder eingegliedert. Am 01.10.1975 erhielten sie die innere Selbstverwaltung und wurden am 28.06.1976 unabhängige Republik. Amtssprache: Seselwa, Englisch, Französisch Hauptstadt: Victoria Staatsform: Republik Fläche: 455 qkm Einwohnerzahl: 80.832 (2004) Bevölkerungsdichte: 177 Einwohner pro qkm Währung: Seychellen-Rupie Unabhängigkeit von Großbritannien: 29.06.1976 Zeitzone: UTC +4 Währung: Seychellen-Rupie zurück Die "Seychellen-Rupie" (ISO-4217-Code: SCR; Abkürzung: SR) ist die Währung der Seychellen. Es gilt 1 Rupie = 100 Cents. Es gibt Münzen zu 5 SR, 1 SR, und 25, 10, 5 und 1 Cents (wobei die Ein-Cent-Münze zuletzt 1992 geprägt wurde) und Banknoten zu 500, 100, 50, 25, 10 Rupien. Daneben gibt es noch Gold- und Silbermünzen bis zu 1.500 SR, die aber kein offizielles Zahlungsmittel sind. Die seychellische Regierung gestattet nur die Ein- und Ausfuhr von 100 Rupien. zurück Dies ist das Währungszeichen für den Schweizer Franken. zurück ISO-4217-Code für den Singapur-Dollar. zurück Länderkennzeichen für Singapur. zurück Abkürzung für Silbergroschen. zurück Das italienische Wort "Sgraffiti" ist die numismatische Bezeichnung für Einkratzungen auf antiken, besonders griechischen Münzen. Dies können einzelne oder mehrere Buchstaben, Namen oder bildliche Darstellungen sein. zurück "Shahi" ist eine feste persische (iranische) Einheit im Wert von 50 Dinar, die erstmals 1501 n.Chr. als Silbermünze geprägt wurde. Nach Einführung des Abbasi entsprachen vier silberne "Shahi" einem Abbasi. Die Silbermünze wog im 17. Jh. 1,92 g. Es gab Teil- und Mehrfachstücke und viele verschiedene Typen. Der "Shahi" verlor zunehmend an Gewicht und wurde im 19. Jh. auch aus Kupfer geprägt. Der Wert des Shahi zu 50 Dinar blieb bis 1932 bestehen. Neben dem kupfernen Shahi wurde der silberne "Shahi Sefid" (weißer Shahi) zu 3 kupfernen Shahi im Wert von 150 bis 156 1/4 Dinaren ausgegeben. Diese Stücke dienten bis in das erste Viertel des 20. Jh. als Glückwunschgeschenke zum persischen Neujahrsfest (Newroz). Der Shahi wurde von den persischen Eroberern zwischen 1623 und 1638 auch in Mesopotamien (heute: Irak) geprägt. In Afghanistan galt der Shahi im 19. Jh. 5 Paise. zurück Sharjah ist ein Scheichtum am Persischen Golf mit den Gebieten Dhiba, Kalbah und Khor Fakkan, das seit dem 02.12.1971 Mitglied der Vereinigten Arabischen Emirate ist. Staatsform: Emirat Geografische Lage: 25° 21' N, 55° 26' O Koordinaten: 25° 21' N, 55° 26' O Einwohner: 699.000 (2006) Fläche: 2.590 qkm Bevölkerungsdichte: 269,9 Einwohner je qkm Zeitzone: UTC +4 zurück Khor Fakkan ist eine Enklave von Sharjah. zurück "Shauri" (auch: Schauri) ist eine grusinische (georgische) Währungseinheit bis ins 19. Jh., die in etwa dem persischen Shahi entsprach und wie dieser 1/4 Abbasi galt. Nach der russischen Eroberung Georgiens entsprach der Shauri 5 Kopeken. zurück Alternative Schreibeweise für Schekel. zurück Mehrzahl von Shegel. zurück Alternative Schreibeweise für Schekel. zurück Mehrzahl von Shekel. zurück Rostgeschützte (sheradisierte) Eisenmänzen wurden z. B. während des 1. Weltkriegs zwischen 1915 und 1922 ausgegeben. Es handelt sich um 5- und 10-Pfennig-Stücke, die mittels des aufwendigen Verfahrens der Sheradisierung durch mehrstündiges Glühen in Zinkpulver vor Korrosion geschützt werden sollten. zurück Englisch für Stückelungsplus (österreichisch: Schärübertrag). zurück &&"Shield-Nickel"&& ist die Bezeichnung des ersten Typs des US-amerikanischen 5-Cent-Stücks aus Nickel, das als Nachfolger des silbernen Half Dime von 1866 bis 1883 geprägt wurde. Der von James Barton Longacre entworfene Typ zeigt auf der Vorderseite den Wappenschild der USA und auf der Rückseite die Wertzahl 5 in einem Kreis von Sternen und Strahlen. Seit 1867 wurden die Strahlen weggelassen. Das Münzmetall besteht - wie der Nickel 3-Cent von 1865 - aus einer Legierung von Kupfer (75 Prozent) und Nickel (25 Prozent). Der Typ wurde ohne weitere Änderung bis zur Ablösung durch den Typ Liberty Head Nickel 1883 fortgeführt. zurück Somalische Bezeichnung für den Somalia-Schilling. zurück Der &&Shilling&& wurde in England schon in karolingischer Zeit als Recheneinheit zu 12 Pence oder 1/20 eines Pfundes (englisch: Pound) eingeführt und hielt sich die meiste Zeit in dieser Einteilung bis zur Dezimalwährung von 1970. Erstmals ausgeprägt wurde der Rechenwert als Silbermünze und ursprünglich Tentoon genannt, um 1504 unter König Heinrich VII., nach dem Vorbild des französischen Teston, der seinerseits wieder auf den Mailänder Testone zurückgeht. Die Silbermünze im Gewicht von ca. 9,13 g zeigt auf der Vorderseite ein Porträt des Königs, das vermutlich auf den Stempelschneider Alexander von Bruchsal zurückgeht. Erst die seit der kurzen Regierungszeit Edward VI. (1547-1553) geprägten Silbermünzen zu 12 Pence werden auch als "Shilling" bezeichnet. Unter Edward VI. wurden auch erstmals ein Halb- und Viertelstück des Shillings, der Sixpence und der Threepence ausgeprägt. Als mittlerer Wert wurde der Shilling zu einer der wichtigsten silbernen Umlaufmünzen in Großbritannien, die von nahezu allen folgenden Monarchen geprägt wurde. Erst seit 1947 wurde der Shilling in Kupfer-Nickel ausgeprägt, zuletzt 1970 vor der Umstellung der britischen Währung auf das Dezimalsystem (1971). Bedingt durch den weltweiten Einfluß Großbritanniens (vor allem im 19. Jh.) war der Shilling auch zeitweise in vielen anderen Ländern geläufig, wie Australien, Biafra, Britische Jungfern-Inseln, Britisch-Honduras, Britisch-Ostafrika, Britisch-Westafrika, Dominica, El Salvador, Fidschi-Inseln, Gambia, Ghana, Gibraltar, Guernsey, Irland (irisch: Scilling), Insel Man, Jamaika, Jersey, Kenia, Malawi, Mocambique, Neuguinea, Neuseeland, Nigeria, Rhodesien (auch Nord- und Südrhodesien), Somalia, Südafrika, Trinidad, Uganda und Zypern. zurück Hierbei handelt es sich um eine Silbermünze aus Tibet. zurück Der "Short-cross Penny" ist ein Typ des englischen Penny, der 1180 unter Heinrich II. eingeführt wurde. Wie der Name "kurzes Kreuz" schon sagt, gehen die vier Kreuzenden nicht bis an den Rand. Die Münze wurde bis 1247 geschlagen. Nachfolger war der Long-cross Penny. zurück ISO-4217-Code für das St.-Helena-Pfund. zurück Eigenname von Albanien. zurück zurück Die Firma Shultz & Co. war eine private amerikanische Prägeanstalt in der kalifornischen Stadt San Francisco, die 1851 ein Goldstück zu 5 Dollar verausgabte, das dem Typ "Coronet Head" (gekröntes Kopfbild der Liberty im Sternenkreis/Wappenadler mit ausgebreiteten Schwingen) des offiziellen US-amerikanischen Half Eagle gleicht, der zu dieser Zeit geprägt wurde. Im Unterschied zur Umschrift der offiziellen Half Eagles (United States of America) trägt die Umschrift dieser Goldmünze die Umschrift "PURE CALIFORNIA GOLD". Das Unternehmen wurde von Richter G. W. Schultz und seinem Partner W. T. Garratt geleitet. zurück Elementzeichen für Silizium. zurück Alte Bezeichnung von Thailand. zurück "Sicca Rupee" ist die volkstümliche Bezeichnung der Rupie, die die britische East India Company zwischen 1773 und 1818 in Bengalen prägte. Sie sind immer mit islamischen Datum "A. H. 1212" und mit dem Namen "Murshidabad" versehen, auch wenn sie in Kalkutta oder anderen Münzstätten geprägt wurden. zurück Der Euro soll nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) sicherer sein als die D-Mark. Die sieben Banknoten sind über die gesamte Serie mit anspruchsvollen Sicherheitsmerkmalen wie Wechselfarbdruck und Wasserzeichen ausgestattet. Die acht Münzen sind von verschiedenen Rändelungen umgeben. Die Euroscheine und -münzen gelten vom 01.01.2002 an für 300 Mio. Menschen in zwölf europäischen Staaten. Die acht verschiedenen Münzen unterscheiden sich in Dicke, Gewicht, Größe, Material und Farbe. Die leicht magnetische 1-Euro-Münze ist zweifarbig. Sie ist innen silberfarben, besitzt einen goldfarbenen Rand und eine gebrochen geriffelte Rändelung. Farblich umgekehrt sieht das ebenfalls leicht magnetische 2-Euro-Stück aus. Es ist außen silberfarben und innen goldglänzend. Der Münzrand ist mit einer geriffelten Schriftprägung versehen. Das 50-Cent-Stück ist goldfarben und hat eine feine Wellenprägung. Es ist nicht magnetisch. Ebenfalls goldfarben präsentiert sich die Münze zu 20 Cent. Das ebenfalls nicht magnetische Geldstück zeigt statt einer Randprägung sieben Einkerbungen. Mit einer feinen Wellenprägung ist die 10-Cent-Münze versehen. Die kupferfarbenen 1-, 2- und 5 Cent-Stücke sind stark magnetisch. Sie haben jeweils einen glatten Rand, nur die 2-Cent-Münze hat eine Einkerbung. zurück Der Euro soll nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) sicherer sein als die D-Mark. Die sieben Banknoten sind über die gesamte Serie mit anspruchsvollen Sicherheitsmerkmalen wie Wechselfarbdruck und Wasserzeichen ausgestattet. Die acht Münzen sind von verschiedenen Rändelungen umgeben. Die Euroscheine und -münzen gelten vom 01.01.2002 an für 300 Mio. Menschen in zwölf europäischen Staaten. In alle sieben Banknoten im Wert von 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Euro sind unter anderem die bekannten Wasserzeichen und Sicherheitsfäden eingearbeitet. Beim Kippen lassen sich changierende Lichteffekte auf Perlglanzstreifen und bei den Scheinen von 50 Euro aufwärts Architektur-Hologramme und mehrfarbige Wertzahlen erkennen. Bereits beim Anfassen können die per Stichtiefdruck aufgebrachten architektonischen Motive gefühlt werden. Dies bedeutet vor allem für blinde und sehbehinderte Menschen einen wirksamen Schutz. zurück Der "Sicherheitsrand" soll Münzen vor Fälschungen und Beschneidungen schützen. Man unterscheidet den Kerbrand, Laubrand und Mittelrand. zurück zurück   Sidon war der größte phönizische Hafen und ab Ende des 5. Jh. v.Chr. gab es dort auch eine Münzstätte, wo nach dem Fuß des phönizischen Schekels geprägt wurde. Ab 333 v.Chr. war die Münzstätte für das Weltreich Alexanders des Großen tätig. Nach dem Zerfall des Reiches geriet sie in den Besitz des Ptolemäer und ab 202 gehörte sie den Seleukiden. 111 v.Chr. war die Stadt nochmals autonom und unter den Römern besaß sie eine Münzstätte für Provinzialmünzen. Sidon war der größte phönizische Hafen und ab Ende des 5. Jh. v.Chr. gab es dort auch eine Münzstätte, wo nach dem Fuß des phönizischen Schekels geprägt wurde. Ab 333 v.Chr. war die Münzstätte für das Weltreich Alexanders des Großen tätig. Nach dem Zerfall des Reiches geriet sie in den Besitz des Ptolemäer und ab 202 gehörte sie den Seleukiden. 111 v.Chr. war die Stadt nochmals autonom und unter den Römern besaß sie eine Münzstätte für Provinzialmünzen.zurück Bezeichnung für ein Druckverfahren, bei dem die Farbe mit einem wischerähnlichen Werkzeug (Rakel) durch ein feinmaschiges textiles Gewebe hindurch auf das zu bedruckende Material gedrückt wird. An denjenigen Stellen des Gewebes, wo dem Bildmotiv entsprechend keine Farbe gedruckt werden soll, sind die Maschenöffnungen des Gewebes durch eine Schablone farbundurchlässig gemacht worden. Im Siebdruckverfahren ist es möglich, viele verschiedene Materialien zu bedrucken, sowohl flache (Folien, Platten etc.) als auch geformte (Flaschen, Gerätegehäuse etc.). Im Vergleich zu den anderen Druckverfahren ist die Druckgeschwindigkeit relativ gering. Der Siebdruck wird hauptsächlich im Bereich der Werbung und Beschriftung, im Textil- und Keramikdruck und für industrielle Anwendungen eingesetzt. zurück Siebenbürgen ist ein waldiges Bergland nordwestlich der Karpaten. Im Mittelalter gehörte es zu Ungarn und wurde 1538 selbständiges Fürstentum, das zeitweise unter türkischer Oberherrschaft stand. Nach 1690 fiel das Land an das Königreich Ungarn und wurde somit habsburgisch. Zu Beginn des 18. Jh. gab es Aufstände, die aber nicht zur Unabhängigkeit führten. Auf den Münzen erscheint immer der Name "Transsilvanien". Die Münzprägung begann unter Johann Zapolya (1538-1540), der Dukaten nach ungarischem Vorbild schlagen ließ. Die siebenbürgischen Fürsten ließen in mehreren Münzstätten prägen, nämlich Clausenstadt, Hermannstadt, Kronstadt, Kremnitz, Nagybanya, Oppeln und Schässburg. Auch unter den Habsburgern Leopold I. bis Maria Theresia wurden in Siebenbürgen Münzen geprägt. zurück Volkstümliche Bezeichnung für den Siebenkreuzer. zurück Bereits Ende des 17. Jh. stiegen in Österreich die 6-Kreuzer-Stücke auf den Wert von 7 Kreuzern. Trotzdem prägte man in der ersten Hälfte des 18. Jh. weiter 6-Kreuzer-Stücke. Schließlich nahm man die Einführung des Konventionsfusses zum Anlaß, die Prägung des 6-Kreuzer-Stückes zu beenden und das 7-Kreuzer-Stück im Gewicht von etwa 3,24 g (422/1000 fein) auszumünzen. Die im Volksmund auch "Siebener" genannten Stücke wurden in Österreich zwischen 1751 und 1776 geprägt. Sie zeigen auf den Vorderseite die Büste der Kaiserin Maria Theresia, seit 1765 auch die ihres Sohnes Joseph II., und auf den Rückseiten den gekrönten Doppeladler mit Wappen, darunter die Wertzahl VII. Im Jahre 1802 wurden in Österreich die 1795 geprägten 12-Kreuzer-Stücke im Gewicht von 4,68 g (250/1000 fein) zu 7-Kreuzer-Stücken umgeprägt. Diese Siebener zeigen auf den Vorderseiten den Doppeladler, auf den Rückseite die Wertzahl 7 im Viereck. Sie wurden 1807 auf 6 Kreuzer gesetzt und noch im selben Jahr verrufen. zurück   Im ausgehenden 17. Jh. stieg der Wert der österreichischen 15-Kreuzer-Stücke auf 17 Kreuzer. Mit Einführung des Konventionsfusses wurde an Stelle des alten 15-Kreuzer-Stücks das silberne 17-Kreuzer-Stück im Gewicht von etwa 6,12 g (542/1000 fein) ausgemünzt. Die Stücke wurden zwischen 1751 und 1765 geprägt. Die Vorderseite zeigen die Büste der Kaiserin Maria Theresia und die Rückseiten den gekrönten Doppeladler mit der Wertzahl XVII darunter. Im ausgehenden 17. Jh. stieg der Wert der österreichischen 15-Kreuzer-Stücke auf 17 Kreuzer. Mit Einführung des Konventionsfusses wurde an Stelle des alten 15-Kreuzer-Stücks das silberne 17-Kreuzer-Stück im Gewicht von etwa 6,12 g (542/1000 fein) ausgemünzt. Die Stücke wurden zwischen 1751 und 1765 geprägt. Die Vorderseite zeigen die Büste der Kaiserin Maria Theresia und die Rückseiten den gekrönten Doppeladler mit der Wertzahl XVII darunter.zurück Bezeichnung für den Abdruck mit Hilfe eines Petschaft oder speziellen Metallstempels in weiche Siegelmasse, die allmählich erhärtet (englisch: seal, französisch: cachet de cire bzw. sceau, italienisch: timbro, portugiesisch: carimbo, spanisch: sello). Das Siegel wird zur Beglaubigung von Urkunden sowie zum gesicherten Verschließen von Briefen verwendet. Später wurden die Siegel durch die Siegelmarke verdrängt. zurück Die "Siegelkund" (auch: Sphragistik vom griechischen Wort "sphragis" = Siegel) ist eine der historischen Hilfswissenschaften. Ihr Ziel ist die Kenntnis der Siegel (lateinisch: Sigillum = "Bildchen") und insbesondere der Urkundensiegel. Sie entstand seit dem 17. Jh. als Nebenzweig der Diplomatik (Urkundenlehre). Von dieser differenzierte sie sich durch abweichende Methodik, die der Heraldik (Wappenkunde) und Numismatik (Münzkunde) nahe kommt beziehungsweise entlehnt ist. Untersucht wird dabei die physische Beschaffenheit der Siegel, aus der auf die Zeit der Entstehung oder Anbringung der Siegel geschlossen werden kann. Daneben ist auch die kunsthistorische Entwicklung von Siegeln interessant, die Rückschlüsse auf Kleidung, Bewaffnung und unter Umständen auch auf die Stadtgeschichte ziehen lassen. Dort, wo Wappen und Herrschersymbole betroffen sind, ergeben sich vielerlei Überschneidungen zur Heraldik. zurück Hermann Ernst Sieger (geb. 16.06.1902 in Bad Cannstadt, gest. 21.11.1954 in Göppingen) war Berufsphilatelist und seit 1922 Verleger. Er erkannte schon früh die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Zeppelin-Luftfahrt, war philatelistischer Berater des Luftschiffsbaus Zeppelin in Friedrichshafen und gab 1930 den ersten Zeppelinpost-Katalog heraus. Er war Förderer philatelistischer Literatur sowie Gründer und (bis 1945) Kurator des Postmuseums in Liechtenstein. zurück Die Firma Hermann E. Sieger GmbH in Lorch/Württemberg ist eine der ältesten und bedeutendsten Firmen in Deutschland, die sich auf Philatelie und Numismatik spezialisiert hat. Hermann Ernst Sieger kam 1922 auf die Idee, einen Neuheitendienst für Sammler einzurichten. Daneben machte er sich auch um die Zeppelinpost verdient, für die er Spezialist war. Heute wird das Unternehmen von seinem Sohn Hermann Walter Sieger geführt. Von der Firma wurden auch wichtige Spezialkataloge editiert. Im Internet ist die Firma unter der Adresse »www.sieger.de« erreichbar. zurück Der "Siegeskranz" zählt zu den Attributen der Victoria. zurück Hierbei handelt es sich um Gepräge, die in Schrift und Bild Bezug auf einen militärischen Sieg nehmen. Die ersten "Siegesmünzen" wurden von den Römern geprägt. In der Neuzeit wurden Siegesmünzen meist als Taler geprägt. zurück zurück Die norditalienische Stadt Siena prägte über 200 Jahre das Goldstück, das unter dem Namen Sanese d'oro bekannt ist. Die Münzgeschichte der Stadt begann im frühen 9. Jh., als Kaiser Karl der Große hier silberne Denare schlagen ließ. Außer einer kurzen Oberherrschaft von Mailand in den Jahren 1390 bis 1404 blieb Siena selbständig, bis die Stadt 1531 von Karl dem V. erobert wurde. Die Bürger stellten sich daraufhin unter den Schutz des französischen Königs Heinrichs II. und aus dieser Zeit gibt es einer sehr seltenen Ecu d'or mit der Umschrift "HENRICO II AUSPICI" und einem diagonalen Band inmitten eines Kranzes "LIBERTAS". 1555 eroberte Karl V. die Stadt zurück und gab sie an Florenz. Unter Cosimo I. gab es noch einige Münzen, aber danach wurde die Münzstätte geschlossen. zurück  Die Republik &&Sierra Leone&& ist ein Staat in Westafrika. Das Land grenzt an Guinea, Liberia und den Atlantik. Das Land ist auch heute noch eines der am wenigsten entwickelten Länder. Nach einem Jahrzehnt blutigen Bürgerkrieges ist das Land nun mit seinem Wiederaufbau und der Aufarbeitung der jüngeren Geschichte beschäftigt. Die Republik &&Sierra Leone&& ist ein Staat in Westafrika. Das Land grenzt an Guinea, Liberia und den Atlantik. Das Land ist auch heute noch eines der am wenigsten entwickelten Länder. Nach einem Jahrzehnt blutigen Bürgerkrieges ist das Land nun mit seinem Wiederaufbau und der Aufarbeitung der jüngeren Geschichte beschäftigt.Sierra Leone war britische Kolonie. Am 27.04.1961 wurde es unabhängig und am 19.04.1971 Republik. Amtssprache: Englisch Hauptstadt: Freetown Staatsform: Präsidialrepublik Fläche: 71.740 qkm Einwohnerzahl: 5,159 Mio. (2007) Bevölkerungsdichte: 72 Einwohner pro qkm Unabhängigkeit von Großbritannien: 27.04.1961 Zeitzone: UTC Währung: Leone zurück Die ersten Münzen des westafrikanischen Landes Sierra Leone stammen von der "Sierra Leone Company", einer englischen Handelsgesellschaft, die dort bis Ende des 18. Jh. dort tätig war. Sie wurden schon 1791 in Dezimalwährung geprägt in Dollar und Cent. In Silber gab es 1 Dollar, 50, 20 und 10 Cent und in Kupfer 10 Cent und 1 Cent sowie 1 Penny, der aber wohl nie umlief, sondern wohl nur eine Probe war. zurück Lateinisch für Siegel. zurück Mehrzahl von Siglos. zurück Griechische Bezeichnung für Schekel (Gewicht und Recheneinheit zu 1/50 und 1/60 der Mine). Der "Siglos" ist die persische Standardsilbermünze der Achämeniden im Wert von 1/20 des goldenen Dareikos. Das Münzbild zeigt auf der Vorderseite die Knielauf-Figur (Bogenschütze) und auf der Rückseite das Quadratum incusum, oftmals mit kleinen Gegenstempeln versehen. Es gab auch Doppel- und Halbsigloi. Auch die nach persischem Münzfuß geprägten Silbermünzen benachbarter Völker, die unter persischem Einfluß standen, werden als "Sigloi" bezeichnet. zurück Englisch für "Zeichen" (dänisch: tegn, englisch: mark, französisch: signe, italienisch: segno, niederländisch: teken, portugiesisch: sinal, spanisch: signo). zurück Mehrzahl von Signum. zurück Alternative Bezeichnung für Signum. zurück Französisch für "Zeichen" (dänisch: tegn, englisch: mark bzw. sign, italienisch: segno, niederländisch: teken, portugiesisch: sinal, spanisch: signo). zurück Französisch für "geprüft" (englisch: expertized). zurück Alternative Bezeichnung für Signatur. zurück Spanisch für "Zeichen" (dänisch: tegn, englisch: mark bzw. sign, französisch: signe, italienisch: segno, niederländisch: teken, portugiesisch: sinal). zurück zurück "Signum" ist der kateinische Ausdruck für das militärische Zeichen, die Fahne und vor allem das römische Feldzeichen. Das römische Signum war militärisch, taktisch, moralisch und religiös von größerer Bedeutung als die Truppenfahnen der Neuzeit. Das wichtigste Feldzeichen der römischen Legionen war der an einer Stange getragene Legionsadler (lateinisch: Aquila). Signa hatten auch die militärischen Untereinheiten, umstritten ist, ob Centurien oder Manipeln. Kleinere militärische Einheiten (Kohorten) hatten keine Feldzeichen mehr. Es sind vermutlich die Manipel-Signa, die oft eine Hand (lateinisch: manus) an der Spitze der Stange zeigen. An Querstangen waren manchmal rechteckige Tücher angebracht, die Zeichen und Nummern der Legion trugen. Die Feldzeichen-Stangen waren mit Ehrenzeichen, u.a. mit Bändern, Kränzen, Sternen, Halbmonden, Phalerae (runde Zierscheiben), Torques (Ringe, Girlanden) und manchmal auch mit dem Wappen der Legion verziert. Feldzeichen finden sich häufig auf römischen Legions-Denaren der späten Republik- und der Kaiserzeit dargestellt. Zwei (auch drei) römische Feldzeichen, die zwischen dem Legionsadler dargestellt sind, sind zum ersten Mal als Rückseitentyp auf den sehr zahlreichen Legionsdenaren Marc Antons (geb. 83-30 v.Chr.) dargestellt. Dieser Typ wurde unter Kaiser Septimius Severus (193-211 n.Chr.) wieder aufgenommen. Wenn auch nicht so zahlreich wie bei Marc Anton, so tragen doch viele Rückseiten von Münzen (auch von Goldmünzen) unter Augustus Feldzeichen, u.a. auch auf die Wiedergewinnung der von Germanen und Parthern erbeuteten Signa mit diesbezüglicher Schrift ("SIGNIS RECEPTIS" oder "...RECUPERATIS"). Bei späteren Kaisern sind die Feldzeichen meist in den Händen römischer Kaiser und Gottheiten (u.a. Concordia, Fides Victoria) dargestellt. zurück "Sik" ist die Bezeichnung des 2-Fuang-Stücks nach dem alten Münzsystem von Siam (heute: Thailand). Es galten 2 Sik = 1 Fuang, 16 Sik = 4 Salung = 1 Baht. zurück Niederländisch für "Halbmond" (dänisch: halvmâne, englisch: crescent, französisch: croissant, italienisch: mezzaluna, portugiesisch: crescente, spanisch: media luna). zurück Alternative Schreibweise für Siglos. zurück Hiermit bezeichnet man die im späten 5. und 4. Jh. v.Chr. in Sizilien aufgekommenen Prägungen, die der Bezahlung der karthagischen Söldner in Sizilien dienten. Die andauernden kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Karthager, den einheimischen Stämmen der Sikuler und den von griechischen Kolonisten gegründeten Städten wurden mit wechselndem Erfolg geführt, bis schließlich im Verlauf der Punischen Kriege das aufstrebende Rom um 227 v.Chr. die Vorherrschaft gewann und Sizilien zur römischen Provinz wurde. Die frühen sikulo-punischen Prägungen orientierten sich weitgehend an den Geprägen anderer sizilischer Städte, vor allem an den Münzen von Syrakus. Spätere Gepräge aus dem späten 4. und frühen 3. Jh. v.Chr. zeigen oft, wie die Münzen von Zeugitana, den Kopf der punischen Gottheit Tanit und den Pferdekopf. Viele dieser Prägungen sind noch heute nicht sicher einer bestimmten Münzstätte zuweisbar. In Katalogen sind sie sowohl unter "Sizilien" (vorwiegend unter den Münzstätten Panormos, Kephaloidion und Motya) zu finden als auch unter Zeugitana oder Karthago. zurück Sikyon war ein antiker Stadtstaat auf dem nördlichen Peloponnes, nordwestlich von Korinth gelegen. Die Stadt besaß auch eine eigene Münzstätte. Die Münzen zeigten u.a. die Mainaden (meist tanzend). zurück "Silber" ist - wie auch Gold - eines der ältesten Münz- und Tauschmetalle. Der überwiegende Teil der modernen Gedenkmünzen wird aus Silber geprägt. Das Edelmetall hat das chemische Zeichen "Ag" (lateinisch: Agentum), ein Dichte von 10,5 g/ccm (Schwermetall) und einen Schmelzpunkt von 960,8 Grad Celsius. Das weißglänzende Metall ist härter als Gold und weicher als Kupfer, mit dem es zur Verbesserung seiner metallurgischen Eigenschaften oft legiert wurde. Das gut zu verarbeitende, dehnbare Silber läßt sich dünn aushämmern und fein ausziehen und leitet hervorragend Wärme und Elektrizität. Es korrodiert nicht, bildet aber unter dem Einfluß von Schwefelwasserstoffen, die immer in Spuren in der Luft enthalten sind, eine dünne schwärzliche Schicht von Silbersulfid (Anlaufen). Das Metall war schon in prähistorischer Zeit bekannt und entwickelte sich seit dem 6. Jh. v.Chr. - bald nachdem in der antiken griechischen Welt die ersten Münzen aus Elektron aufkamen - zum wichtigsten Münzmetall. Diesen Rang konnte das Silber bis zum 19. Jh. behaupten, denn das wertvollere Gold war nicht in ausreichender Menge verfügbar und das Silber erwies sich als praktischer für die Stückelung in kleinere Nominale. Das Wertverhältnis der beiden Edelmetalle schwankte je nach Bedarf und Fördermenge. Das klassische Verhältnis von 12:1 wird u.a. mit der Einteilung eines Jahres in 12 Monate in Zusammenhang gebracht, denn das alchemistische Symbol für Silber ist der Mond (Luna), für Gold die Sonne (Sol). Zu den frühesten Münzprägungen aus Silber in archaischer Zeit zählen die silbernen Statere des sagenumwobenen Königs Kroisos von Lydien (560-546 v.Chr.) in Kleinasien, die nach äginäischem Münzfuß Schildkröten der griechischen Handelsstadt Aigina und die Wappenmünzen von Athen nach dem Attischen Münzfuß darstellten. Umfangreiche Silberprägungen setzen den Silberbergbau voraus. Die erste und berühmteste Silberwährung der Antike waren die Eulen aus Athen, deren Metall von den Silberbergwerken von Laurion stammte. Das meiste Silber der antiken Welt kam von der Iberischen Halbinsel. Bereits die Phönizier und später die Karthager verhandelten spanisches Silber rund um das Mittelmeer, bevor die Römer die iberischen Silbervorkommen systematisch ausbeuteten. Im Mittelalter begann der Silberabbau im Harz und Erzgebirge, in Böhmen, Tirol und Ungarn. Die Blütezeit des mitteleuropäischen Silberbergbaues ging mit dem 16. Jh. zu Ende. Nach der Entdeckung der Neuen Welt floß das überseeische Silber von den spanischen Kolonien Amerika (Mexiko, Peru, Bolivien) nach Europa. Durch die großen Fördermengen in Amerika fiel der Wert des Silbers im Verhältnis zum Gold. Als Währungsmetall hatte das Silber im 19. Jh. ausgedient, als Münzmetall war es noch bis zum 2. Weltkrieg bedeutend. Nachdem das Deutsche Reich nach 1871 den Übergang zur Goldwährung ankündigte, drückte der Verkauf großer Mengen überschüssigen Silbers den Preis. Bald darauf gingen mehrere Länder zur Gold- bzw. Doppelwährung über, so daß das Silber im Verhältnis zum Gold stark abfiel (von 15,5:1 auf 35,5:1 im Jahr 1910). Nach kurzer Erholung im 1. Weltkrieg (19,9 :1) fiel das Silber weiter (auf 74,8:1 im Jahr 1931). Als letzter Staat gab das Kaiserreich China 1935 die Silberwährung auf. Noch heute kommt der größte Anteil der Weltsilberproduktion aus Amerika, aber auch in Australien und Sibirien befinden sich reiche Silbervorkommen. Silber wurde praktisch nie rein vermünzt, sondern mit anderen Metallen legiert. Meist wurde dem Silber Kupfer beigemischt, um die Silbermünzen für den Geldumlauf geeigneter zu machen. Die Silberfeinheit der Währungsmünzen bewegte sich in der Regel zwischen 860 und 960 Promille (Tausendteile) Silber. Bei Scheidemünzen lag der Silberanteil bei der Hälfte (500/1000) oder darunter (Billon). Eine Ausnahme bilden die silbernen Münzen des Deutschen Reichs (Goldwährung), die als Scheidemünzen einen Feingehalt von 900/1000 hatten. Heute werden von verschiedenen Staaten noch Gedenkmünzen und Sonderserien in Silber zu Sammelzwecken hergestellt. zurück Hierbei handelt es sich um quaderförmige Gußbarren aus Feinsilber. zurück Als "Silberbronze" werden sowohl silberhaltige als auch silberfarbene Legierungen bezeichnet. Die silberhaltigen Silberbronzen zeichnen sich durch eine hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit sowie gute Festigkeitseigenschaften aus. Als silberfarbene Silberbronze bezeichnet man auch eine Legierung aus 98 Prozent Zinn und 2 Prozent Zink. zurück Bezeichnung für die zweitniedrigste Medaillenstufe, die zu Ehrenzwecken (z. B. bei guten Ausstellungsergebnissen oder sonstigen Verdiensten) vergeben werden kann. zurück Alternative Bezeichnung für den portugiesischen Cruzado de prata. zurück Am 02.04.1792 wurde durch Beschluß des Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika verfügt, eine Silbermünze mit dem Namen "Dollar" zu schaffen, nachdem er bereits 1785 als Währungseinheit beschlossen worden war. Der Dollar (angelsächische Übersetzung des deutschen Worts "Talers") wurde in 100 Cents unterteilt. Die ersten Silberdollars wurden im Jahre 1794 geprägt. Die variantenreichen ersten Jahrgänge der Silberdollars bis 1803 wurden nur in relativ kleinen Auflagen geprägt und sind heute gesuchte Raritäten. Auch die Silberdollars der zweiten Prägeperiode von 1840-1873 sind selten. Erst die sogenannten Morgan Dollars, benannt nach ihrem Medailleur George T. Morgan, die von 1878 bis 1921 geprägt wurden, sind relativ häufig und noch heute zu erschwinglichen Preisen erhältlich. Die schönen Motive dieser ersten Silberdollars der amerikanischen Liberty und Adler finden sich heute in abgewandelter Form noch auf den "Silber-Eagles" (Silberadlern), die jährlich mit neuer Jahreszahl vom Schatzamt der Vereinigten Staaten herausgegeben werden. In den 20er und 30er Jarhen gab es den sogenannten Peace Dollar, und schließlich lebte die Tradition der US-Silberdollars 1971 mit dem Porträt des zwei Jahre zuvor verstorbenen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower und dem Weißkopf-Seeadler auf der Rückseite wieder auf. Die modernen Silberdollars sind als Gedenkmünzen wichtigen Ereignissen und Jubiläen gewidmet. zurück Deutsche Bezeichnung für Tam-bac-tron. zurück zurück Die Sammlung an Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland zu fünf und zehn Deutsche Mark wird durch die neuen Silber- und Gold-Euros erst komplett. Ab 2002 gab das Bundesfinanzministerium fünf Silber-Euro-Gedenkmünzen zu 10 Euro pro Jahr heraus. Ab 2003 bis zur Fußball-WM 2006 erschien jährlich zusätzlich noch eine sechste silberne Fußball-Euro-Münze. Seit 2010 gab es eine mehrteilige Serie in Gold zum Thema "Deutscher Wald". Die Themen für 2002 waren beispielsweise "Übergang zur Währungsunion – Einführung des Euro", "100 Jahre U-Bahn in Deutschland", "Kunstausstellung Documenta", "Museumsinsel Berlin" und "50 Jahre Deutsches Fernsehen". Die Themen für 2003 waren "Industrielandschaft Ruhrgebiet", "100 Jahre Deutsches Museum München" und "200. Geburtstag des Chemikers Justug von Liebig". zurück zurück Bezeichnung für die zweithöchste Medaillenstufe, die zu Ehrenzwecken (z. B. bei guten Ausstellungsergebnissen oder sonstigen Verdiensten) vergeben werden kann. zurück Beim "Silbergroschen" handelt es sich um eine preußische Scheidemünze zu 12 Pfennig, die von 1821 bis 1873 aus Billon (222/1000 fein) im Gewicht von 2,19 g geprägt wurden. 30 Silbergroschen gingen auf den preußischen Taler. Die Vorderseite zeigen die Köpfe der preußischen Regenten und die Rückseite die Wertzahl, Wertbezeichnung, Jahresangabe und Münzzeichen. Es gab auch Halbstücke und seit 1842 auch 2 1/2-Stücke. Auch die österreichischen Dreikreuzer oder Kaisergroschen aus dem 16./17. Jh. werden gelegentlich als "Silbergroschen" bezeichnet. zurück Alternative Bezeichnung für Zweidritteltaler. Zur Vermeidung von Verwechslungen mit dem Goldgulden werden die aus Silber geprägten Gulden und Zweidritteltalern zu 60 Kreuzern (nach dem Leipziger Münzfuß) "Silbergulden" genannt. Auch die nach dem Konventionsfuß geprägten Halbtaler werden als Silber- oder Konventionsgulden bezeichnet. zurück Hierbei handelt es sich um eine Silberwährung, deren Währungseinheit an den Wert einer Menge an Feinsilber gebunden ist. Im Gegensatz zur Silberwährung wird hier aber auf den Umlauf von Silbermünzen verzichtet. Wenn der Notenbank eine größere Menge an Banknoten vorgelegt wurde, mußte sie in Silberbarren eingelöst werden können, also durch die Silberreserven der Notenbank gedeckt sein. zurück zurück Hierbei handelt es sich um Kurantmünzen aus Silber. zurück "Silberling" ist die biblische Bezeichnung für die jüdischen Silbermünzen. zurück Bei der "Silbermark" handelt es sich nicht um ein Zahlungsmittel, sondern um eine Rechnungseinheit. Die Silbermark wurde in Richtpfennige (256 Stück), seit dem 14. Jh. zusätzlich in Heller (512 Stück), seit dem 16. Jh. noch genauer in Ässchen (4352) unterteilt. zurück Bezeichnung für die mittlere Medaillenstufe, die zu Ehrenzwecken (z. B. bei guten Ausstellungsergebnissen oder sonstigen Verdiensten) vergeben werden kann. zurück zurück Der &&"Silberne Reiter"&& ist ein Taler der Niederlande, benannt nach der Darstellung auf der Vorderseite eines geharnischten Reiters mit Schwert auf galoppierendem Pferd. Darunter befindet sich das Provinzialwappen. Die Rückseite zeigt den von zwei Löwen gehaltenen gekrönten Löwenschild der Generalstaaten. In der Umschrift steht "CONCORDIA RES PARVAE CRESCVNT" ("Die kleinen Dinge wachsen durch Eintracht"). Die "Niederländisch Zilveren Rijder" genannte Silbermünze wurde 1659 mit einem Gewicht von 32,78 g (941/1000 fein) in der Provinz Holland eingeführt und im Laufe der 2. Hälfte des 17. Jh. bei leicht verringertem Gewicht und Feingehalt und in nur wenig veränderter Form von allen Provinzen der Generalstaaten geschlagen. Sie entsprach im Wert dem Dukaton der Habsburgischen (Südlichen) Niederlande. Es gab auch Halbstücke. zurück Beim "Silbernen Vlies" (französisch: "Toison d'or"; niederländisch: "Zilveren Vliesen") handelt es sich um eine Silbermünze, die von Herzog Philipp dem Schönen von Burgund im Jahre 1499 zum Gedenken an die Stiftung des Ordens vom Goldenen Vlies durch seinen Großvater eingeführt wurde. zurück Der Pandabär ist das Nationaltier von China und er ernährt sich ausschließlich von Bambus. Seit 1982 werden Goldmünzen als "Gold-Pandas" und seit 1983 auch Silbermünzen als "Silber-Pandas" geprägt, beide aber nur in limitierter Auflage und somit haben sie ein hohes Wertsteigerungspotential. Jährlich erscheinen neu gestaltete Panda-Münzen, die den Kleinbären mal beim Bambus knabbern oder mal beim Spielen zeigen. Auf den gemeinsamen Rückseiten ist die 32 m hohe, dreistöckige Halle der Jahresgebete im Pekinger Himmelstempel zu sehen. zurück Dies ist die Bezeichnung einer feinen, dunklen und regelmäßigen Patina, die sich durch die Verbindung von Schwefelteilchen mit dem Silber im Laufe der Zeit auf Silbermünzen bilden kann. Ein feiner und regelmäßiger Silberbelag ist bei den Münzsammlern durchaus beliebt. zurück zurück Alternative Bezeichnung für Silbermünze. zurück Der "Silberpreis" entsteht aus dem Zusammenspiel fundamentaler Marktdaten wie Angebot von und Nachfrage nach Silber, wird aber auch von Emotionen, von eher kurzfristigen Ereignissen und Spekulationen wie auch von langfristigen Erwartungen beeinflußt. Weitere Faktoren, die auf den Silberpreis Einfluß nehmen, sind der Ölpreis und der aktuelle Wechselkurs des US-Dollars, da Silber in dieser Währung gehandelt wird. zurück Deutsche Bezeichnung für den Quinarius nummus. zurück Deutsche Bezeichnung für einen Real aus Silber, womit speziell der spanische Real de Plata und der portugiesische Real de prata gemeint ist. zurück Als "Silberreserve" werden nationale Silberbestände bezeichnet, die meist im Verantwortungsbereich einer Zentralbank oder eines Finanzministeriums stehen. Der Zweck nationaler Silberreserven bestand früher zumeist in der Deckung von Währungen (Silberstandard). Heute wird Silber vorwiegend als nationale Reserve für Krisenzeiten aufbewahrt. Der Staat kann durch Verkäufe unerwartete Sonderausgaben bestreiten und sich damit gegen Katastrophen absichern. zurück Im Gegensatz zum Goldschmied, dessen Schwerpunkt nach Ausbildung und Tätigkeit bei der Gestaltung und Herstellung von Schmuck liegt, ist der "Silberschmied" derjenige, der aus den Materialien sakrales Gerät und profanes Gerät in Form von Gefäßen und Eßbestecken herstellt. zurück Ein "Silberstandard" ist ein Standard, unter dem der Geldwert in den verwendeten Währungseinheit als Wert einer feststehenden Menge von Silber definiert wird. Üblicherweise ist ein Silberstandard mit der Prägung und dem Umlauf von Silbermünzen verbunden. In Deutschland gab es von ca. 800 bis 1871 eine Silberstandardwährung. In einer solchen wird der Preis jeder Ware oder Dienstleistung mit dem Wert des Silbers verglichen bzw. auf diesen bezogen. Nun kann man diesen Wert nicht für alle Zeiten als absolut stabil ansehen, sondern es bildet sich vielmehr ein ungefährer Preismittelwert über eine längere Zeitepoche heraus, der maßgeblich von den Silberbeschaffungskosten und psychologischen Faktoren abhängig ist. Dieser Wert kann durchaus nach oben oder unten schwanken. Silber stellt letztendlich auch eine Ware dar, die nach Angebot und Nachfrage gehandelt wird. Auf jeden Fall war dieser Wert relativ stabiler als bei unserer heutigen Papierwährung, die nur noch von "Treu und Glauben" des Bürgers an die Regierenden, Währungsspekulanten bzw. von der Zentralbank abhängt. Der Wertbezug der Währung auf ein Währungsmetall bedeutete somit eine größere Unabhängigkeit vom Willen der Obrigkeit, die den internationalen Silberpreis damals nicht so einfach manipulieren konnte, wie es heute mit der modernen "Papier- und Giralgeldwährung" geschehen kann. Gleichzeitig zur Zeit des Silberstandards umlaufende Goldmünzen hatten einen Kurs zum Silberkurantgeld, der auf den Kurszetteln der Börsenplätze ablesbar war. Die parallel zum Silbergeld gleichzeitig umlaufenden Goldmünzen hatten im Binnenland die Funktion von Sondergeld bei der Bezahlung höchstwertiger Güter sowie häufig auch noch die Funktion von Handelsmünzen mit dem Ausland, während dann das Silberkurant- und Scheidemünzgeld für die gewöhnliche, übliche Zahlung vorgesehen war. zurück zurück Alternative Bezeichnung für Silbermünze. zurück zurück Bei einer "Silberumlaufswährung" dienen Silbermünzen als Zahlungsmittel. Daneben gibt es Banknoten, die jederzeit in Silber umgetauscht werden können. zurück Von einer "Silberwährung" spricht man, wenn die Kurantmünzen in Silber ausgeprägt werden, der Wert einer Münzeinheit sich nach dem Wert ihres Gehalts an Feinsilber richtet. Wenn sich Papiergeld im Umlauf befand, mußte dies in Silber einlösbar sein. Seit der Münzreform von Karl dem Großen galt in Mitteleuropa die Silberwährung. In der Neuzeit herrschte in weiten Teilen der Welt Silberwährung. Als im 19. Jh. zunehmend manipulierte Paierwährungen erschienen, wurde das Gold immer wichtiger. Mit der in der 2. Hälfte des 19. Jh. beginnenden Silberentwertung rückten die Staaten zunehmend von der Silberwährung ab, zuletzt China 1935. Die silbernen Umlaufmünzen wurden damit zu Scheidemünzen. Spätestens in den 60er Jahren des 20. Jh. verzichteten die letzten Staaten auf Silber für die Münzprägung ihrer Umlaufmünzen. Anstelle des Silbers traten billigere Münzwerkstoffe (Schichtwerkstoffe, Legierungen aus unedlen Metallen). zurück &&Sildeflas&& ist die volkstümliche Bezeichnung des kleinen norwegischen Skilling aus Kupfer, der 1812 unter König Friedrich (Frederik) VI. ausgegeben wurde. Die Vorderseite zeigt das bekrönte Monogramm des Königs und die Rückseite die Inschrift "I/SKILLING/DANSK/1812" und das Münzzeichen (Hammer und Bergeisen) der norwegischen Münzstätte in Kongsberg. Die skandinavische Bezeichnung "Sildeflas" bedeutet "Heringsschuppe". zurück Englisch und lateinisch für Schlesien. zurück Französisch für Schlesien. zurück Alternative Schreibweise für Silizium. zurück   Als "Siliqua" wurde eine römische Silbermünze bezeichnet, die unter Konstantin dem Großen (307-337 n.Chr.) um 320 n.Chr. eingeführt wurde und den Argenteus ersetzte. Die "Siliqua" entsprach 1/24 Solidus und ihr ursprüngliches Gewicht betrug ca. 3,4 g. Sie wurde aber schon untergewichtig ausgebracht. Unter Constantius II. (337-361 n.Chr.) erfolgte die Ausgabe einer "Neusiliqua" zu reduziertem Gewicht von ca. 2,25 g, die also etwa 2/3 des Gewichts der "Altsiliqua" entsprach, die kurzfristig noch parallel ausgemünzt wurde. Die näheren Umstände der Neuausgabe sind ungeklärt, wahrscheinlich wurde damit eine Erhöhung des Silberwertes so ausgeglichen, daß das Wertverhältnis der reduzierten "Siliqua" zum Solidus (24:1) unangetastet blieb. Es gab auch Halbstücke der Siliqua. Die oftmals untergewichtig ausgebrachten Stücke erschweren die Unterscheidung, ob es sich um eine gewichtsreduzierte Siliqua oder eine Halb-Siliqua handelt. Im Ostteil des Römischen Reiches hielt sich die Siliqua (als halbe Miliarense) bis in die byzantinische Zeit und in den westlichen Münzstätten wurde sie (gewichtsreduziert) bis ins 7. Jh. geprägt. Als "Siliqua" wurde eine römische Silbermünze bezeichnet, die unter Konstantin dem Großen (307-337 n.Chr.) um 320 n.Chr. eingeführt wurde und den Argenteus ersetzte. Die "Siliqua" entsprach 1/24 Solidus und ihr ursprüngliches Gewicht betrug ca. 3,4 g. Sie wurde aber schon untergewichtig ausgebracht. Unter Constantius II. (337-361 n.Chr.) erfolgte die Ausgabe einer "Neusiliqua" zu reduziertem Gewicht von ca. 2,25 g, die also etwa 2/3 des Gewichts der "Altsiliqua" entsprach, die kurzfristig noch parallel ausgemünzt wurde. Die näheren Umstände der Neuausgabe sind ungeklärt, wahrscheinlich wurde damit eine Erhöhung des Silberwertes so ausgeglichen, daß das Wertverhältnis der reduzierten "Siliqua" zum Solidus (24:1) unangetastet blieb. Es gab auch Halbstücke der Siliqua. Die oftmals untergewichtig ausgebrachten Stücke erschweren die Unterscheidung, ob es sich um eine gewichtsreduzierte Siliqua oder eine Halb-Siliqua handelt. Im Ostteil des Römischen Reiches hielt sich die Siliqua (als halbe Miliarense) bis in die byzantinische Zeit und in den westlichen Münzstätten wurde sie (gewichtsreduziert) bis ins 7. Jh. geprägt.zurück "Silizium" (auch: Silicium) ist ein chemisches Element mit dem Elementzeichen "Si" und der Ordnungszahl 14. Es ist ein klassisches Halbmetall, weist daher sowohl Eigenschaften von Metallen als auch von Nichtmetallen auf und ist ein Elementhalbleiter. Reines, elementares Silicium besitzt eine grau-schwarze Farbe und weist einen typisch metallischen, oftmals bronzenen bis bläulichen Glanz auf. zurück In Schweden wurde der "Silverpenning" (deutsch: "Silberpfennig") zum letzten Mal im Jahr 1548 geprägt. Es galten 8 Penninge = 1 Örtug. zurück Als "Silver three-cents" werden die zwischen 1851 und 1873 geprägten 3 Cent-Stücke der USA aus Silber bezeichnet. zurück  Die Republik &&Simbabwe&& (englisch: Zimbabwe, übersetzt: "Steinhäuser" in der Sprache der Shona) ist ein Staat im südlichen Afrika. Der Name "Simbabwe" geht auf die heute "Great Zimbabwe" genannte Ruinenstätte zurück, die größten vorkolonialen Steinbauten im südlichen Afrika. Die Republik &&Simbabwe&& (englisch: Zimbabwe, übersetzt: "Steinhäuser" in der Sprache der Shona) ist ein Staat im südlichen Afrika. Der Name "Simbabwe" geht auf die heute "Great Zimbabwe" genannte Ruinenstätte zurück, die größten vorkolonialen Steinbauten im südlichen Afrika.Die Republik Rhodesien nahm am 01.07.1979 den Namen Rhodesien-Simbabwe an und heißt seit dem 18.04.1980 Simbabwe. Amtssprache: Englisch, gesprochen werden vorwiegend Shona und Ndebele Hauptstadt: Harare Staatsform: diktatorisches Präsidialregime, nominell Republik Fläche: 390.757 qkm Einwohnerzahl: 11,750 Mio. (2006) Bevölkerungsdichte: 30 Einwohner pro qkm BIP/Einwohner: 1.045 US-Dollar (2005) Unabhängigkeit von Großbritannien: 18.04.1980 Zeitzone: UTC +2 Währung: 1 Simbabwe-Dollar = 100 Cents zurück Der "Simbabwe-Dollar" (ISO-4217-Code: ZWL; Abkürzung: Z.$) ist die Währung von Simbabwe. Es gilt 1 Simbabwe-Dollar = 100 Cents. Die neue Währung löste bei der Unabhängigkeit des Landes im Jahre 1980 den Rhodesien-Dollar im Verhältnis 1:1 ab. Beide Währungen liefen zunächst parallel weiter. Erst im Laufe des Jahres 1981 wurde der "Rhodesien-Dollar" aus dem Verkehr gezogen. Heute ist der "Simbabwe-Dollar" wegen der hohen Inflation praktisch wertlos und zur Zeit außer Kraft gesetzt. Simbabwes Inflationsrate liegt bei mehreren Millionen Prozent und innerhalb von wenigen Tagen findet eine Verdoppelung der Preise statt. zurück Als "Simmerl" wurde das im Deutschen Reich zwischen 1873 und 1877 geprägte "kleine" 20-Pfennig-Stück bezeichnet. zurück Thomas Simon (geb. ca. 1623; gest. 1665) war ein bedeutender englischer Medailleur und Münzgraveur. Er war vielleicht der begabteste englische Stempelschneider. Bereits seit Ende der 30er Jahre arbeitete Simon für die gegen König Charles I. revoltierenden Schotten, seit der Mitte der 40er Jahre für die aufständischen Puritaner. Schon seine Porträtmedaillen auf zeitgenössische Puritaner zeigen seinen prägnanten Stil, der weniger fein und zierlich als der von Nicolas Briot ist. Durch Verzicht auf die sonst üblichen barocken Verzierungen und bei scharfer Konturierung der Höhenunterschiede des Gesichts, Halses usw. erreichte er einen Zug von Realismus und Strenge, die den Charakter seiner Modelle zutreffend darstellt. 1649 wurde er Chefgraveur an der Münzstätte in London und schnitt für ein Jahrzehnt die meisten Münzen und Siegel für England, Schottland und Irland. Mit der Cromwell crown (1658), die nicht zu den regulären Münzprägungen von England zählt, gelang ihm ein hervorragendes Porträt Oliver Cromwells. Sie wird noch übertroffen von dem Porträt König Karls II. auf der Petition crown (1663), einer Nachahmung der Crown von Jean Roettiers. Dieser hatte auf Grund der Protektion des Königs Simon als Chefgraveur abgelöst. Auch wenn die Probemünze Simons künstlerisch dem roettierschen Vorbild weit überlegen war, erfüllte sich seine Hoffnung auf Wiedereinsetzung in den alten Posten nicht. Er mußte sich mit der zweitrangigen Stellung eines Siegelschneiders zufrieden geben und starb 1665 an der Pest. zurück Alternative Bezeichnung für Simpuvium. zurück "Simpuvium" (auch: Simpulum) ist die Bezeichnung eines der ältesten römischen Pontifikalgeräte in Form einer Schöpfkelle aus Ton. Sie wurde im täglichen Gebrauch durch den metallenen Kyathos verdrängt, hielt sich aber als Kultgegenstand zum Schöpfen des Trankopfers (Weinspende). Das "Simpuvium" erscheint auf römischen Münze auch als Abzeichen des Pontifex. zurück Englisch für "ähnlich" (dänisch: lignende, französisch: analogue, niederländisch: analoog, portugiesisch: idéntico, spanisch: parecido). zurück Alternative Bezeichnung für Parallelwährung. zurück Portugiesisch für "Zeichen" (dänisch: tegn, englisch: mark bzw. sign, französisch: signe, italienisch: segno, niederländisch: teken, spanisch: signo). zurück Eigenname von Singapur. zurück  &&Singapur&& (amtlich: Republik Singapur, englisch: Republic of Singapore, malaiisch: Republik Singapura, chinesisch: Xinjiapo) ist ein Insel- und Stadtstaat sowie das kleinste Land in Südostasien. Der Staat Singapur liegt südlich der Johorstraße unmittelbar vor dem Südende der Hinterindischen und der Malaiischen Halbinsel, auch Malakka-Halbinsel genannt. Dort befindet er sich zwischen Malaysia im Norden und Indonesien im Süden auf einer Hauptinsel, drei größeren und etwa 50 kleineren weiteren Inseln. &&Singapur&& (amtlich: Republik Singapur, englisch: Republic of Singapore, malaiisch: Republik Singapura, chinesisch: Xinjiapo) ist ein Insel- und Stadtstaat sowie das kleinste Land in Südostasien. Der Staat Singapur liegt südlich der Johorstraße unmittelbar vor dem Südende der Hinterindischen und der Malaiischen Halbinsel, auch Malakka-Halbinsel genannt. Dort befindet er sich zwischen Malaysia im Norden und Indonesien im Süden auf einer Hauptinsel, drei größeren und etwa 50 kleineren weiteren Inseln.Nach Auflösung der Kolonie Straits Settlements am 01.04.1946 war Singapur eine eigenständige britische Kronkolonie, die bis 1948 unter britischer Militärverwaltung stand. Bis 1955 gehörten auch die Kokos-Inseln und bis 1957 auch die Weihnachts-Insel dazu. Am 03.06.1959 erhielt Singapur die Autonomie und wurde am 01.09.1963 unabhängig. Vom 16.09.1963 bis zum 08.08.1965 war es ein Teilstaat von Malaysia. Amtssprache: Malaiisch, Chinesisch, Tamilisch, Englisch Hauptstadt: Singapur Staatsform: Republik Fläche: 704 qkm Einwohnerzahl: 4,425 Mio. (2005) Bevölkerungsdichte: 6479,8 Einwohner pro qkm BIP/Einwohner: 28.368 US-Dollar (2005) Unabhängigkeit: 09.08.1965 Zeitzone: UTC + 8 Währung: Singapur-Dollar zurück Der "Singapur-Dollar" (ISO-4217-Code: SGD; Abkürzung: S$) ist die Währung von Singapur. Das "Board of Commissioners of Currency, Singapore" (BCCS) hat das alleinige Recht, Banknoten und Münzen herauszugeben. Der "Singapur-Dollar" ist eine frei gehandelte Währung, die über einen Warenkorb mit anderen Währungen durch die Behörde "Monetary Authority of Singapore" überwacht wird. Aus welchen Währungen sich dieser zusammensetzt, wird geheim gehalten, um zu verhindern, daß Spekulanten die Währung angreifen oder von außen Druck auf den "Singapur-Dollar" ausgeübt werden kann. Der "Singapur-Dollar" hat einen festen Wechselkurs von 1:1 mit dem Brunei-Dollar. Die Geldscheine und Münzen beider Staaten sind auch im jeweils anderen Staat gültiges Zahlungsmittel. Es gibt Banknoten zu 2, 10, 50, 100, 1.000 und 10.000 Singapur-Dollar, sowie Münzen zu 1, 5, 10, 20 und 50 Cents und 1 Singapur-Dollar. zurück Italienisch für "links" (dänisch: venstre, englisch: on the left bzw. left, französisch: à gauche bzw. gauche, niederländisch: links, portugiesisch: esquerdo, spanisch: izquierda). zurück Alternative Bezeichnung für Symbol. zurück Alternative Bezeichnung für "Devise" oder "Motto". zurück Sinope ist eine Stadt in Paphlagonien and der Südküste des Schwarzen Meeres, die seit ca. 500 v.Chr. eine wichtige Münzstätte besaß. Ab 420 bis Ende des 4. Jh. wurden dort Drachmen mit dem Kopf der Nymphe Sinope auf der Vorderseite und einem Seeadler auf einem Delphin über dem Stadtnamen auf der Rückseite geschlagen. Im 3. Jh. wurden Kleinsilbermünzen und Bronzemünzen angefertig, die im nordwestlichen Kleinasien weit verbreitet waren. zurück Sint Maarten ist seit dem 10. Oktober 2010 ein eigenständiges Land innerhalb des Königreiches der Niederlande. Zuvor gehörte es bis zu deren Auflösung zu den Niederländischen Antillen. Sint Maarten besteht aus dem südlichen Teil der Karibik-Insel St. Martin sowie einigen sehr kleinen und unbewohnten Nebeninseln und Felsen (darunter Pelican Cay, Molly Beday, Cow and Calf, Hen and Chicks). Der nördliche Teil der Insel wird vom französischen Überseegebiet Saint-Martin eingenommen. Sint Maarten ist eine Offshore-Zone. Die Firmen, die auf Sint Maarten registriert sind und im niederländischen Teil der Insel keine Geschäfte betreiben, sind von den Steuern befreit. Weiterhin gibt es keine Eigentums- und Kapitalertragsteuern. Die Mehrwertsteuer beträgt fünf Prozent. Offizielle Währung ist der Karibische Gulden, bezahlt werden kann aufgrund des festen Wechselkurses in der Regel auch mit dem US-Dollar. Mit der 2010 durchgeführten Auflösung der Niederländischen Antillen ist das Ende der Währung beschlossen. Für die besonderen Gemeinden Bonaire, Saba und Sint Eustatius wurde die Landeswährung am 1. Januar 2011 durch den US-Dollar abgelöst. Ende August 2009 wurde auf einer mit Fachleuten besetzten Konferenz in Willemstad auch für Curacao und Sint Maarten die Dollarisierung diskutiert. Diese Lösung hatte zwangsläufig die Abschaffung des Antillen-Gulden zur Folge. 2012 wurde die Umwandlung zum Karibischen Gulden abgeschlossen. An Stelle der Banknoten zu 25 und 250 Gulden gibt es dann Banknoten zu 20 und 200 Gulden. In der Tourismusbranche wird oftmals auch der Euro akzeptiert. zurück "Sio" ist die Bezeichnung des thailändischen 2-Att-Stücks aus Silber, das zuletzt aus Kupfer geschlagen wurde und auch Phai genannt wird. zurück Französisch für Sitten. zurück Sirmur war ein indischer Feudalstaat. zurück Sisak (lateinisch: Siscia) ist eine Stadt im heutigen Kroatien. Die Stadt liegt an der Mündung der Kupa in die Save. Dort wurde 294 n.Chr. zur Zeit der Römer die damals wichtigste Münzstätte auf dem Balkan eröffnet. zurück Lateinischer Name der Stadt Sisak. zurück Hierbei handelt es sich um ein altägyptisches Schlaginstrument in Form von durch ein gebogenes Blech gesteckten Metallstäbchen. Das "Sistrum" war im Römischen Reich Zeichen des Isiskults und ist meist als Beizeichen der Göttin Isis auf Alexandrinern (römischen Provinzialpraegungen aus dem ägyptischen Alexandria) dargestellt. zurück Sitten (französisch: Sion, lateinisch: Sedunum, walliserdeutsch: Sittu) an der Mündung der Sionne in die Rhone ist der Hauptort des Kantons Wallis in der Schweiz. 580 wurde der Bischofssitz von Martigny hierher verlegt, und seit 999 amtierte der Bischof des Bistums Sitten gleichzeitig als Landesherr. In früherer Zeit gab es in Sitten auch eine bischöfliche Münzstätte. zurück Waliserdeutsch für Sitten. zurück Die "Situla" (deutsch: "Henkeleimer") ist ein metallenes Gefäß der Bronze- und frühen Eisenzeit im etruskisch-italischen Gebiet sowie in der Hallstattkultur. Sie gehört auch zu den Attributen der ägyptischen Göttin Isis. zurück Hierbei handelt es sich um eine venezianische Billonmünze, die für den Umlauf (der venezianischen Besitzung) in Zypern ab 1569 als vierfache Nominale des Carzia geprägt wurde. zurück Beim &&Sixpence&& handelt es sich um eine englische Silbermünze zu 6 Pence, die (gemeinsam mit dem Threepence) als Halbstück des Shilling um 1551 unter König Edward VI. eingeführt wurde. Sie zeigt (wie Shilling und Threepence) auf der Vorderseite die bekrönte Büste des Königs von schräg vorne, rechts daneben die Wertzahl "VI" (Shilling "XII", Threepence "III"). Auf der Rückseite findet man den viergeteilten Wappenschild auf einem Langkreuz. In der Folge zeigen die Sixpence-Stücke häufig ein ähnliches Münzbild wie der Shilling, so z. B. das Vis-à-vis-Porträt von Maria Tudor und Philipp von Spanien nach deren Vermählung 1554 (Bajoire). Nach Vertreibung des katholischen Königs James II. 1688 gab dieser im Rahmen seines Gun Money (aus umgeschmolzenen Kanonen und Glocken) auch den Sixpence aus. Seine Tochter Mary (1688-1694) und ihr protestantischer Ehemann William (Wilhelm von Oranien) gaben 1693 einen Sixpence-Typ aus, der die Büste des Königspaares gemeinsam hintereinander zeigt (auf der Rückseite sind fünf Wappenschilde in Kreuzform angeordnet, in den Winkeln die verschlungenen Initialen "W" und "M"). Die Alleinherrschaft Wilhelm von Oraniens als König William III. (1694-1702) ist gekennzeichnet von einer umfangreichen Neuprägung aller Münzsorten (1696/97), die vor allem den Sixpence betraf. Denn an der Prägung des Sixpence waren nicht nur die meisten Münzstätten beteiligt, es war auch die variantenreichste Prägung aller Nominalen. Unter Königin Viktoria gab es eine lange Reihe des Sixpence mit Stempelnummern über der Jahresangabe. Seit 1947 wurde der Sixpence in Kupfer-Nickel ausgeprägt und verschwand schließlich mit der Einführung der Dezimalwährung 1971. Die Nominale war auch in einigen Kolonien Großbritanniens im Umlauf und war z. B. Bestandteil des zur Kolonialzeit in Nordamerika geprägten Massachusettsgeldes. Der Sixpence ist für den Sammler britischer Münzen recht preisgünstig. zurück Hierbei handelt es sich um eine französische Billonmünze zu 6 Deniers als Halbstück des Douzain, das in der ersten Hälfte des 16. Jh. unter den Königen Ludwig XII. (1498-1515) und Franz I. (1515-1547) ausgeprägt wurde. Im 17. Jh. wurde der "Sizain" nur sporadisch geprägt, zuletzt 1658. Die Münzbilder zeigen, in Entsprechung zum Dizain, meist auf den Vorderseiten den Lilienschild und auf den Rückseiten ein Kreuz. zurück Englisch für "Format" (dänisch: storrelse, französisch: format, italienisch: form, niederländisch: formaat, portugiesisch: formato, spanisch: tamano). Englisch für "Größe" (dänisch: storrelse, französisch: grandeur, italienisch: grandezza, niederländisch: grootte, portugiesisch: tamanho, spanisch: tamano). zurück Wegen seiner zentralen Lage im Mittelmeer hat Sizilien eine wechselvolle Geschichte und als Stützpunkte für Seefahrt und Handel hatten die Städte Siziliens stets eine große Bedeutung. Um das Jahr 1.000 v.Chr. war Sizilien hauptsächlich von drei Völkern besiedelt, den Sikanern, den Sikulern und den Elymern. Es folgte ab etwa 800 v.Chr. eine Periode der Kolonialisierung durch Phöniker, Griechen und Karthager beziehungsweise Punier. Die bedeutendste griechische Stadt Siziliens war Syrakus. Die Blütezeit endete, als die Karthager am Ende des 5. Jh. v.Chr. fast alle bedeutenden griechischen Städte zerstörten. Die meisten zerstörten Städte wurden zwar später wieder aufgebaut, erreichten aber nicht mehr ihre ursprüngliche Größe. Während des 1. Punischen Krieges wurde Sizilien im Jahr 241 v.Chr. durch den römischen Sieg bei den Ägadischen Inseln zur ersten Provinz des Römischen Reiches. Nach dem Untergang des Westreichs im 5. Jh. wurde Sizilien zunächst von den Vandalen und Ostgoten beherrscht und kam im 6. Jh. zum Byzantinischen Reich. In die Zeit von 835 bis 884 fielen diverse Beutezüge der Araber gegen sizilianische Städte. Eine weitere Blütezeit erlebte Sizilien, nachdem es im 11. Jh. von den Normannen erobert worden war und zu einem eigenständigen Königreich wurde. Auch unter den Staufern dauerte diese Blüte noch an. Danach geriet Sizilien wieder unter die Kontrolle ausländischer Mächte. Aragon, Spanien, Savoyen und Österreich folgten aufeinander. Unter den spanischen Bourbonen kam Sizilien zum Königreich Neapel, das nach dem Wiener Kongreß zum Königreich beider Sizilien wurde und Sizilien und Unteritalien umfaßte, wobei die Hauptstadt jedoch Neapel blieb. Mit der Vereinigung Italiens, die mit Garibaldis Invasion in Sizilien begann, kam Sizilien 1861 zu dem neuen Königreich Italien. zurück Die griechischen Münzen aus den antiken Städten aus Sizilien werden oft als die schönsten, griechischen Münzen überhaupt bezeichnet. Aber auch später zog es immer wieder fremdländische Herrscher auf die Insel, wie z. B. den byzantinischen Kaiser Konstans II. (630-668), der 659 seine Hauptstadt nach Syrakus verlegte. Dort prägte er Münzen aus Bronze, aber auch aus Gold. 878 wurde die Insel von den Arabern erobert, die aber auch Konkurrenz durch die Normannen erhielten. Arabische Münzen wurden meist in Palermo, normannische in Messina geprägt. Unter Kaiser Friedrich II. breitete sich das sizilianische Königreich auch auf dem Festland bis nördlich von Neapel aus. 1231 erließ der Kaiser sein Münzedikt, wobei er den an den antiken Aurei angelehnten Augustalis einführte. Aber auch die nachfolgenden Herrscher hinterließen münzgeschichtliche Spuren, wie Anjou und Aragon, Johanna II. von Neapel und Ludwig XII. von Frankreich, Karl V. und Philipp II. von Spanien. Die letzten Münzen wurden 1859 unter Francesco II. geprägt, nachdem Garibaldi ein Jahr zuvor Sizilien für Italien erobert hatte. zurück Dänisch für "selten" (englisch und französisch: rare sowie englisch: scare, italienisch, portugiesisch und spanisch: raro, niederländisch: zeldzaam). zurück Länderkennzeichen für die Slowakei. zurück Alternative Schreibweise für Scherf. zurück Dänisch für "dezentriert" (englisch: off-centre, französisch: mal centré, italienisch: fiori centro, niederländisch: gedecentreerd). zurück Hierunter versteht man im Allgemeinen die Gegend der nordeuropäischen Staaten Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. zurück Der 1873 von Dänemark und Schweden gegründeten Münzunion trat 1875 auch Norwegen bei. Nach Umstellung von Silber- auf Goldwährung im Dezimalsystem (100 Öre = 1 Krone) galten die Münzen (gleiche Größe und Legierung) der einzelnen Staaten im gesamten Gebiet der "Skandinavischen Münzunion", später auch die Geldscheine. Aus Gold wurden Stücke zu 10 Kronen (4,4803 g schwer) und 20 Kronen (8,9606 g), nur in Schweden seit 1881 auch 5-Kronen-Stücke (2,24 g) geprägt, alle 0.900 fein. Als Scheidemünzen wurden 0.800 feine 1- (7,5 g) und 2-Kronen-Stücke (15 g,), 10- (0.400 fein), 25- und 50-Öre-Stücke (beide 0.600 fein) in Silber sowie kleinere Werte zu 1, 2 und 5 Öre in Bronze geprägt. Schon während des 1. Weltkriegs traten Kursverschiebungen auf, der länderübergreifende Münzumlauf und die Einlösungspflicht von Papiergeld in Gold wurden weitgehend aufgehoben. Schließlich wurde die "Skandinavische Münzunion" 1924 aufgelöst. Dänemark versah die Stücke von 1 bis 25 Öre mit einem Zentralloch und prägte die höheren Werte in Aluminium-Bronze. Norwegen behielt die 1-, 2- und 5-Öre-Stücke bei, die 10- bis 50-Öre-Stücke und das 1-Kronen-Stück erschienen (mit Ausnahme der deutschen Besatzungsmünzen im 2. Weltkrieg) von 1924 bis 1951 gelocht. Schweden behielt seine alten Typen weitgehend bei. zurück "Skar" (auch: Skarung) ist eine tibetische Kupfermünze, die 1/10 Sho oder 1/15 Tangka galt. Ein früher Typ (Vorderseite ein Drachen im gepunkteten Kreis, darum tibetische Schriftzeichen, Rückseite im Zentrum eine stilisierte Lotusblume im Perlkreis, darum vier chinesische Schriftzeichen) ist noch nach der Regierungsepoche "Hsüan Tung" des letzten chinesischen Kaisers (1909-1911) datiert. Davon gab es auch Halbstücke. Danach erschienen nur noch Mehrfachstücke (2 1/2, 5 und 7 1/2-Stücke) nach zyklischer Datierung auf Basis des tibetischen Kalenders. Die verschiedenen Typen und Varianten zeigen meist einen stilisierten Löwen, tibetische Schriftzeichen und buddhistische Symbole. Die Prägung des "Skar" wurde in den beginnenden 20er Jahren des 20. Jh. aufgegeben. Zuletzt erschien 1926 ein 7 1/2-Skar-Stück auf einem mit gerundetem Zackenrand. zurück Dänisch für "scharlachrot" (englisch: scarlet, französisch: écarlate, italienisch: scarlatto, niederländisch: scharlaken, portugiesisch: escarlate, spanisch: escarlata). zurück Alternative Bezeichnung für Skar. zurück Griechisch für Zepter und bedeutet so viel wie "Stab". zurück Dänisch für "schiefer" (englisch: slate, französisch: arboise, italienisch: ardesia, niederländisch: leisteenkleurig, portugiesisch: ardósia, spanisch: pizarra). zurück Skandinavisch für Scheidemünze. zurück Skandinavisch für Scheidemünze. zurück Altgermanischer Ausdruck für Schilling. zurück   Alternative Bezeichnung für Schilling. Diese skandinavische Münze war in Dänemark zunächst eine Rechnungsmünze, bevor sie unter König Christoph III. (1440-1448) aus dem Hause Wittelsbach erstmals nach dem Vorbild des lübischen Schillings ausgeprägt wurde. Es galt 1 Skilling = 12 Penninge. Alternative Bezeichnung für Schilling. Diese skandinavische Münze war in Dänemark zunächst eine Rechnungsmünze, bevor sie unter König Christoph III. (1440-1448) aus dem Hause Wittelsbach erstmals nach dem Vorbild des lübischen Schillings ausgeprägt wurde. Es galt 1 Skilling = 12 Penninge.Ein Jahrhundert später war der dänische Silber-Skilling bereits eine Kleinmünze, die sich schneller verschlechterte als die lübischen Schillinge. Im Jahr 1588 wurden 2 Skilling dänisch (dänisch: Skilling Danske) auf 1 Schilling lübisch (Skilling Lybske) tarifiert. Die dänischen Schillinge wurde als Skilling Courant (96 S.C. = 1 Daler Courant) und als Kronen-Skilling (60 K.S. = 1 Krone) geschlagen. Von 1625 bis zum Staatsbankrott von 1813 galten 16 Skilling eine Mark, 64 Skilling eine Krone und 96 Skilling einen Daler Specie. Da die Scheidemünzen geringwertiger ausgemünzt wurden als die Kronen- oder Talermünzen, berechnete man dem Käufer einer Ware in der Regel ein Agio, wenn er in Skillingmünzen bezahlte. Es gab auch Halb- und Mehrfachstücke. Wichtig wurde das 24-Skilling-Stück, das seit 1731 die Krone als bedeutendste Umlaufmünze ablöste. Durch die Münzreform von 1813 trat der Rigsbank Skilling an seine Stelle. Es galten 192 Rigsbank Skilling (in Holstein 60 Schilling Courant) = 2 Rigsdaler bzw. 1 Daler Specie. Bei Einführung der Dezimalwährung 1873 wurde der Skilling in 2 Öre eingewechselt und aufgegeben. In Norwegen, das lange Zeit von Dänemark (1380-1814) und danach von Schweden (1814-1905) beherrscht war, wurde der Skilling unter König Hans (1481-1512) eingeführt. Die norwegischen Schillinge zeigen häufig das norwegische Wappen (Löwe mit Axt) oder gekreuzte Hammer und Bergeisen als Münzzeichen für die Münzstätte in Kongsberg (seit dem ausgehenden 17. Jh.). Die norwegischen Skillinge wurden bei der Einführung der Dezimalwährung 1875 aufgegeben. In Schweden wurde der Skilling 1777 eingeführt, aber erst unter König Gustav IV. Adolf (1792-1809) seit 1802 in Kupfer ausgeprägt. Man unterscheidet (von 1835 bis 1855) den Skilling der Riksgälde-Währung von dem der Bancosedlar-Währung. Letzterer ist an der Aufschrift "Banco" auf der Rückseite zu erkennen. Es galt 1 Skilling Riksgälds = 2/3 Skilling Banco. Es wurden Mehrfachstücke bis 4 Skilling (nur Banco) und Teilstücke bis 1/12 Skilling ausgemünzt. Letztere wurden auch Runstycke genannt. Bei der Einführung der Dezimalwährung (1855) ging Schweden wieder zur Öre-Rechnung (1 Riksdaler Riksmynt = 100 Öre) über. zurück In Schweden wurde der Skilling 1777 eingeführt, aber erst unter König Gustav IV. Adolf (1792-1809) seit 1802 in Kupfer ausgeprägt. Man unterscheidet (von 1835 bis 1855) den Skilling der Riksgälde-Währung von dem der Bancosedlar-Währung. Letzterer ist an der Aufschrift "Banco" auf der Rückseite zu erkennen. Es galt 1 Skilling Riksgälds = 2/3 Skilling Banco. zurück Beim dänischen "Skilling Courant" gingen 96 Skilling Courant auf 1 Daler Courant. zurück "Skilling dänisch" ist die deutsche Bezeichnung für den Skilling Danske, den dänischen Skilling, bei dem im Jahr 1588 2 Skilling dänisch auf 1 Schilling lübisch (Skilling Lybske) tarifiert wurden. zurück Dänisch für Skilling dänisch. zurück Dänisch für Schilling lübisch. zurück In Schweden wurde der Skilling 1777 eingeführt, aber erst unter König Gustav IV. Adolf (1792-1809) seit 1802 in Kupfer ausgeprägt. Man unterscheidet (von 1835 bis 1855) den Skilling der Riksgälde-Währung von dem der Bancosedlar-Währung, letzterer ist an der Aufschrift "Banco" auf der Rückseite zu erkennen. Es galt 1 Skilling Riksgälds = 2/3 Skilling Banco. zurück zurück Alternative Bezeichnung für Sklavenringe. zurück "Sklavenringe" oder Sklavengelder sind keine numismatischen Begriffe, sondern werden in Sammler- und Händlerkreisen manchmal für afrikanische Ringgelder, Manillas oder Drahtringe und -spiralen verwendet, die im Sklavenhandel eine Rolle gespielt haben sollen. Angeblich konnte man früher gegen bestimmte Ringe einen Sklaven eintauschen. Den in die Neue Welt verschleppten afrikanischen Sklaven wurden zur Identifikation auch gelochte Münzen (meist kupferne Tokens) angehängt, die mit einem Zeichen versehen waren. Sie werden im englischsprachigen Raum Slave Tokens genannt. zurück Alternative Bezeichnung für Schoter. zurück Abkürzung für die Schwedische Krone. zurück Dänisch für "schief" (englisch: oblique bzw. slanting, französisch: oblique bzw. incliné, italienisch und portugiesisch: obliquo, niederländisch: schuin, spanisch: oblicuo). zurück zurück Alternative Bezeichnung für Schilling. zurück "Skyphate" (abgeleitet von griechisch "skyphos" = "Becher", lateinisch: "Scyphati") bezeichnet schüsselförmige Münzen aus der späten Zeit des Byzantinschen Reiches. Es gibt verschiedene Münzen aus Gold, Elektron, Billon und Kupfer, die ein schüsselförmig gebogenes Aussehen haben. zurück Dies ist die schwedische Bezeichnung für die 1-Öre-Münze (1669-1778) aus Kupfer. Dänisch ist dies allgemein der Ausdruck für Kleingeld. zurück Englisch für "schief" (dänisch: skrâ, englisch: oblique, französisch: oblique bzw. incliné, italienisch und portugiesisch: obliquo, niederländisch: schuin, spanisch: oblicuo). zurück Polnisch für Schlesien. zurück Friesisch für Schleswig. zurück Friesisch für Schleswig. zurück Friesisch für Schleswig-Holstein. zurück Englisch für "schiefer" (dänisch: skiffer, französisch: arboise, italienisch: ardesia, niederländisch: leisteenkleurig, portugiesisch: ardósia, spanisch: pizarra). zurück Den in die Neue Welt verschleppten afrikanischen Sklaven wurden zur Identifikation auch gelochte Münzen (meist kupferne Tokens) angehängt, die mit einem Zeichen versehen waren. zurück Abkürzung für den Salomonen-Dollar. zurück Aus einem Nekrologium des Domstifts zu Münster um 1170 stammt der Ausdruck "Slegerpennynge" (wörtlich: "Schlageinnahme"), der die Einkünfte des Münzbetriebs meint, also Schlagschatz bedeutet. zurück Dänisch für Schleswig. zurück Dänisch für Schleswig-Holstein. zurück Niederdeutsch für Schleswig-Holstein. zurück Dies ist die volkstümliche dänische Bezeichnung für die dänischen Kronen von 1618 bis 1771. Der Ausdruck bedeutet soviel wie "schlechte Taler". zurück Tschechisch für Schlesien. zurück Abkürzung für "Sammlung" in der deutschsprachigen numismatischen Literatur. zurück zurück Länderkennzeichen für Slowenien. zurück Landesname von Slowenien. zurück Slowakische Bezeichnung für die Slowakei nach der Wiedererrichtung des Staates (2. Republik). zurück Landesbezeichnung der Slowakei und der Slowakischen Republik. zurück Slowakische Bezeichnung für die Slowakei zur Zeit des 2. Weltkriegs (1. Republik). zurück Am 14.03.1939 erklärte sich die &&Slowakei&& von der Tschechoslowakei unabhängig. Die (erste) Slowakische Republik (slowakisch: prvá Slovenská republika) war ein unabhängiger slowakischer Nationalstaat und Verbündeter des Deutschen Reiches während des 2. Weltkriegs zwischen 1939 und 1945. Sie erstreckte sich auf dem Gebiet der heutigen Slowakischen Republik mit Ausnahme der südlichen und östlichen Gebiete und grenzte dabei an das Deutsche Reich und Ungarn sowie kurzzeitig an Polen. Obwohl das Land während seines kurzen Bestehens international großteils anerkannt war, wurde es durch die Siegermächte des 2. Weltkrieges rückwirkend im Zuge der Annullierung des Münchner Abkommens und der Wiener Schiedssprüche für nicht existent erklärt. Die Unterscheidung "Erste Slowakische Republik", oft auch "Slowakischer Staat" (slowakisch: Slovenský štát) wird vor allem vorgenommen, um sie von der seit 1993 unabhängigen heutigen (also zweiten) Slowakischen Republik/Slowakei zu unterscheiden, die nicht als ihr offizieller Nachfolgestaat angesehen wird. Die Bezeichnung "Slowakischer Staat" wurde vor allem während der Zeit des Kommunismus in der Tschechoslowakei (1948–1989) verwendet. Nach der Eroberung durch die Sowjets im Herbst 1944 endete vorläufig diese Unabhängigkeit und die tschechoslowakische Verwaltung wurde wieder errichtet. Am 25.11.1992 beschloß die Bundesversammlung der Tschechoslowakei die Teilung in zwei souveräne Republiken und am 01.01.1993 entstanden die Slowakische und die Tschechische Republik (auch als Tschechien bezeichnet). zurück Alternative Bezeichnung für die Slowakische Krone. zurück Die "Slowakische Krone" gab es von 1939 bis 1945 als Währung der 1. Slowakischen Republik und von 1993 bis 2008 als Währung der Slowakei nach dem Zerfall der Tschechoslowakei. Im Jahre 2009 wurde dann der Euro eingeführt. zurück  Die &&Slowakische Republik&& (slowakisch: Slovenska Republika) ist ein Staat in Mitteleuropa, der 1992/1993 aus der Teilung der Tschechoslowakei hervorging. Er grenzt an Österreich, die Tschechische Republik, Polen, die Ukraine und Ungarn. Seit dem 29.05.2004 ist die Slowakei Mitglied der NATO. Sie gehört seit dem 01.05.2004 zur Europäischen Union. Die &&Slowakische Republik&& (slowakisch: Slovenska Republika) ist ein Staat in Mitteleuropa, der 1992/1993 aus der Teilung der Tschechoslowakei hervorging. Er grenzt an Österreich, die Tschechische Republik, Polen, die Ukraine und Ungarn. Seit dem 29.05.2004 ist die Slowakei Mitglied der NATO. Sie gehört seit dem 01.05.2004 zur Europäischen Union.Amtssprache: Slowakisch Hauptstadt: Bratislava Staatsform: Republik Fläche: 49.035 qkm Einwohnerzahl: 5,431 Mio. Bevölkerungsdichte: 110 Einwohner pro qkm Gründung: 01.01.1993 Zeitzone: UTC+1 MEZ, UTC+2 MESZ (März - Oktober) Währung: Euro (bis Ende 2008: Slowakische Krone) zurück Deutsche Bezeichnung für die Slowakei zur Zeit des 2. Weltkriegs (1. Republik). zurück  &&Slowenien&& (slowenisch: Slovenija) ist ein Staat des ehemaligen Jugoslawiens in Europa, der an Italien, Österreich, Ungarn, Kroatien und die Adria grenzt. Das Land wurde am 01.05.2004 mit neun anderen Beitrittsländern Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Am 01.01.2007 wurde auch der Euro, welcher den slowenischen Tolar ablöste, eingeführt. &&Slowenien&& (slowenisch: Slovenija) ist ein Staat des ehemaligen Jugoslawiens in Europa, der an Italien, Österreich, Ungarn, Kroatien und die Adria grenzt. Das Land wurde am 01.05.2004 mit neun anderen Beitrittsländern Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Am 01.01.2007 wurde auch der Euro, welcher den slowenischen Tolar ablöste, eingeführt.Amtssprache: Slowenisch (regional: Italienisch, Ungarisch) Hauptstadt: Ljubljana Staatsform: Republik Fläche: 20.273 qkm Einwohnerzahl: 2,019 Mio. (2007) Bevölkerungsdichte: 99 Einwohner pro qkm BIP/Einwohner: 21.911 US-Dollar Unabhängigkeit von Jugoslawien: 25.06.1991 Zeitzone: MEZ (UTC+1) Währung: Euro zurück Der "Slowenische Tolar" war - bis zur Einführung des Euro - die Währung von Slowenien. Es galt 1 Tolar = 100 Stotinov. zurück zurück Schlonsakisch für Schlesien. zurück Englisch für "klein" (dänisch: lille, französisch: petit, italienisch: piccolo, niederländisch: klein, portugiesisch: paqueno, spanisch: pequeno). zurück Das Gesetz der US-Regierung vom 21.02.1857 brachte neben dem Umlaufverbot für ausländische Münzen (insbesondere für den spanisch-amerikanischen Peso) eine einschneidende Veränderung der Cent-Prägung. Der auf einem breiten Schrötling im Durchmesser von etwa 28,5 mm beruhende, aufwendige Large Cent (zuletzt im Gewicht von 10,89 g) wurde durch den kleineren und kostengünstigeren "Small Cent" ersetzt, der auf einem kleineren Schrötling im Gewicht von 19 mm beruhte. Noch bevor das Gesetz in Kraft war, prägte man bereits nach einem Entwurf von James Barton Longacre Proben (1856) vom Typ Flying Eagle (Vorderseite fliegender naturalistischer Adler, Rückseite "ONE/Cent" im Kranz), der für die reguläre Prägung übernommen wurde, aber bereits 1859 durch den bis 1809 geprägten Indian Head Cent abgelöst wurde. Darauf folgte der Lincoln Cent, dessen Rückseite 1959 neu gestaltet wurde (Lincoln Memorial Cent). Im Vergleich zum Large Cent war das Gewicht auf 4,67 g nahezu halbiert (später auf 3,11 g und 2,5 g reduziert) und auch das Münzmetall von reinem Kupfer zu einer Legierung aus Kupfer-Nickel (88 Prozent Kupfer, 12 Prozent Nickel) verändert worden (seit 1864 Bronze). Die Small-Cent-Stücke waren im Umlauf kleiner und handlicher und erfreuten sich im Geldverkehr großer Beliebtheit. zurück Die Farbe "smaragd" ist eine Farbe, die bei Banknoten nur recht selten vorkommt (dänisch: smaragdgron, englisch: emerald, französisch: émeraude, italienisch: smeraldo, niederländisch: smaragdgroen, portugiesisch und spanisch: esmeralda). zurück Niederländisch für "smaragd" (dänisch: smaragdgron, englisch: emerald, französisch: émeraude, italienisch: smeraldo, portugiesisch und spanisch: esmeralda). zurück Dänisch für "smaragd" (englisch: emerald, französisch: émeraude, italienisch: smeraldo, niederländisch: smaragdgroen, portugiesisch und spanisch: esmeralda). zurück "SMB" ist die Abkürzung für die Staatliche Münze Berlin. zurück Italienisch für "smaragd" (dänisch: smaragdgron, englisch: emerald, französisch: émeraude, niederländisch: smaragdgroen, portugiesisch und spanisch: esmeralda). zurück Die "Smithsonian Institution" ist eine nach dem englischen Chemiker und Mineralogen James Smithson (1754-1829) benanntes Forschungsinstitut in Washington, der das Institut testamentarisch stiftete. Die 1846 gegründete "Smithsonian Institution" unterhält verschiedene große Museen, darunter u.a. die National Gallery und ein kunsthistorisches Museum. Letzteres beherbergt eine der schönsten Sammlungen von Medaillen der Renaissance, die sog. "Kress Collection". Die numismatische Abteilung des Forschungsinstituts zählt zu den größten der Erde und beschäftigt sich mit allen geldgeschichtlichen Bereichen (u.a. vormünzliche Zahlungsmittel, Münzen, Münztechnik usw.). Das Forschungsinstitut vergibt Stipendien und unterhält ein umfangreiches Verlagsprogramm. In der Smithsonian Institution ist auch die Sammlung der ersten amerikanischen Münzstätte in Philadelphia untergebracht. zurück Smolensk ist eine russische Stadt im Westen Rußlands nahe der Grenze zum heutigen Weißrußland. Die Stadt wurde 863 das erste Mal als eine Stadt der ostslawischen Kriwitschen urkundlich erwähnt. Ihre Lage in der Kiewer Rus an dem entlang des Dneprs verlaufenden Handelsweg von den Warägern zu den Griechen nach Konstantinopel brachte ihr schon früh den Rang einer Handelsstadt ein. Später bestanden auch Handelsbeziehungen zur Hanse. Im 12. Jh. war Smolensk Hauptstadt eines unabhängigen russischen Fürstentums Smolensk, ehe sie 1238 von den Mongolen geplündert wurde. 1404 fiel das Smolensker Gebiet an das Großfürstentum Litauen und wurde 1514 vom Großfürstentum Moskau erobert. 1611, während des Polnisch–Russischen Krieges von 1609–1618, wurde die Stadt nach einer fast zweijährigen Belagerung von polnisch-litauischen Truppen eingenommen, und bildete ab 1618 einen Teil von Polen-Litauen. Erst 1654, während des Russisch-Polnischen Krieges von 1654–1667, wurde die Stadt von den Truppen des Zaren zurückerobert und kam 1667 wieder zu Rußland. 1812 eroberte Napoleon Bonaparte die Stadt auf seinem Weg nach Moskau nach der Schlacht bei Smolensk. In Folge der administrativen Umgestaltungen nach der Februar- und der Oktoberrevolution, einhergehend mit der unübersichtlichen Situation in der Endphase des 1. Weltkriegs und dem beginnenden Russischen Bürgerkrieg kam Smolensk 1917 zur Westlichen Oblast. Die kurzlebige bürgerliche Weißrussische Volksrepublik beanspruchte 1918 die Stadt ebenfalls für sich. Am 01.01.1919 wurde in Smolensk die Sozialistische Sowjetrepublik Weißrussland/Belarus ausgerufent. Am 27.02.1919 wurde diese erste eigenständige weißrussische Sowjetrepublik in dieser Form wieder aufgelöst. Bei der endgültigen Neugründung der Weißrussischen SSR am 31.07.1920 verblieb Smolensk bei der RSFSR. Im 2. Weltkrieg war die Stadt ebenfalls hart umkämpft. In der Kesselschlacht bei Smolensk im Spätsommer 1941 wurde Smolensk besetzt und fast vollständig zerstört. Tausende Bewohner der Stadt kamen ums Leben oder wurden zwischen 1941 und 1943 zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich gebracht. Im Herbst 1943 wurde die Stadt von der Roten Armee zurückerobert. zurück Englisch für "glatt" (dänisch: glat, französisch: uni, französisch: lisse, italienisch: liscio, niederländisch: gaaf, portugiesisch und spanisch: liso). zurück Smyrna ist eine antike Stadt in Kleinasien, die auch eine eigene Münzstätte besaß, in der auch Kistophoren geschlagen wurden. zurück Das Metall, aus dem eine Münze gefertigt ist, hat maßgeblichen Einfluß auf ihren Wert. Bei der Abkürzung "Sn" handelt es sich um das Münzmetall Zinn. zurück Länderkennzeichen für den Senegal. zurück zurück Spanisch für "Zuschlag" (dänisch: tillaeg, englisch: surtax, französisch: surtaxe, italienisch: sopratassa, niederländisch: toeslag, portugiesisch: sobretaxa). zurück Portugiesisch für "Zuschlag" (dänisch: tillaeg, englisch: surtax, französisch: surtaxe, italienisch: sopratassa, niederländisch: toeslag, spanisch: sobretasa). zurück Schwedisch für Silbermünze. zurück Hierbei handelt es sich um silberne Gulden, die in Dänemark unter Christian II. (1513-1523) und Frederik I. (1523-1533) seit 1516 ausgegeben wurden. zurück Niederdeutsch für Sechsling. Hierbei handelte es sich um eine dänische Münze zu 6 Penning oder 1/2 Skilling, die durch den Hanserezeß von 1424 zum ersten Mal in Dänemark ausgeprägt wurde. Das Feingewicht des silbernen "Sösling" von 0,96 g entsprach dem hanseatischen Sechsling lübischer Währung. Die letzten dänischen Söslinge wurden 1651 geprägt. Danach ging der Ausdruck auf das 1/2-Skilling-Stück über, das auch 6 Penning galt. In Norwegen, das in Personalunion mit Dänemark verbunden war, sollen unter König Hans (1481-1513) zwei sehr seltene Typen des Sösling in Umlauf gewesen sein. zurück Dänische Schweibweise für Soesling. zurück Soest ist eine Stadt in Westfalen. In früherer Zeit gab es dort auch eine Münzstätte, in der von 1559- bis 1749 Münzen geprägt wurden. zurück Die "Soho Mint" war eine Privatmünzstätte in Handsworth nahe Birmingham, deren Inhaber Matthew Boulton in enger Zusammenarbeit mit seinem Freund James Watt die ersten mit Dampfkraft betriebenen Prägemaschinen entwickelte, die er 1786 in der "Soho Mint" errichtete. Die Münzstätte war Teil der Soho Werke, die im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jh. europaweit als Vorbild für großindustrielle Anlagen galten. Nach dem Vorbild der "Soho Mint" entwickelte Boulton Prägemaschinen für die Londoner Tower Mint und die Münzstätten in Kopenhagen und Madrid. Die "Soho Mint" arbeitete anfangs vor allem im Auftrag britischer Kolonialgesellschaften (u.a. East India Company) und stellte Münzen für verschiedene britische Kolonien her. Die bekannteste Münze der Soho Mint für England war wohl der schwere kupferne Cartwheel. An der Soho Mint waren so berühmte Stempelschneider und Medailleure wie Jean-Pierre Droz und Conrad Heinrich Küchler angestellt. zurück zurück Der "Sol" war eine französische Recheneinheit und Münze, in späterer Form "Sou" genannt. Ursprünglich stellte der Sol im Mittelalter in Frankreich nur eine Recheneinheit von 12 Deniers dar und entsprach dem deutschen Schilling. Die Recheneinheit geht auf das karolingische Rechensystem zurück, nach der das Karlspfund, aus dem 240 Denare (Deniers) gemünzt wurden, in 20 Schillinge oder Sols unterteilt war (12 Denare wurden also zu 1 Schilling bzw. Sol gerechnet). Ausgemünzt wurde dieser Wert erstmals im Jahr 1266 in Form des Gros tournois (zu 12 Deniers), der zum Vorbild der Groschen nördlich der Alpen wurde. Seit König Ludwig XII. (1498-1515) wurde der Sol in Form des Gros blanc zu 15 Deniers (entsprechend dem Wert des schwereren Gros parisis zu 15 Deniers) und des Douzain zu 12 Deniers ausgeprägt. Letztere wurden seit 1640 gegengestempelt, um ihren Wert auf 15 Deniers zu erhöhen (Sou marqué). Unter König Ludwig XIV. (1643-1715) verfiel der Sol zur Billonmünze mit geringem Silbergehalt. Im 18. Jh. wurde das Halbstück des Sol als Kupfermünze, das 1-Sol-Stück zunehmend in Kupfer und das 2-Sol-Stück in Billon ausgegeben. Höhere Werte ab 6 Sols (1/20 Ecu) wurden in Silber geprägt. In den ersten Revolutionsjahren erschienen auf Grund des Metallmangels verschiedene Sols aus Bronze und Glockenmetall, zuletzt 1793/94 (im Jahr II nach republikanischem Kalender). Nach Einführung der Franc-Währung im Dezimalsystem wurde der historisch gewachsene Begriff in Form des Ausdrucks "Sou" wieder zur Rechnungsmünze und auf das 5-Centime-Stück (1/20 Franc) übertragen. Wenn also in der französischen Literatur im 19. Jh. von einem Sou-Stück die Rede ist, handelt es sich um diese Münze. In Peru wählte man 1863 den Namen "Sol" in der Bedeutung "Sonne" (Symbol des Landes schon seit der Inkazeit) als Währungseinheit im Dezimalsystem. Es galt 1 Sol (= 10 Dineros) = 100 Centavos und 10 Soles = 1 Libra. Bis 1917 entsprach das 1-Sol-Stück in Gewicht (25 g) und Feingehalt (900/1000) dem 5-Franc-Stück der Lateinischen Münzunion. Die 1/2- und 1/5-Stücke waren entsprechend ihrem Teilwert leichter, bei gleicher Feinheit. Nach 1917 beendete Peru die Prägung der 1/5-Stücke und brachte bis 1835 den Sol und sein Halbstück mit reduziertem Feingehalt (500/1000) aus, anschließend aus Nickel-Messing und Messing. Auf Grund der hohen Inflation ging Peru 1985 zum Inti von 100 Céntimos (1000 Soles de oro = 1 Inti) und im Juli 1991 zum Nuevo Sol (1.000.000 Intis = 1 Nuevo Sol) über. Letzterer ist aus Neusilber geprägt. Nach Gründung der Republik Bolivien 1825 bekam der Real den Namen "Sueldo", von 1852 bis zur Einführung der Dezimalwährung 1863 den Namen "Sol". Es galten 8 Soles (Sueldos, Reales) = 1 Peso. zurück Der zur Revolutionszeit in Frankreich geprägte letzte Typ des Sol ist nach dem Bild auf der Rückseite, einer umkränzten Waage (französisch: "balance"), benannt. Im Kranz findet sich die Wertangabe (1 S), darüber die Freiheitsmütze, die die Umschrift "LIBERTE" und "EGALITE" trennt. Die Vorderseite zeigt die Verfassungstafel mit der Schrift "LES HOMMES SONT EGAUX DE LA LOI" (deutsch: "Die Menschen sind vor dem Gesetz gleich") zwischen Traube und Ähren, darüber ein Auge, das die Umschrift "REPUBLIQUE FRANÇOISE" trennt. Die nach dem Dekret vom 26.04.1793 geprägten Stücke sind entweder auf den Rückseiten mit der Jahreszahl 1793 nach dem Gregorianischen Kalender und/oder auf den Vorderseiten mit der Jahreszahl II (22.09.1793 bis zum 21.09.1794) versehen. Die nach dem Dekret vom 24.11.1793 von Januar bis März 1794 geprägten Stücke sind nach dem republikanischen Kalender datiert oder ohne Jahresangabe. Aus Materialmangel wurden sie aus Messing und Glockenmetall hergestellt. Stücke aus Glockenmetall sind heute nur in schlechter Erhaltung zu finden. Entsprechend dazu gab es auch Doppelstücke (Wertbezeichnung 2 S). Einige sind auf Monnerons zu 2 Sols überprägt (Monnaie de confiance) Für die Gravierung zeichnete Augustin Dupré verantwortlich. An der Prägung waren insgesamt fünfzehn Münzstätten beteiligt. zurück Der &&"Soldatenpfennig"&& ist keine Münze, sondern eine Marke aus Kupfer, die beurlaubte schwedische Soldaten unter den Königen Karl XI. (1672-1697) und Karl XII. (1697-1718) in den unter schwedischer Herrschaft stehenden Herzogtümern Bremen und Verden mit sich führen mußten, um nicht als Deserteure angesehen zu werden. zurück Mehrzahl von Soldo. zurück zurück Der "Soldo" ist die italienische Entsprechung zum französischen Sol und dem deutschen Schilling. Der "Soldo" wurde gegen Ende des 12. Jh. von Heinrich VI. (1190-1197) in Mailand eingeführt. Der König ließ ihn als Einfachstück im Gewicht von ca. 1,25 g und als Doppelstück (Doppio Soldo) im Gewicht von etwa 2,1 g schlagen. Andere italienische Städte nahmen die Prägung des Soldo auf, Bologna noch im 12. Jh., Genua im 13. Jh. und Venedig im 14. Jh. Der Soldo sank zur Billonmünze herab und wurde seit der 2. Hälfte des 18. Jh. als Kupfermünze geschlagen. Es gab auch Mehrfachstücke. In der Regel entsprach der Wert eines Soldo 12 Denari und 20 Soldi galten eine Lira. Es gab aber auch andere Bewertungen. Unter der Oberherrschaft Napoleons Bonapartes galt folgendes Wertverhältnis: 100 Centesimi = 20 Soldi = 1 Lira. Nach der Einigung Italiens wurden keine Soldi mehr geprägt. Der Name "Soldo" ging auf das 5-Centesimo-Stück über. zurück Der "Soldus" war ein Münze aus Venedig, die ab 1806 unter der napoleonischen Herrschaft geprägt wurde und auf dem französischen Dezimalsystem basierte. zurück Mehrzahl von Solidus. zurück Mit &&"Solidus"&& (lateinisch: "in der Bedeutung gediegen") bezeichnete man erstmalig in konstantinischer Zeit eine Goldmünze, die Konstantin der Große (306/309-337) sukzessive in seinem Herrschaftsgebiet prägen ließ. Bereits vor 310 v.Chr. wurden Solidi in der Münzstätte Treveri (Trier) und danach auch in anderen Münzstätten des konstantinischen Einflußgebiets geprägt. Nachdem der Kaiser durch den Sieg über Licinius 324 n.Chr. zum Alleinherrscher des Römischen Reiches wurde, machte er den Solidus zu 1/72 Libra zur Standardgoldmünze im gesamten Reich. Sie löste den langlebigen Aureus ab, der im 3. Jh. seinen guten Ruf eingebüßt hatte. Es folgte eine intensive Prägephase der 4,5 g schweren Solidi, von denen auch Halbstücke zu 1/144 (Semissis) Libra und Drittelstücke zu 1 1/2 Scripulum (Tremissis) ausgegeben wurden. Unter den meisten nachfolgenden Kaisern wurde bei der Prägung des Solidus auf die Einhaltung des Gewichts und die Reinheit des Gehalts geachtet, so daß seine Solidität sprichwörtlich wurde. Solidi und Tremisses wurden bis zum Untergang des Weströmischen Reiches ausgegeben und darüber hinaus von verschiedenen germanischen Stämmen zur Völkerwanderungszeit nachgeahmt. Das im Osten entstandene Oströmischen Reich übernahm den Solidus, der bei mehrfach wechselnden Typen bis ins 10. Jh. als byzantinische Hauptgoldmünze Bestand hatte. In mittelalterlichen Dokumenten wird der Schilling häufig lateinisch als "Solidus" bezeichnet und darauf gehen wohl auch die Münzbezeichnungen Sol (französisch), Soldo (italienisch) und Sueldo (spanisch) zurück. zurück Der "Solot" war die kleinste Münzeinheit im Königreich Siam (heute: Thailand), nach dem alten Gewichtssystem. bei dem 128 Solot = 64 Att = 8 Fuang = 1 Tikal (Baht) galten. Der Solot war somit die kleinste Unterteilung des Tikal, der bis ins 19. Jh. ausgegeben wurde. Das Silbergewicht lag bei etwa 0,12 g. Nach Umstellung auf die Münzprägung nach europäischem Vorbild wurde der Solot in Zinn (1862), Kupfer (1874), Kupfer-Nickel (1882) und Bronze (seit 1887) geprägt. Schon bald nach der Umstellung auf die Dezimalwährung (1897) entfiel der Solot, der zuletzt im Jahre 1905 geprägt wurde. zurück Solothurn ist eine Stadt und Kanton in der Schweiz, die 1471 in die Eidgenossenschaft eintrat. Wann das Münzrecht vergeben wurde, ist unklar. Im Jahre 1146 wurden die Solothurner Münzen erstmals urkundlich erwähnt. Die ersten noch erhaltenen Münzen stammen aus dem letzten Drittel des 13. Jh. und sind viereckige Pfennige. Bis ins 15. Jh. wurden zahlreiche Pfennige, Angster und Hälblinge geprägt, die fast immer das Haupt des Hl. Urusus zeigen. 1377 und 1387 trat man mehreren Münzkonventionen bei. Die letzten Hohlpfennige und Heller aus dem 15. und 16. Jh. zeigen da Standeswappen zwischen "S-O" und dienten nur noch als Scheidemünzen. In der zweiten Hälfte des 15. Jh. wurden Plapparten, Fünfer und Etschkreuzer geprägt. Um 1500 gab es auch erste Batzen und in der zweiten Hälfte des 16. Jh. wurden zahlreiche Taler und Dicken sowie Halbtaler, Halbdicken, Halbbatzen, Kreuzer und Vierer. 1562 und 1567 wurden die einzigen Groschen zu 3 Kreuzern geprägt. 1560 wurde eine Münzkonvention mit Fribourg, Bern, Neuenburg, dem Bistum Sitten und Genf geschlossen. Alle schlugen die gleichen Münzen, wobei der Kreuzer die wichtigste war. Im 17. Jh. begannen die Prägungen erst 1622 und dauerten bis 1642. 1630 gab es die ersten Dukaten und von 1642 bis 1759 kam es zum Stillstand der Prägung, die erst 1759 wieder aufgenommen wurde. Bis 1798 wurden Scheidemünzen und kleinere Silbermünzen geprägt. 1795 und 1798 gab es 20-Batzen-Stücke oder halbe Neutaler. Von 1787 bis 1798 gab es auch zahlreiche Goldmünzen nach dem Fuß des französischen Louis d'or. Nach dem französischen Einmarsch 1798 ging das Münzrecht an die Helvetische Republik über. Die Münzstätte blieb aber weiterhin in Betrieb und prägte für die neue Zentralregierung. Die 40-, 20-, 10-, 5- und 1-Batzen-Stücke wurden mit dem Münzzeichen "S" versehen. Nach dem Ende der Helvetischen Republik erhielt Solothurn das Münzrecht zurück und prägte 1805 erste Batzen, 1809 und 1811 5 Batzen sowie 1812 Franken. 1825 trat man dem Konkordat der westlichen Kantone bei, wodurch die Prägung weiterer Scheidemünzen verboten wurde. 1830 wurden die letzten Münzen in Solothurn geprägt. zurück Der "Sol tournois" war ein französischer Sol, der im 14. Jh. geprägt wurde. zurück Der "Som" (ISO-4217-Code: KGS; Abkürzung: K.S.) ist die Währung von Kirgisistan. Die Währung wurde 1993 eingeführt und löste den Rubel aus der Sowjetzeit ab. Kirgisistan war damit das erste Land Zentralasiens, das sich aus der Rubelzone löste. Die Nationalbank der kirgisischen Republik brachte die ersten Banknoten am 10.05.1993 aus. 1 Som ist in 100 Tyjyn unterteilt. Anfänglich war der "Tyjyn" in kleinformatigen Banknoten zu 1, 10 und 50 Tyjyn in Umlauf. Auf Grund des Kursverfalls des Som in den ersten Jahren nach dessen Einführung ist diese kleinere Einheit jedoch heute nur noch selten in Gebrauch, so daß die Unterteilung in der Praxis keine Rolle spielt. Kleinste Einheit ist in der Praxis die Banknote zu 1 Som. zurück Der "So'm" (von lateinisch Solidus abgeleitet; ISO-4217-Code: UZS; Abkürzung: U.S.) wurde im November 1993 in Usbekistan als Parallelwährung (Kupon) ohne Unterteilung eingeführt. Seit dem 01.01.1994 galt 1 So'm (Kupon) = 1 Russischer Rubel. Die Währungsreform vom 01.07.1994 brachte einen neuen So'm = 1.000 So'm (Kupons), der in 100 Tiyin unterteilt war. Wie andere Republiken der früheren Sowjetunion benutzte auch Usbekistan nach der Unabhängigkeit zunächst weiterhin den Rubel. Am 26.07.1993 wurde in Rußland der alte sowjetrussische Rubel durch den neuen russischen Rubel abgelöst. Bis zur Einführung des So'm am 15.11.1993 wurden in Usbekistan beide Rubelwährungen nebeneinander benutzt. Usbekistan ersetzte den Rubel durch Som zum Nennwert. Es wurden Geldscheine zum Nennbetrag von 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1.000, 5.000 und 10.000 Som ausgegeben. zurück Mehrzahl von Somalo. zurück  &&Somalia&& (Somali: Soomaaliya) ist ein Staat im äußersten Osten Afrikas, am Horn von Afrika. Er grenzt an den Indischen Ozean im Osten, den Golf von Aden im Norden, Djibouti und Äthiopien im Westen und Kenia im Süden. Der Landesname ist vom Volk der Somali abgeleitet, das die große Bevölkerungsmehrheit stellt und auch in den Nachbarländern ansässig ist. &&Somalia&& (Somali: Soomaaliya) ist ein Staat im äußersten Osten Afrikas, am Horn von Afrika. Er grenzt an den Indischen Ozean im Osten, den Golf von Aden im Norden, Djibouti und Äthiopien im Westen und Kenia im Süden. Der Landesname ist vom Volk der Somali abgeleitet, das die große Bevölkerungsmehrheit stellt und auch in den Nachbarländern ansässig ist.Somalia war nach dem 2. Weltkrieg italienisches Treuhandgebiet und wurde 1960 unabhängig. Es entstand aus dem Zusammenschluß der vormaligen Kolonien Britisch-Somaliland und Italienisch-Somaliland. Seit dem Fall der autoritären Regierung unter Siad Barre 1991 befindet sich das Land im Bürgerkrieg und hatte zumindest bis zur Bildung einer international anerkannten Übergangsregierung im Jahr 2000 keine funktionierende Regierung. Die Übergangsregierung kontrolliert jedoch nur einen Teil des Landes. Der Norden Somalias ist als "Somaliland" seit 1991 de facto unabhängig. Amtssprache: Somali, Arabisch Hauptstadt: Mogadischu Regierungssitz: Baidoa Staatsform: Republik (de jure) Fläche: 637.657 qkm Einwohnerzahl: 9 bis 12 Millionen (2006) Bevölkerungsdichte: 13,90 Einwohner pro qkm Unabhängigkeit: 26.06.1960 erklärt, 01.07.1960 anerkannt Zeitzone: MSK (UTC +3) Währung: Somalia-Schilling (SOS) zurück Der "Somalia-Schilling" (somalisch: Shilin soomaali; ISO-4217-Code: SOS; Abkürzung: SoSh) ist die Währung von Somalia. Es gilt 1 Somalia-Schilling = 100 Centesimi oder Senti. Seit der Unabhängigkeit Somalias 1960 wurde der "Somalia-Schilling" von der Somalischen Zentralbank herausgegeben. Nach Beginn des somalischen Bürgerkriegs und dem Zusammenbruch des somalischen Staatswesens im Jahr 1991 ließen verschiedene Kriegsfürsten in eigener Regie große Mengen an 500- und 1000-Schilling-Scheinen drucken, was den Wert der Währung einbrechen ließ. Im Juni 1990 bekam man auf dem freien Markt rund 2.000 Schilling für einen US-Dollar, im August 1991 bereits 7.000 Schilling und 2002 bisweilen bis zu 25.000 Schilling. Der Wechselkurs erholte sich bis März 2006 auf 13.400, sank bis Mai 2008 aber wieder auf 30.000 Schilling pro Dollar. zurück Die Somalische Zentralbank (Somali: Bankiga Dhexe ee Soomaaliya) war ab 1960 die Zentralbank des Staates Somalia. 1968 fusionierte die Regierung die Somalische Kreditbank Credito Somalo, die die Treuhandverwaltung Italienisch-Somalilands 1954 gegründet hatte, mit der Banca Nazionale Somala. Es ist unklar, inwiefern die Somalische Zentralbank seit dem Zusammenbruch der Regierung und dem Beginn des somalischen Bürgerkrieges 1991 tätig war. Es gibt keine Internetpräsenz und Nachrichten über die Bank sind selten. Banknoten des Somalia-Schillings wurden in Somalia im Bürgerkrieg in großem Umfang illegal gedruckt. zurück Der "Somalo" ist die Währungseinheit von Somalia als italienisches Treuhandgebiet (1950-1960) und wurde als Billonmünze geprägt. Es galten 100 Centesimi = 1 Somali. Nach der Unabhängigkeit Somalias folgte dem Somalo 1962 der Scellino (Somalia-Schilling). zurück Sombrerete war eine Münzstätte im mexikanischen Staat Zapatecas, die 1810 bis 1812 während des Aufstandes Notgeld schlug. Der Gouverneur General Vargas blieb dem König Fernando VII. treu, aber es entfiel die Büste des Königs auf der Vorderseite. Die Münzen tragen nur das Wort "VARGAS" und die Jahreszahl sowie auf der Rückseite vier Punzen. zurück Das sog. "Hog Money", wobei es sich um die ersten Kolonialmünzen von England für die Ansiedlungen auf den Bermudas handelte, trug die Umschrift "Somer Islands". zurück Dies ist die norwegische Bezeichnung für "Sommerschutz". Dies ist die Inschrift auf einer Münze aus Norwegen zu 12 Skilling. Auf der Vorderseite zeigt sie einen Reiter nach links und die Umschrift "*XVI*SOMMER* SCHYDTZ* P(OST)*" und auf der Rückseite den norwegischen Löwen. Es gibt die Münzen auch ohne den Hinweis "Sommerschydtz". In Norwegen kostete das Reisen pro Meile (10 km) im Winter 16 Skilling und im Sommer 12 Skilling. Für den Sommer gab es den Winterschydtz. zurück Der "Somoni" (tadschikisch: Somonij; ISO-4217-Code: TJS) ist die Währung von Tadschikistan. Es gilt 1 Somoni = 100 Diram. Der Somoni ersetzte am 30.01.2000 den Tadschikischen Rubel. Die Wechselrate war 1 Somoni für 1.000 Rubel. Anfangs wurden nur Banknoten ausgegeben, seit 2001 auch Münzen. Es gibt Banknoten zu 1, 5, 20 und 50 Diram und 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Somoni. Münzen gibt es zu 5, 10, 20, 25 und 50 Diram und 1, 3 und 5 Somoni. zurück Tadschikische Bezeichnung für den Somoni. zurück Bezeichnung für eine Münzenausgabe, die zu einem gegebenen Anlaß erscheint (englisch: commemorative issue, französisch: émission commémorative). zurück Alternative Bezeichnung für Sonderprägung. zurück Hierbei handelt es sich nicht um eine Kursmünze, sondern eine Ereignis- bzw. Gedenkprägung, die aber auch kursfähig ist. zurück Synonym für "Spezialsammlung". zurück Dies ist die deutsche Bezeichnung der französischen Goldmunze "Ecu d'or au soleil" (kurz: Ecu d'or), die schon vor der Mitte des 16. Jh. als Hauptumlaufmünze in den Niederlanden umlief und dort auch nachgeahmt wurde (Zonnekroon). Unter der Bezeichnung "Sonnenkrone" fanden die Goldstücke auch Eingang in den Geldverkehr des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, vor allem in den Staaten West- und Süddeutschlands. zurück Dies ist die volkstümliche deutsche Bezeichnung des letzten unter Ludwig XIV. (1643-1715) geprägten Typ der französischen Goldmünze Louis d'or. Der Typ ist nach einer kleinen Sonne - dem persönlichen Kennzeichen des Königs - im Zentrum der Rückseite benannt. In Frankreich wird die Münze auch "Louis d'or au soleil" genannt. Der zwischen 1709 und 1716 in großen Mengen geprägte Louis d'or au soleil war auch in West- und Südwestdeutschland im Umlauf. zurück Somalisch für Somalia. zurück   Der "Sophiendukat" ist ein unter Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen zu Weihnachten 1616 erstmals geprägter Dukat, der später als Patengeschenk zur Taufe beliebt war und bis ins 19. Jh. in der Münzstätte zu Dresden nachgeprägt wurde, immer mit der ursprünglichen Jahresangabe. Die Vorderseite zeigt das Monogramm der Kurfürstin Sophia (der Mutter Johann Georgs), die ineinander gestellten Initialen "CS" vor den gekreuzten Kurschwertern. Die Umschrift lautet "WOL DEM DER FREVD AN SEINEM KIND ERLEBT", weshalb man auch vom "Kinderdukaten" spricht. Die Rückseite zeigt untereinander die Symbole der heiligen Dreifaltigkeit, nämlich das Auge Gottes, die Initialen "IHS" und eine Taube, in der Umschrift "HILF DV HEILIGE DREYFALTIGKEIT" und die Jahreszahl, weshalb man auch vom Dreifaltigkeitsdukat spricht. Der "Sophiendukat" ist ein unter Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen zu Weihnachten 1616 erstmals geprägter Dukat, der später als Patengeschenk zur Taufe beliebt war und bis ins 19. Jh. in der Münzstätte zu Dresden nachgeprägt wurde, immer mit der ursprünglichen Jahresangabe. Die Vorderseite zeigt das Monogramm der Kurfürstin Sophia (der Mutter Johann Georgs), die ineinander gestellten Initialen "CS" vor den gekreuzten Kurschwertern. Die Umschrift lautet "WOL DEM DER FREVD AN SEINEM KIND ERLEBT", weshalb man auch vom "Kinderdukaten" spricht. Die Rückseite zeigt untereinander die Symbole der heiligen Dreifaltigkeit, nämlich das Auge Gottes, die Initialen "IHS" und eine Taube, in der Umschrift "HILF DV HEILIGE DREYFALTIGKEIT" und die Jahreszahl, weshalb man auch vom Dreifaltigkeitsdukat spricht.zurück Italienisch für "Zuschlag" (dänisch: tillaeg, englisch: surtax, französisch: surtaxe, niederländisch: toeslag, portugiesisch: sobretaxa, spanisch: sobretasa). zurück George Soros (gebürtig: Dzjchdzhe Shorash, geb. 12.08.1930 in Budapest) ist ein US-amerikanischer Investmentbanker ungarischer Herkunft. Er wurde als Sohn von Tivadar Soros in Budapest geboren. Trotz der jüdischen Herkunft seiner Familie überlebte Soros die deutsche Besetzung Ungarns und die Schlacht um Budapest. 1946 flüchtete er vor der sowjetischen Okkupation aus Ungarn in den Westen und emigrierte 1947 nach England. An der London School of Economics and Political Science (LSE) absolvierte er 1952 sein Studium der Wirtschaftswissenschaften. Dort studierte er bei Karl Popper, dessen Vorstellungen über eine offene Gesellschaft ihn stark beeinflußten. 1956 zog er in die USA und übernahm 1968 einen Investmentfonds (Hedgefonds) in Curaçao. Auch seine späteren Quantum Funds, die er gemeinsam mit Jim Rogers gründete, haben ihren Sitz in Offshore-Finanzzentren, wie den Niederländischen Antillen und den Jungferninseln. Er entzog damit seine Geschäfte der Kontrolle durch die US-Finanzaufsicht. 1988 erzielte Soros mit dem Kauf und Verkauf von Aktienpaketen der französischen Großbank Société Générale rund 2,2 Mio. US-Dollar Spekulationsgewinn. Die Transaktion erregt zunächst kein Aufsehen. 2006 wurde er von einem französischen Gericht in letzter Instanz für schuldig befunden, von vertraulichen Informationen profitiert zu haben, und wegen Insiderhandels zu einer Geldstrafe in Höhe seines mutmaßlichen Gewinns verurteilt. Im Dezember 2006 reichte Soros gegen diese Entscheidung eine Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein. zurück Sorrent ist eine Stadt in Italien auf der Halbinsel von Sorrent am Golf von Neapel. Die Ursprünge liegen im 7. Jh. v.Chr., als es von den Phönizier gegründet wurde. Von 474 bis 420 v.Chr. war Sorrent unter der Regentschaft von Griechen, bis es 150 Jahre später römisches Municipium wurde. In dieser Zeit des Römischen Reiches wurde es der Sommersitz von Aristokraten und Reichen. Im Laufe der Jahrhunderte haben viele Völker den Versuch unternommen, die von den Griechen errichtete Stadtmauer zu durchbrechen und das Städtchen zu erobern. So wurde Sorrent 1133 von den Normannen eingenommen. In der Stadt gab es früher auch eine Münzstätte. zurück Dänisch für "schwarz" (englisch: black, französisch: noir, italienisch: nero, niederländisch: zwart, portugiesisch: preto, spanisch: negro). zurück In Kaufmannsbüchern wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jh. oft gefordert, die Bezahlung in "Sorten" zu leisten, d.h. mit groben Sorten (Währungsmünzen) und nicht mit unterwertigem Kleingeld zu bezahlen. Die Bezeichnung "Sortengulden" wurde also für die ausgeprägten Silbergulden (Zweidritteltaler nach Zinnaischen Münzfuß) angewendet und findet sich gelegentlich auch in Münzkatalogen des frühen 20. Jh. wieder. zurück Soruth war ein indischer Feudalstaat. zurück ISO-4217-Code für den Somalia-Schilling. zurück Abkürzung für den Somalia-Schilling. zurück Name eines britischen Auktionshauses in London. zurück Italienisch für "dünn" (englisch: fine bzw. thin, französisch: fin, portugiesisch: fino, spanisch: delgado). zurück Alternative, in späteren Zeiten übliche Bezeichnung für Sol. zurück Der Douzain wurde seit 1640 mit einer kleinen Lilie im Perlkreis gegengestempelt, um seinen Wert von 12 auf 15 Deniers zu erhöhen ("Sou marqué"). Auch die unter Ludwig XV. nach 1738 für einige Jahre geprägten Kolonialmünzen zu 2 Sou werden als "Sou marqué" bezeichnet. Sie wurden in den Kolonien mit verschiedenen Gegenstempeln versehen, um ihre Werte anzupassen. zurück Die "South Africa Reserve Bank" ist die Zentralbank von Südafrika. zurück Eigenname von Südaustralien. Südaustralien war eine britische Kolonie und ist heute ein Teilstaat von Australien. zurück Englische Bezeichnung für die Südafrikanische Zollunion. zurück Eigenname für Süd-Nigeria. zurück Eigenname für Süd-Rhodesien. zurück Eigenname des britischen Überseegebietes Süd-Georgien und Süd-Sandwich-Inseln. zurück Englisch für Südwestafrika. zurück Ein "Souverän" (lateinisch: Superanus, französisch: Souverain) ist der über allen stehende Fürst, der als Inhaber der uneingeschränkten Staatsgewalt in einer absolutistischen Monarchie herrscht. In parlamentarischen Staaten wird die Souveränität vom Volk ausgeübt. zurück Französisch für den über allem stehenden absolutistischen Fürsten bzw. "Souverän", der die unbeschränkte Staatsgewalt inne hatte (lateinisch: Superanus). zurück Nach dem Vorbild des englischen Sovereign führten die Statthalter Albert und Isabella im Jahr 1612 in den Spanischen Niederlanden den "Souverain d'or" im Wert von 6 Gulden ein. Der ursprüngliche Typ zeigt auf der Vorderseite das thronende Statthalterpaar, später die Brustbilder, und auf der Rückseite den Landesschild. Sein Raugewicht beträgt 11,14 g, das Feingewicht 10,2 g. Es wurden vor allem Doppelstück geprägt. Die Regenten aus der österreichischen Linie der Habsburger übernahmen die Prägung. Seit Joseph II. wurden sie in Österreich, vor allem in Wien geprägt. Das in den habsburgischen Besitzungen Lombardei und Venetien (Mailand, Venedig) geprägte Gegenstück wird Sovrano genannt und wurde bis 1856 geprägt. zurück Beim &&"Sovereign"&& handelt es sich um eine englische Goldmünze, die im Jahr 1489 von König Heinrich VII. (1458-1509) im Wert eines Pfundes an Silbermünzen (dies entsprach 20 Rechnungsschillingen) eingeführt wurde. Die auf einem breiten Schrötling von ca. 43 mm Durchmesser geprägte Münze aus fast reinem Gold wog 15,55 g (Feingewicht ca. 15,47 g) und zeigt auf der Vorderseite den Souverän mit Reichsapfel und Zepter auf einem in spätgotischem Stil verzierten Thron. Die Rückseite zeigt das viergeteilte Wappen inmitten der großen Tudor-Rose, dem Symbol der von Heinrich VII. gegründeten Tudor-Dynastie. Man unterscheidet vier Haupttypen, teilweise mit Varianten, u.a. mit Portcullis (Fallgitter) zu Füßen des Königs. Außerdem gibt es sehr seltene Piéforts, von den Sovereign-Stempeln abgeschlagene doppelte und dreifache Sovereigns, die vermutlich als Präsentations- oder Schaustücke dienten. Die Goldmünze wurde von den folgenden Königen des Hauses Tudor bei sinkendem Gewicht und Feingehalt und mit abweichenden Münzbildern weitergeprägt. Auf den in der 3. Prägeperiode (1544-1547) Heinrichs VIII. geprägten Sovereigns ist der König größer dargestellt, der bekrönte Wappenschild wird von zwei Schildhaltern gehalten, außerdem fiel der Feingehalt in dieser Prägeperiode allmählich von über 23 auf 20 Karat. Unter König Eduard VI. (1547-1553) wurde der Feingehalt auf 22 Karat erhöht, die von 1549 bis April 1550 geprägten Halbstücke zeigen auf den Vorderseiten die Büste des jungen Königs (gekrönt und ungekrönt). Nach dem April 1550 ließ der König einige wenige Sovereigns und Doppelstücke (beide sehr selten) wieder als "Feingoldmünzen" mit dem traditionellen Motiv (König auf dem Thron) prägen. Auch die Königinnen Mary (1553-1558) und anfänglich auch Elisabeth I. (1558-1603) ließen Sovereigns aus nahezu purem Gold ausprägen, bevor zwischen 1578 und 1582 zuerst der Feingehalt auf 916/1000 und nach 1601 auch das Bruttogewicht auf 11,146 g reduziert wurde. Die vorerst letzten Sovereigns (gekröntes Hüftbild in Rüstung mit Reichsapfel und Zepter/Wappen zwischen "I" und "R") und deren Halbstücke (Büste) erschienen zu Beginn der Regierungszeit Jakobs I. (1603-1624), bevor die erste Münzordnung von 1604 den Sovereign durch den Unite ersetzte. Als Nachfolger der Guinea wurde der moderne Sovereign im Wert von 20 Shillings erst wieder nach 1816 geprägt, allerdings im Gewicht von 7,98 g (916/1000 fein). Er wurde seit 1817/18 mit den von Matthew Boulton konstruierten dampfbetriebenen Prägemaschinen in der damals neuen Münzstätte auf dem Tower Hill geprägt. Die modernen Sovereign-Stücke wurden im 19. Jh. zur Hauptgoldmünze Großbritanniens. Sie zeigen auf den Vorderseiten die Porträts der englischen Regenten. Die Rückseiten der ersten Ganzstücke zeigen das von Benedetto Pistrucci geschaffene Motiv "St. George Slaying the Dragon" ("St. Georg tötet den Drachen"), das bald dem ursprünglich auf den Halbstücken dargestellten Landeswappen wich, aber seit 1871 wieder zur Ausführung kam. Der Sovereign wurde schon bald dem Goldwert angepaßt und galt mehr als 20 Shillings. Nach den Goldfunden auf dem australischen Kontinent wurden nach 1855 Sovereigns auch in Australien, nach 1908 auch in Kanada (Ottawa), Indien und Südafrika geprägt. Noch heute werden Sovereigns geprägt, allerdings nicht mehr als Hauptgoldmünze, sondern als Handelsmünze, da ihr Goldgehalt weit über dem britischen Pfund liegt. Für den Sammler sind die alten Sovereigns praktisch unerschwinglich und auch einige seltene Jahrgänge und Proben moderner Sovereigns erzielen sehr hohe Preise. zurück Englische Bezeichnung für die Sowjetunion. zurück   Dies ist die Bezeichnung der in der Lombardei und Venedig unter der Herrschaft der österreichischen Habsburger im 18./19. Jh. (bis 1856) geprägten Goldmünze, die das italienische Gegenstück des Souverain d'or darstellt. Dies ist die Bezeichnung der in der Lombardei und Venedig unter der Herrschaft der österreichischen Habsburger im 18./19. Jh. (bis 1856) geprägten Goldmünze, die das italienische Gegenstück des Souverain d'or darstellt.zurück Kurzbezeichnung für Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR). zurück Offizielle deutsche Bezeichnung für Jugoslawien in der Zeit von 1963 bis 1992. zurück Offizielle (deutsche) Bezeichnung für Libyen. zurück Offizielle (deutsche) Bezeichnung für das seit 1976 wiedervereinigte Vietnam. zurück Länderkennzeichen für Somalia. zurück Englisch für "Zwischenraum" (französisch: intervalle). zurück &&"Spade Guinea"&& (deutsch: Spaten-Guinea) ist die Bezeichnung der zwischen 1787 und 1799 geprägten Guinea, die auf der Rückseite einen gekrönten viergeteilten Wappenschild zeigt, der in Spatenform (englisch: "spade") spitz zuläuft. zurück Mit der Einführung der Tetrarchie und zahlreichen inneren Reformen gelang es Kaiser Diokletian gegen Ende des 3. Jh. noch einmal, das Römische Reich zu stabilisieren. Diese Zeit der beginnenden Spätantike ist gekennzeichnet von Umbrüchen. So initiierte Kaiser Konstantin der Große die Anerkennung und Privilegierung des Christentums. Die Hinwendung zu dem neuen Glauben ging schließlich mit der Ablehnung des religiösen Pluralismus der Antike einher. Ein letzter Versuch, die alten Kulte durch die Verbindung mit neuplatonischem Gedankengut wieder zu beleben, scheiterte mit dem Tod Kaiser Julians im Jahr 363. Alle nachfolgenden Kaiser waren Christen. Kaiser Valentinian I. festigte den Westen des Reiches, doch kam es im Zuge der Völkerwanderung 378 zur Schlacht von Adrianopel und zu einer neuen Krisenzeit. Kaiser Theodosius I. wiederum konnte den Osten des Reiches stabilisieren und war zugleich der letzte Kaiser, der de facto über das gesamte "Imperium Romanum" herrschte. Er erklärte das Christentum schließlich 392 zur Staatsreligion. Kaiser Justinian gilt als einer der höchst bedeutenden Herrscher der Spätantike. Nach der faktischen Teilung des Reiches unter den beiden Söhnen des Theodosius 395 n.Chr. in das Weströmische und das Oströmische Reich erwies sich letztlich nur das Oströmische Reich auf die Dauer eines weiteren Jahrtausends als überlebensfähig. Es bewahrte viele antike Traditionen und war ein überwiegend griechischsprachiges Reich noch bis ins 7. Jh. Das Weströmische Reich war dem Ansturm der Hunnen und Germanen militärisch auf Dauer nicht gewachsen. Rom selbst wurde 410 von den Westgoten und 455 von den Vandalen geplündert. 476 n.Chr. setzte der Kommandeur der letzten kaiserlichen Armee, der Germane Odoaker, den letzten Westkaiser Romulus Augustulus ab und unterstellte sich der nominellen Oberherrschaft des oströmischen Kaisers. zurück zurück Als "Spätgotik" wird die Endphase der Gotik in der ersten Hälfte des 16.Jh. bezeichnet. zurück Als "Spätmittelalter" wird der Zeitraum der europäischen Geschichte von der Mitte des 13. bis zum Ende des 15. oder Anfang des 16. Jh. bezeichnet (also ca. 1250 bis 1500), der das europäische Mittelalter abschließt und in die Renaissance mündet, die Übergangsepoche zur frühen Neuzeit. zurück Die "Spätrenaissance" bezeichnet man auch als Manierismus. zurück  Das Königreich &&Spanien&& (amtlich spanisch/galizisch: Reino de España, katalanisch: Regne d'Espanya, baskisch: Espainiako Erresuma) ist ein Staat, der im Südwesten Europas liegt und den größten Teil der Iberischen Halbinsel einnimmt. Im Nordosten, entlang des Gebirgszuges der Pyrenäen, grenzt Spanien an Frankreich und den Kleinstaat Andorra sowie im Westen an Portugal. Außerdem gehören die Inselgruppen der Balearen, im Mittelmeer gelegen, und der Kanaren im Atlantik, sowie die an der nordafrikanischen Küste gelegenen Städte Ceuta und Melilla zum Staatsgebiet. In Frankreich besitzt Spanien die Exklave Llívia. Außerdem gehören Spanien die vor der marokkanischen Küste gelegenen Inseln Islas Chafarinas, Peñón de Vélez de la Gomera, Alhucemas, Alborán, Perejil sowie die Islas Columbretes. Das Königreich &&Spanien&& (amtlich spanisch/galizisch: Reino de España, katalanisch: Regne d'Espanya, baskisch: Espainiako Erresuma) ist ein Staat, der im Südwesten Europas liegt und den größten Teil der Iberischen Halbinsel einnimmt. Im Nordosten, entlang des Gebirgszuges der Pyrenäen, grenzt Spanien an Frankreich und den Kleinstaat Andorra sowie im Westen an Portugal. Außerdem gehören die Inselgruppen der Balearen, im Mittelmeer gelegen, und der Kanaren im Atlantik, sowie die an der nordafrikanischen Küste gelegenen Städte Ceuta und Melilla zum Staatsgebiet. In Frankreich besitzt Spanien die Exklave Llívia. Außerdem gehören Spanien die vor der marokkanischen Küste gelegenen Inseln Islas Chafarinas, Peñón de Vélez de la Gomera, Alhucemas, Alborán, Perejil sowie die Islas Columbretes.Amtssprache: Spanisch (Kastilisch), (regional Katalanisch, Galicisch, Baskisch und Aranesisch) Hauptstadt: Madrid Staatsform: Parlamentarische Erbmonarchie Fläche: 504.646 qkm Einwohnerzahl: 45.116.894 (Stand: 2007) Bevölkerungsdichte: 88 Einwohner pro qkm BIP: 1.120 Mrd. US-Dollar (Schätzung 2005) Zeitzone: UTC+1 MEZ, UTC+2 MESZ (März bis Oktober), UTC (Kanarische Inseln) Währung: Euro zurück Auch die Münzgeschichte von Spanien beginnt - wie im gesamten Mittelmeerraum - mit den Griechen und Römern und auch die Karthager haben dort Münzen geprägt. Es folgten die sog. ibero-keltischen und visigotischen Prägungen. Im 8. Jh. n.Chr. wurde Spanien von den Arabern erobert. Münzstätten gab es u. a. in Cordoba, Granada, Jerez, Sevilla. Der maurische Einfluß blieb auch noch erhalten, als die spanischen Könige von Kastilien und Leon mit eigenen Prägungen begannen und sogar noch lange nach der Niederlage der islamischen Eroberer. Nach der Vereinigung des Landes unter Ferdinand und Isabella Ende des 151. Jh. gab es bis Ende des 17. Jh. weiterhin unabhängige Prägungen für Katalonien, Valencia und das Königreich Mallorca. Mit Ausnahme der Münzen von 1497 hat Spanien bis ins 18. Jh. keine Porträtmünzen geprägt. Auf den Vorderseiten fand sich einheitlich immer der Wappenschild und auf den Rückseiten findet man ein Kreuz im Vierpaß bei den Münzen aus Gold. Bei den Münzen aus Silber gab es ab Mitte des 16. Jh. den sog. Säulenpiaster, der meist in den amerikanischen Münzstätten geprägt wurde. Nach dem Verlust der amerikanischen Kolonien im 19. Jh. schied Spanien aus dem Konzert der Großmächte aus und das Münzsystem von Königin Isabella II. (1833-1866) wurde allmählich auf das Dezimalsystem umgestellt. So galten 1854 100 Céntimos = 1 Real, 1856 100 Céntimos = 1 Escudo und ab 1870 100 Céntimos = 1 Peseta. Seit dieser Zeit gab es noch umfangreiche Prägungen in Gold und Silber. Seit Einführung der Republik sind die Prägungen aber meist aus unedlen Metallen. In den letzten Jahrzehnten des 20. Jh. war die Peseta immer mehr der Inflation ausgesetzt. Seit 2002 gilt in Spanien der Euro. zurück Im Jahre 1593 wurde die Neue Welt durch Papst Alexander VI. geteilt, so daß der Vertrag von Tordesillas geschlossen wurde. Der östliche Teil (heute: Brasilien) ging an Portugal. Das Gebiet des Karibischen Meeres, ganz Mittelamerika und der größte Teil Südamerikas wurde danach zwei Jahrhunderte lang durch Spanien kolonialisiert. Nach Mexiko (1521) wurde 1531 auch Peru erobert. In beiden Gebieten wurden Vizekönige eingesetzt. 1718 folgten Neu-Grenada und 1776 das Gebiet mit der Hauptstadt Buenos Aires. Die wichtigsten Münzstätten befanden sich in Mexiko City, Potosi, Lima (1568) und 1626 Santa Fé de Bogota. Erst im 18. Jh. kamen noch Santiago de Chile und Popayan hinzu. Kurze Zeit wurde auch in Cuzco geprägt und Santo Domingo war die einzigste Münzstätte im Karibischen Meer. Viele Prägungen waren bis Mitte des 18. Jh. roh geschnitten und geschlagen und spiegleten so die widrigen und primitiven Bedingungen vor Ort wieder. Dennoch hielten sie sich laut Gesetz streng an spanische Vorbilder und bildeten so ein einheitliches Münzsystem für das gesamte Gebiet. Man kann die Münzen meist nur anhand der unterschiedlichen Münzzeichen unterscheiden. Meistens sind die Münzen auch aus Gold und weniger aus Silber, was auch mit dem unterschiedlichen Vorkommen dieser beiden Edelmetalle zu tun hat. Die Münzen dienten bis ins 19. Jh. hinein auch in fremden Kolonien häufig als Handelsmünzen. Ab 1810 begann der Zerfall des spanischen Kolonialreiches in Amerika und führte zur Gründung von neuen Staaten wie Mexiko und Chile. Einzelne Münzstätten der Spanier blieben allerdings erhalten und prägten fortan für die neuen Staaten. zurück Die Spanischen Besitzungen sind eine Bezeichnung für die spanische Kolonie an der Niederguineaküste und den Guineainseln, die 1909 durch den Zusammenschluß von Fernando Poo und Spanisch-Guinea entstand. 1959 wurde die Kolonie in Fernando Poo und Rio Muni geteilt. zurück Die "Spanische Blume" bezeichnet eine bestimmte Münzform, die man von einigen 50-Pesetas-Münzen aus Spanien kennt. Sie ist rund mit sieben Einkerbungen. Das 20-Euro-Cent-Stück wurde ebenfalls in dieser Form geprägt. Grund ist die bessere Unterscheidbarkeit zu den anderen Kleinmünzen und ein Zugeständnis vor allem an blinde und sehbehinderte Mitbürger in der Europäischen Union. zurück Sammelbezeichnung für die überseeischen Besitzungen Spaniens. Zum Kolonialbesitz gehörten Spanisch-Amerika, Elobey, Annobón und Corisco, Fernando Poo, Ifni, Kap Jubi, Kuba, Marianen, Philippinen, Puerto Rico, Rio de Oro, Rio Nuni, Spanisch-Marokko, Spanisch-Sahara, Spanisch-Westafrika. zurück Elobey, Annobón und Corisco sind Inseln im Golf von Guinea in Westafrika und waren eine spanische Kolonie, die 1903 aus Fernando Poo ausgegliedert wurden und seit 1909 Teil des Postgebietes Spanische Besitzungen im Golf von Guinea waren. zurück Fernando Poo war eine spanische Kolonie, die am 01.01.1869 zum Postgebiet Spanisch-Westindien und ab 1873 zum Postgebiet (Spanisch-)Kuba gehörte. Ab dem 01.07.1879 hatte sie wieder eine eigene Posthoheit und war ab 1909 Teil des Postgebietes Spanische Besitzungen im Golf von Guinea. Ab 1959 war sie wieder eigenständiges Postgebiet und seit 1960 spanische Überseeprovinz. Am 12.10.1968 wurde sie zusammen mit Rio Muni als Äquatorialguinea unabhängig. Von 1973 bis 1979 hieß die Insel Macias Nguema Byogo und trägt heute den Namen Bioko. Bioko hat eine Ausdehnung von 2.017 qkm und mehr als 100.000 Einwohner. Bioko liegt bei 4° nördlicher Breite und 8° östlicher Länge etwa 40 km vor der Küste von Kamerun. Vom äquatorialguineischen Festlandgebiet Mbini (früher Rio Muni) ist sie etwa 200 km entfernt. Sie ist in die beiden Provinzen Bioko Norte und Bioko Sur gegliedert. zurück Ifni an der Küste vor den Kanarischen Inseln und südlich von Casablanca in Marokko war spanische Kolonie und wurde am 14.01.1958 Überseegebiet. Am 04.01.1969 wurde es an Marokko übergeben. Ifni ist 1.500 qkm groß und hat 52.000 Einwohner, von denen die Mehrheit Berber sind. Die Hauptstadt ist Sidi Ifni (heute auch nur Ifni) mit 15.000 Einwohnern. Bereits 1476 wurde Ifni erstmals von Spanien annektiert. Doch nur 48 Jahre später wurde es 1524 zurück erobert. Erst 1860 gelangte Ifni im Zusammenhang mit dem Vertrag von Tanger wieder unter spanische Kontrolle. Auch als Frankreich und Spanien 1956 Marokko in die Unabhängigkeit entließen, behielt Spanien neben den Enklaven Ceuta und Melilla auch Ifni sowie die Westsahara. Von 1946 bis 1958 war Ifni Teil von Spanisch-Westafrika und anschließend spanische Überseeprovinz. Im Dezember 1957 scheiterte von marokkanischer Seite ein Versuch, die Kolonie zu besetzen. zurück Kap Jubi ist ein Kap an der südlichen Küste Marokkos, nicht weit von der Grenze zur Westsahara, östlich der Kanarischen Inseln. Im Jahr 1879 gründete die britische North West Africa Company einen Handelsposten, den sie Port Victoria nannte. Wenig später, 1895 wurde dieser jedoch an den Sultan von Marokko verkauft. 1912 verhandelte Spanien mit Frankreich, welches die Angelegenheiten Marokkos vertrat, um Zugeständnisse im Süden Marokkos. Am 29.07.1916 wurde das Kap schließlich von Francisco Bens besetzt. Der Ort wurde als Stützpunkt für Luftpostdienste genutzt. Die Kolonie bedeckte eine Fläche von 32.900 qkm und besaß eine Bevölkerung von 9.836 Personen. Der Hauptort war Villa Bens, das heutige Tarfaya. Mit der Unabhängigkeit 1956 verlangte Marokko die Rückgabe der durch Spanien kontrollierten Gebiete. Nach einigem Widerstand und Kämpfen 1957 wurde das Kap Jubi 1958 an Marokko abgetreten. zurück Kuba gehört zu den Großen Antillen in der Karibik und war bis 1898 spanische Kolonie. zurück 1521 entdeckte Ferdinand Magellan als erster Europäer die Inselgruppe und nannte sie "Islas de Ladrones", "Ladronen" oder "Diebsinseln", weil die dortigen Bewohner nach europäischer Auffassung Dinge von Magellans Schiffen gestohlen hatten. 1667 wurden sie von Spanien in Besitz genommen und nach der spanischen Königin Maria Anna von Österreich, der Gemahlin von König Philipp IV., benannt. Nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg trat Spanien im Jahre 1898 den südlichen Teil mit der Insel Guam an die USA ab und verkaufte mit dem Deutsch-Spanischen Vertrag am 12.02.1899 den nördlichen Teil an das Deutsche Reich, das die Inseln zur Kolonie Marianen erklärte. Nach dem 1. Weltkrieg wurden die Marianen durch den Völkerbund unter japanische Kontrolle gestellt, nach dem 2. Weltkrieg durch die UNO unter Kontrolle der USA, die ihnen 1978 den Status eines mit den USA assoziierten Staates zubilligten (Nördliche Marianen) außer Guam, das als "dependent territory" unter direkter Kolonialherrschaft der USA steht und nur eine gewisse innere Autonomie besitzt, da es als wichtiger militärischer Stützpunkt der USA dient. Bis 1899 gehörten die Marianen zu den Philippinen. zurück Die Philippinen waren eine spanische Kolonie, die am 10.12.1898 an die USA abgetreten wurde. zurück Puerto Rico war zusammen mit Kuba spanische Kolonie bis 1998 und wurde am 12.12.1998 an die USA abgetreten. zurück Rio de Oro war eine spanische Kolonie, die 1924 zu Spanisch-Sahara kam. Río de Oro wurde nach dem gleichnamigen - üblicherweise ausgetrockneten - Fluß benannt und stellte zusammen mit Saguia el Hamra eine der beiden spanischen Provinzen der Westsahara vor dem Abzug seiner Truppen durch Spanien im Jahre 1975 unter Übergabe des Territoriums an die südlichen und nördlichen Nachbarländer Marokko und Mauretanien dar. Die Gesamtfläche betrug 184.000 qkm. Provinzhauptstadt war der zu spanischen Zeiten Villa Cisneros genannte Hafenort Ad-Dakhla. Der ursprüngliche Name Rio do Ouro geht auf portugiesische Kaufleute zurück, die 1442 ihre Waren gegen Goldstaub eintauschten und deshalb glaubten, hier an der Mündung des im 14. Jh. in Europa bekanntgewordenen goldreichen Staates Mali unter Mansu Musa zu sein, obwohl dort nie Gold gefunden wurde. zurück Rio Muni war spanische Kolonie, die 1959 bei der Teilung der spanischen Besitzungen im Golf von Guinea entstand. Heute heißt das Gebiet "Mbini". Am 11.10.1968 wurde die Kolonie zusammen mit Fernando Poo unter dem Namen Äquatorialguinea unabhängig. zurück Der Begriff "Spanische Niederlande" bezeichnet das Gebiet der heutigen Niederlande, Belgiens und Luxemburgs zur Zeit der spanischen Herrschaft. Nach der Abdankung Kaiser Karls V. im Jahr 1556, der die vom Haus Burgund gesammelten Niederlande zu einer Blütezeit gebracht und sie auch im Burgundischen Reichskreis als politische Einheit organisiert hatte, fielen diese nach der Teilung der Habsburgischen Besitztümer an die Spanische Linie. Der durch Despotismus und kirchlichen Verfolgungseifer seines Nachfolgers Philipp II. hervorgerufene Achtzigjährige Krieg führte nach vergeblichen Versuchen, die politische Einheit der nördlichen und der südlichen der Siebzehn Provinzen aufrechtzuerhalten, eine Trennung herbei. Die sieben nördlichen Provinzen konstituierten sich durch die Utrechter Union (Januar 1579) als protestantische Republik, die sich 1581 als Republik der Sieben Vereinigten Provinzen endgültig für unabhängig erklärte. Die Herrschaft der Spanier über den Süden, der dem Katholizismus treu geblieben war, wurde dabei durch die Eroberung Antwerpens (17.08.1585) auf Dauer gefestigt. Kurzzeitig selbständig waren die Spanischen Niederlande zwischen 1598 und 1621, nachdem Philipp II. das Land an seine Tochter Isabella Clara Eugenia und deren Gemahl Albrecht VII. von Österreich abgetreten hatte. Durch seine Kunstsinnigkeit und seine tolerante Politik trug das Paar nicht unwesentlich dazu bei, die Einwohner der südlichen Niederlande für die spanische Herrschaft zu gewinnen. Nach dem Tod des kinderlosen Albrecht fiel das Land allerdings vertragsgemäß wieder an Spanien. In dem fast ununterbrochenen Krieg Spaniens mit den Niederlanden gelang weder ersterem die Wiederunterwerfung der abgefallenen Provinzen, noch letzteren die Befreiung der spanisch gebliebenen. Nur Teile von Flandern, Brabant, Geldern und Limburg fielen als die sogenannten Generalitätslande an die Republik der Niederlande, als im Westfälischen Frieden 1648 die spanischen Niederlande endgültig von der Republik getrennt wurden. Diese verbliebenen südlichen Niederlande sind der Vorläuferstaat des heutigen Belgien. Spanien ließ die Schließung der Schelde durch die Holländer zu, was den Süden vom Seehandel vollständig aussperrte. In den Eroberungskriegen Frankreichs dienten die Spanischen Niederlande dem spanischen Mutterland fast immer als Kriegsschauplatz und Entschädigungobjekt. Im Pyrenäenfrieden (1659) trat Spanien unter anderem die Grafschaft Artois, Gravelines, Landrecy, Diedenhofen, Le Quesnoy und Montmédy an Frankreich ab. Die im Devolutionskrieg von den Franzosen gemachten Eroberungen trennten unter anderem Lille, Charleroi, Oudenaarde und Kortrijk ab. Während diese Gebiete zwar im Nimwegener Frieden (1679) teils wieder an die Spanischen Niederlande zurückfielen, mussten andere Gebietseinbußen (beispielsweise Valenciennes, Nieuwpoort, Cambrai, Saint-Omer, Ypern und Charlemont) hingenommen werden, die im Frieden von Rijswijk von 1697 nur teilweise kompensiert werden konnten. Durch die Friedensschlüsse von Utrecht und Rastatt (1713 und 1714), die dem auch auf niederländischem Gebiet ausgefochtenen spanischen Erbfolgekrieg ein Ende machten, fielen die südlichen Niederlande an Österreich und hießen fortan Österreichische Niederlande. zurück Beim "Spanischen Escudo" handelte es sich um zwei unterschiedliche Münzsorten, zum einen die goldene Standardmünze bis 1833, zum anderen eine dezimale Silbermünzen, die 1864-68 geprägt wurde. Bereits 1868, nach der ersten Abschaffung der Monarchie kam es zur Einführung der Peseta, wobei im Verhältnis 2 1/2 Pts. pro Escudo umgestellt wurde. Escudos zirkulierten bis 1872. zurück Der Real (abgeleitet von spanischen Wort "rey" = deutsch: "König") war die Währung von Spanien für mehrere Jahrhunderte. Pedro IV. von Aragon begann Mitte des 14. Jh. mit der Prägung von Gold-Reales auf Mallorca. In Spanien wurden seit Mitte des 14. Jh. auch Silbermünzen mit der Bezeichnung "Real" geprägt, ausgehend von Mallorca und Valencia. Die einfachen Reale wurden in großen Mengen geprägt und hatten in der Hochzeit des spanischen Imperiums einen erheblichen Anteil am europäischen Geldumlauf des 16. und teilweise des 17. Jh. In der permanenten spanischen Wirtschaftskrise des 18 Jh. fand eine erhebliche Entwertung statt. Der Portugiesische Real wurde um die gleiche Zeit eingeführt, wie der spanische, verlor jedoch schnell an Wert und sank zur kupfernen Scheidemünze ab, blieb aber Berechnungsgrundlage. Auch in den Spanischen Niederlanden wurden silberne "Reale" geprägt - bis in die Spätphase des niederländischen Unabhängigkeitskrieges. Aus den reichen Silbervorkommen Südamerikas wurden ab dem 16. Jh. Real-Stücke geprägt. Am bekanntesten wohl die Münze zu 8 Reales ("Piece of eight"), die mit einem Gewicht von ca. 27 Gramm dem Taler gleichwertig war. Silbermünzen zu 1/2, 1, 2, 4 und 8 Reales waren bis Ende des 19. Jh. in Mittel- und Südamerika gängig - zu Kolonialzeiten meist mit dem Konterfei des jeweiligen spanischen Königs, nach der Unabhängigkeit meist mit landestypischen Symbolen und oft der Abbildung einer sogenannten Freiheitsmütze. Auch in Nordamerika und vielen weiteren Ländern wie dem Sudan, Eritrea, Ländern des Indischen Ozeans und China zirkulierten (vor allem 8-)Reales-Münzen als Zahlungsmittel - teilweise durch Gegenstempel umgewidmet. Ab Ende des 19. Jh. wurde die Währung "Real/Reales" oft durch landesspezifische Währungen ersetzt. zurück Spanisch-Guinea war eine spanische Kolonie am Golf von Guinea. Sie bestand aus den Inseln Fernando Poo (heute: Bioko), Annobón (Annobom, zeitweise Pagalu) und den Corisco-Inseln sowie aus dem Festland Rio Muni (heute Mbini). Insgesamt war sie 26.659 qkm groß und besaß 170.000 Einwohner (1949). zurück &&Spanisch-Marokko&& (arabisch: Amayat Isbaniya bi-l-Magrib) war die Bezeichnung für einen Landstreifen entlang der marokkanischen Mittelmeerküste (mit den beiden Städten Ceuta und Melilla), der von 1912 (Vertrag von Fes) bis 1956 spanisches Protektorat war und den sogenannten Tarfaya-Streifen zwischen der damaligen Kolonie Spanisch-Westafrika und dem französischen Marokko darstellte. Die Hauptstadt von Spanisch-Marokko war Tétouan. In Spanisch-Marokko nahm 1936 der Putsch Francisco Francos gegen die spanische Regierung und damit der Spanische Bürgerkrieg seinen Ausgang, der 1939 mit Francos Sieg endete und in eine von ihm geführte Diktatur mündete, die erst mit seinem Tod 1975 endete. 1956 wurden Spanisch-Marokko und das französische Marokko zeitgleich und vereinigt in die Unabhängigkeit entlassen. Einige Teile des Gebiets – die Plaza de soberanía, Ceuta mit der Isla Perejil, Melilla und die Inselgruppen Chafarinas, Alhucemas und Vélez de la Gomera – wurden davon ausgenommen und blieben bei Spanien. Der Tarfaya-Streifen wurde 1958 marokkanisch. zurück Im Jahre 1924 wurden die spanischen Kolonien La Agüera und Rio de Oro zu &&Spanisch-Sahara&& zusammengeschlosen. Es handelt sich um ein Territorium an der Atlantikküste Nordwestafrikas. am 26.02.1976 wrude das Gebiet teils an Marokko bzw. Mauretanien übergeben und 1979 ganz von Marokko besetzt. zurück &&Spanisch-Westafrika&& bezeichnet eine spanische Kolonie im Nordwesten von Afrika, die 1934 mit dem Zusammenschluß der spanischen Besitztümer Ifni und Spanisch-Sahara entstand. Sie war über 250.000 qkm groß. zurück Spanisch-Westindien umfaßte Kuba und Puerto Rico mit den Großen Antillen und war bis 1898 spanische Kolonie. Zwischen 1868 und 1870 erklärte eine republikanische Regierung die Unabhängigkeit. zurück Dies ist die Bezeichnung des maschinengeprägten spanisch-amerikanischen Peso (8 Reales), der vor und nach der Unabhängigkeit in Nordamerika ein wichtiges und unverzichtbares Zahlungsmittel in den Kolonien bzw. den Vereinigten Staaten von Amerika war. Die im Norden des Kontinents umlaufende Großsilbermünze stammte meist aus der Münzstätte von Mexiko City. zurück Die "Sparschwemme" (auch: Ersparnisschwemme: englisch: Saving glut bzw. Savings glut) ist ein von Ben Bernanke 2005 geprägter Begriff, der eine Hypothese beschreibt, wonach weltweit ein Überhang an Ersparnissen im Vergleich zu den Investitionsmöglichkeiten besteht. Die Folgen der Sparschwemme sind: - Weltweit steigende Ungleichgewichte im Außenhandel, - Niedrige Zinssätze. Geplante Ersparnisse, die höher sind als die geplanten Investitionen, führen zu einem Sinken des Zinssatzes. Steigende Vermögenspreise sind das Ergebnis niedriger Zinssätze. zurück Sparta besaß kein ausgeprägtes Geldwesen, da es in frühester Zeit aus eisernen Spießen bestanden haben soll. Während der Blütezeit der griechischen Klassik gab es überhaupt keine Münzen. Ab dem 3. Jh. v.Chr. sind einige wenige Prägungen, die nicht sonderlich ansehnlich sind. Im 2. Jh. gab es Münzen aus Bronze, aber meist wurden fremde Münzen benutzt. Die wenigen spartanischen Münzen erkennt man leicht an den beiden Buchstaben "L" und "A" (für "Lakonia") auf den Rückseiten. zurück Das sog. "Spatengeld" zählt zu den vormünzlichen Zahlungsmitteln und gehört zum Gerätegeld. Das Spatengeld leitet sich vermutlich von einem frühen Ackergerät ab, ist aber für den Gebrauch als Gerät ungeeignet. Es kommt im Sudan vor, aber nicht in rechteckiger Form, wie moderne Spaten, sondern fladenförmig. Unter den chinesischen Gerätemünzen, die eine Zwitterform zwischen Gerätegeld und Münzen darstellen, stellen die von den Chinesen "Bù" genannten Spatenmünzen eine interessante Geldform dar, an der sich die Entwicklung der Geldform vom frühen "Spatengeld", das noch dem Ackergerät ähnelte, zu immer abstrahierteren späteren Formen nachvollziehen läßt. zurück Deutsche Bezeichnung für den englischen Spade Guinea. zurück Das chinesische Spatengeld war ursprünglich die Währung der immer größere Gebiete Nordchinas beherrschenden Tschou-Dynastie (1122-249 v.Chr.) und auch in den kleineren Feudalstaaten des Westens und Nordens (u.a. Chen, Song und Lu). Je leichter und in der Form differenzierter die Spatenmünzen waren, desto später sind sie entstanden. Das frühe Spatengeld ist selten, die jüngeren Stücke fast alle beschriftet, wobei die Beschriftung zunehmend das ganze Spatenblatt bedeckt. Von den Chinesen werden die Spatenmünzen "Bù" genannt. Die erste und älteste Gruppe reicht zurück ins 12./11. Jh. v.Chr. und hat noch am ehesten Ähnlichkeit mit dem Arbeitsgerät Spaten. Diese frühen Bronzestücke haben einen hohlen Schaft, der in das Spatenblatt hinein reicht. Die Unterseiten des Blatts verlaufen meist gerade oder leicht konvex abgerundet. Sie sind meist noch unbeschriftet, die beschrifteten Stücke zeigen die große Siegelschrift, die bis zum 3. Jh. v. Chr. üblich war. Um 400 v. Chr. kommt eine Gruppe von Spatenmünzen mit leicht konkav gerundeten Unterseiten des Spatenblatts auf. Charakteristisch ist das Aufsitzen des hohlen Schafts auf den Schultern des Spatenblatts und drei beidseitig vertikal verlaufende Linien auf dem Blatt. Man unterscheidet zwei Typen: Wenn die Schultern des Blatts hochgezogen sind, verlaufen die Linien meist parallel, bei den Blättern mit abfallendem Schulterverlauf sind die drei Linien meist radial angeordnet. Diese Stücke sind meist mit Zahlen, zyklischen Zeichen und Städtenamen beschriftet. Zwischen 400 und ca. 340 v.Chr. entstand eine Gruppe von Spatenmünzen, die an Stelle des Hohlschafts einen flachen Stutzen vorweisen und die in der Mitte der Blattunterseite - mehr oder weniger stark - mit gerundeten Einschnitten in Form eines Torbogens versehen sind. Die Schulterseiten des Blatts verlaufen meist gerundet, allenfalls gerade, aber nicht mehr hochgezogen. Die Flächen des Blattes sind meist mit der Legende bedeckt, nur noch wenige erscheinen mit senkrechten Linien. Die Schriftzeichen beziehen sich auf Angaben zu Münzstätte, Wertzahl und Münzeinheit (oft 1/2, 1 oder 2 Jin). In den folgenden 90 Jahren bis zum Ende der Tschou-Dynastie um 250 v.Chr. gibt es mehrere Typen und Varianten in zwei Größen. Die Unterseiten sind rund, eckig oder spitz eingeschnitten, die Schultern der Spatenblätter hochgezogen, gerade oder abfallend, der Schaft eckig, trapezförmig oder rund. Ein überall abgerundeter Typ mit drei Löchern am Schaft und den beiden Füßen lief seit 336 v.Chr. im Staat der aufstrebenden Chin-Dynastie um, die nach der Unterwerfung der anderen Feudalstaaten (bis 221 n.Chr.) zum erstenmal ganz China einte. Die Landesbezeichnung "China" entstand nach dem Namen der Chin-Dynastie. zurück Italienisch für "weit" (dänisch: bred, französisch: espacé, niederländisch: ruim, portugiesisch: espacado, spanisch: espaciado). zurück Das lateinische Wort "Species" ("Sehen", "Aussehen") wird meist in Zusammensetzungen, wie z. B. Speciestaler, gebraucht und bedeutet soviel wie "ausgemünztes Geld", im Gegensatz zu Rechnungsmünzen. Der Ausdruck war vor allem in den skandinavischen Ländern und in Deutschland gebräuchlich. zurück Dänisch für Speciestaler. zurück In der Mitte des 18. Jh. wurden die Reichstaler, die nach dem 9-Talerfuß geprägt waren, als "Speciestaler" bezeichnet. Sie galten 32 Groschen, im Gegensatz zu den Rechnungstalern, die nur 24 Groschen (also ein Viertel weniger) galten. zurück Der "Speer" ist eine zu den Stangenwaffen zählende Wurf- und Stichwaffe, die auf Grund ihrer Konstruktion besonders gut zum Werfen geeignet ist. Es gibt verschiedene Versionen, die aus Stein, Knochen, Holz oder Metall bestehen. Als Sportwaffe sind sie bis heute in Gebrauch. Sie gehören zu den ältesten von Menschen verwendeten Kampf- und Jagdwaffen. zurück Hierbei handelt es sich um eine Ausgabe, deren Herstellung und Vertrieb nicht nur zur üblichen Verwendung, sondern besonders zu spekulativen Zwecken erfolgt. Dabei kann es die folgenden Kriterien geben: - besonders kleine Auflagenhöhe, - Abgabe nur an bestimmte Personen, - kurze, eingeschränkte Gültigkeit, - eingeschränkte Verwendungsmöglichkeit. zurück Sperandio (geb. um 1430; gest. 1504) hieß eigentlich Bartolomeo Savelli (genannt Sperandio) und war ein vielseitiger italienischer Künstler der Renaissance, der in Mantua geboren und in Ferrara aufgewachsen war. Sperandio betätigte sich als Medailleur, Bildhauer und Goldschmied und arbeitete während der zweiten Hälfte des 15. Jh. in Mantua, Bologna, Ferrara, Mailand und Venedig. Es sind etwa 50 Medaillen bekannt, die Sperandio zugeschrieben werden, die meisten sind mit der Signatur "OPUS SPERANDEI" versehen. Die Stärke von Sperandio liegt in der Ausdruckskraft der Porträts, die nicht nur geistliche und weltliche Herrscher zeigen, sondern auch Hofleute, Dichter, Professoren, Ärzte und Bankiers. Zu seinen vielleicht schönsten Bildnissen zählt das Porträt des Federico da Montefeltre (1444-1482), das auf der Vorderseite den Herzog von Urbino im Profil zeigt. Die Rückseite zeigt den Herrscher als Feldherr zu Pferd. zurück Spes ist die römische Personifikation der Hoffnung und wird auf römischen Münzen der Römischen Kaiserzeit meist als stehende oder schreitende Figur dargestellt, mit einer Blume in einer Hand, mit der anderen Hand ihr Gewand raffend. So ist sie auch auf der Rückseite eines Sesterz unter Kaiser Claudius (41-54 n.Chr.) zu sehen, der unter Kaiser Titus (79-81 n.Chr.) restituiert wurde. zurück Italienisch für "dick" (dänisch: tyk, englisch: thick, französisch: épais, niederländisch: dik, portugiesisch: espêsso, spanisch: grueso). zurück Speyer war eine keltische Gründung und Bistum und Stadt, wo es ab 760 n.Chr. auch eine Münzstätte gab, die Trienten aus Gold prägte und später auch kaiserliche Münzstätte war. Im Verlauf des Mittelalters ging das Münzrecht auf das Bistum und die Stadt über. Schon 969 erhielt der Bischof Otgar das Münzrecht, aber die Bischöfe prägten eigentlich erst ab 1030, als Denare mit dem Bild des amtierenden Bischofs erschienen. Die Pfennige zuvor zeigten meist den altrömischen Stadtnamen "Nemetis" und ein Boot. Es folgten Dünnpfennige, 1373 Goldgulden und ab 1560 auch Taler, die schon bald in der späteren Bischofsresidenz Bruchsal geprägt wurden. Nach der Besetzung durch die Franzosen im Jahre 1794 kam Speyer zunächst 1803 an Baden und 1821 an Bayern, das bis 1856 dort mehrere goldene Dukaten mit dem Stadtbild prägen ließ. Die Stadt Speyer hatte 1294 ihre Reichsunmittelbarkeit erlangt und ließ erstmals 1346 städtische Heller mit der Domfassade und einem "S" auf der Rückseite prägen. eine zweite und letzte städtische Prägung gab es im Jahre 1624. zurück Eine "Spezialbank" ist ein Kreditinstitut, das nur einzelne Produkte des Bankgeschäftes anbietet, die in Deutschland durch das Kreditwesengesetz definiert sind. Im deutschsprachigen Raum sind Universalbanken mit ihrem Angebot der gesamten Leistungspalette der Standard im Bankgeschäft. Im angloamerikanischen Rechtsgebiet sind "Spezialbanken" üblich. Im Wesentlichen unterscheidet man hierbei das Realkreditinstitut, die Investmentbank, die Bausparkasse, die Direktbank, die Wertpapiersammelbank und das Kreditinstitut mit Sonderaufgaben. zurück Hierbei handelt es sich um einen Katalog zu Sondergebieten der Numismatik. zurück Hierbei handelt es sich um einen Prüfer, der für bestimmte Sammelgebiete oder auch nur bestimmte Ausgaben zugelassen ist. zurück Bezeichnung für eine Art des Münzen- bzw. Medaillensammeln, bei der nur Münzen eines kleinen, fest umrissenen Teilgebietes zusammengetragen werden. zurück Bezeichnung für eine Sammlung, die sich auf ein kleines, fest umrissenes numismatisches Teilgebiet beschränkt. zurück Andere Bezeichnung für Siegelkunde. zurück Alternative Bezeichnung für Polierte Platte. zurück Bei den "Spielmarken" handelt es sich um Marken, die bei Glücksspielen stellvertretend für Münzen benutzt wurden. Bei den Römern benutzte man schon bestimmte Tessarae zu diesem Zweck. In der Neuzeit waren dies vorwiegend Rechenpfennige, Münzmeisterjetons und andere Marken oder Jetons. zurück Dies ist die volkstümliche Spottbezeichnung brandenburgisch-preußischer Kleinmünzen, die das Zepter in den Fängen des Adlers so undeutlich darstellen, daß es von der Bevölkerung als "Spieß" gedeutet wurde. Vor allem die Roten Sechser und die nachfolgenden 6-Pfennig-Stücke anderen Typs wurden bis ins 19. Jh. als "Spieße" bezeichnet. zurück Das &&"Spindelprägewerk"&& (auch Stoß- oder Balancierwerk nach dem französische Wort "Balancier") wurde vermutlich in Italien erfunden. Die erste Verwendung eines noch einfachen Spindelwerks soll auf Donato Bramante und Benvenuto Cellini zurückgehen. Es wurde hauptsächlich für die Herstellung von Medaillen benutzt. Um 1550 soll ein Spindelprägewerk des Augsburger Goldschmieds Max Schwab zur Prägung von Münzen verwendet worden sein. Bald darauf bemühte sich Elois Mestrelle, die Spindelprägung auch in Paris und London einzuführen, scheiterte aber am Widerstand der Münzmeister. Erst über hundert Jahre später wurde das Spindelprägewerk in allen größeren Münzstätten allgemein eingeführt. Das ausgereifte Spindelprägewerk erlaubte eine präzisere und schnellere Prägung, denn bis zu 30 Münzen in der Minute konnten damit geprägt werden. Dabei wird der Oberstempel mittels einer Spindelschraube auf Schrötling und Unterstempel gesenkt. Zur Erzeugung des Prägedrucks wird die Kraft auf die Spindel durch eine doppelarmige Schwingachse übertragen, an deren Enden schwere Schwunggewichte befestigt sind. Die Schwungarme wurden durch mehrere Arbeiter mittels Zugriemen angeworfen oder angestoßen (später auch durch Dampfkraft oder Elektromotoren). Durch den Schwung und die Hebelkraft der schweren Gewichte war der Prägedruck so stark, daß eine Senkung des Oberstempels zur Erzielung einer sehr guten Prägewirkung ausreichte. Bei der Hand- oder Hammerprägung mußten oftmals mehrere Hammerschläge auf den Schrötling ausgeführt werden, um eine zufriedenstellende Wirkung zu erzielen. Auf Grund der Heftigkeit des Stoßes mußten die Spindelprägewerke fest in den Fundamenten im Erdgeschoß oder Keller der Münzgebäude verankert sein. Vor dem Spindelwerk war meist eine Vertiefung oder Grube in das Fundament eingelassen, in der ein Münzarbeiter saß, der den Schrötling in die Unterstempel einlegte und nach dem Spindelstoß die geprägten Münzen wieder entnahm. Das Spindelprägewerk fand noch bis ins 19. Jh. Anwendung und wurde erst durch das 1817 von Dietrich Uhlhorn erfundene Kniehebelprägewerk (Kniehebelprägung) allmählich verdrängt. zurück zurück Name eines britischen Auktionshauses in London. zurück Bei den "Spintriae" handelt es sich um eine bestimmte Gruppe römischer Tessarae, die auf Grund ihrer erotischen Darstellungen als Eintritts- oder Wertmarken für Bordelle gedeutet werden. Insbesondere eine gleichartige Folge der frühen Zeit der römischen Kaiser, die auf den Vorderseiten erotische Darstellungen und auf den Rückseite die Ziffern I bis XVI tragen, werden als "Spintriae" bezeichnet. zurück Der "Spitzvierpaß" ist eine besondere Art des Vierpaß, bei dem die ornamentale Umrandung der Bögen durch acht nach außen weisende Spitzen unterbrochen ist. zurück Spitzbergen steht seit 1925 unter norwegischer Verwaltung und besitzt zwei norwegische und zwei russische Kohlegruben, die eher aus politischen Gründen betrieben werden. Während in der norwegischen Hauptstadt Longyearbyen die Geldscheine der "Store Norske Spitsbergen Kulkompani" gleichberechtigt neben dem staatlichen Geld überall angenommen werden, gibt es in den russischen Grubenstädten einen Zwangskurs für die Noten der Gesellschaft "Arltikugol" und staatliches Geld ist nicht im Umlauf. 1946 ließ diese Gesellschaft in Leningrad eigene Münzen prägen zu 10, 15, 20 und 50 Kopeken, die 1957 von Geldscheinen abgelöst wurden. 1993 wurden nochmals Münzen zu 10,- 25, 50 und 100 Rubeln veausgabt. Da aber die Russische Föderation als Ausgabestelle galt, legten die Norweger Protest ein und die Münzen wurden zurückgezogen und an Sammler verkauft. zurück Der "Spitzdreipaß" ist eine besondere Art des Dreipaß, bei dem die ornamentale Umrandung der Bögen durch drei nach außen weisende Spitzen unterbrochen ist. zurück Beim "Spitzgroschen" handelt es sich um einen sächsischen Groschen, der nach der Münzordnung vom 28.12.1474 aus gutem Silber im Namen des Kürfürsten Ernst (1464-1486) und der Herzöge Albrecht (1464-1500) und Wilhelm III. (1445-1482) in Freiberg, Dresden, Zwickau und Colditz geschlagen wurden. Dem Wert eines rheinischen Goldguldens sollten 20 Spitzgroschen entsprechen. Ihr Name leitet sich von dem spitzen Dreipaß ab, mit dem der Landsberger Schild auf der einen und/oder der sächsische Rautenschild auf der anderen Seite umgeben war. Sie waren wegen ihres hohen Silbergehalts beliebt und wurden unter Kurfürst Moritz (Kurfürst 1547-1553) in Freiberg und Annaberg und unter Kurfürst August (1553-1586) in Freiberg und Dresden noch einmal geprägt, allerdings im Wert von 21 Gulden, denn seit 1490 war die alte Bewertung nicht mehr zu halten. Trotz ihres hohen Werts sahen die "Spitzgroschen" relativ klein aus. Das erklärt sich durch den hohen Silbergehalt (937/1000) der Stücke. Es wurden auch im Durchmesser wesentlich größere und schwerere Halbstücke gleichen Aussehens ausgegeben, die aber bei weitem nicht so feinhaltig waren. Um den Namen "Spitzgroschen" nicht in Verruf zu bringen, sollten diese Halbstücke nach der Münzordnung von 1482 offiziell "halbe Schwertgroschen" genannt werden. Die zwischen Ernst und Albrecht getroffenen Abmachungen bezüglich der Prägung der halben Spitzgroschen schlossen ihren Oheim Wilhelm aus. Daraufhin ließ dieser die Halbstücke in seinen thüringischen Landen verrufen. zurück Der "Spitzvierpaß" ist eine besondere Art des Vierpaß, bei dem die ornamentale Umrandung der Bögen durch vier nach außen weisende Spitzen unterbrochen ist. zurück Italienisch für "vorzüglich" (englisch: Extremely fine, französisch: Superbe, niederländisch: Prachtig, spanisch: Extraordinariamente bien conservado). zurück Spoleto ist eine Stadt in Italien in der heutigen Region Umbrien. Im Mittelalter gab es dort auch eine päpstliche Münzstätte, die vor allem für die Renaissance-Päpste in der zweiten Hälfte des 15. und der ersten Hälfte des 16. Jh. prägte. zurück "Spottmedaillen" mit ironischen und satirischen Darstellungen und Beschriftungen kommen schon seit der Zeit des Barocks vor. Vor allem Ereignisse des Zeitgeschehens, Institutionen und ihre Vertreter waren Gegenstand des Spotts. Der Pietismus, Revolutionen, Aufstände, Kriege und Antisemitismus gaben u.a. Anlaß zu Karikaturen und ironischen Beschriftungen. Auch erotische Medaillen sowie Hunger- bzw. Teuerungsmedaillen sind oft von Spott begleitet. Ein Meister der barocken Spottmedaille war Christian Wermuth. In der neueren Zeit schuf Karl Xaver Goetz eine Reihe von Spottmedaillen. Mit spöttischen Darstellungen sind eine Reihe von Jetons (auch amtliche) und Volksmedaillen versehen. Kaiserliche Rechenpfennige sollen mit der Darstellung eines Fuchses, der den Enten predigt, den Papst verspotten. zurück Beabsichtigte "Spottmünzen", wie die Spottmedaillen, gibt es eigentlich gar nicht. Allerdings regten mehr oder weniger geglückte Münzdarstellungen die Phantasie der Bevölkerung zu spöttischen Münzbezeichnungen an, die im Zusammenhang mit Mißständen, Unterdrückung oder Fehlern und Schwächen der Regenten standen. Der Spott schlug sich in Münzbezeichnungen, wie z. B. Cosel-Dukaten nieder. Die spöttischen Münzbezeichnungen "Vlieger" oder "Spieße" beziehen sich auf die missratenen Darstellungen des Adlers bzw. des Zepters. Die Münzbezeichnung Angsttaler bezieht sich auf den fehlenden Hinweis des Gottesgnadentums auf der Münze, der vom Volk als Angst des Großherzogs Friedrich Franz II. (1842-1883) vor den revolutionären Ereignissen des Jahres 1848 gedeutet wird. Zu den Spottmünzen zählen auch ironisierende Umgravierungen von Münzen, wie sie während des Second Empire (1852-1870) in Frankreich entstanden sind (z. B. "Empire français" in "Vampire français" umgraviert). zurück Auf sogenannten "Spott-Talern" hat Herzog Heinrich Julius von Braunschweig diverse symbolische Motive zu den Zwistigkeiten unter den Adelsgeschlechtern Saldern, Steinberg und Stockheim prägen lassen. zurück Bei den "Spruchgroschen" handelt es sich um Groschen mit Sprüchen oder Zitaten auf den Rückseiten, die vor allem zur Reformationszeit und zur Kipper- und Wipperzeit ausgegeben wurden. Es handelte sich vor allem um Zitate aus der Bibel und um fromme Sprüche. Die Groschenmünzen waren als Träger der propagandistischen Parolen geeignet, denn sie stellten den Hauptgeldumlauf des einfachen Volkes dar. Die Sprüche sollten die "Taten" der Herrscher verbreiten und Friedens- oder Kriegsbereitschaft wecken. In der Kipper- und Wipperzeit versuchte man auch das schlechthaltige Silber der Groschen durch einen "frommen Spruch" zu verbergen. Bekannt für ihre Spruchgroschen waren die sächsischen Herzöge, vor allem später noch einmal Ernst der Fromme von Sachsen-Gotha (1648-1678). zurück Dies ist die englische Bezeichnung des halben Ryal, wie er in der zweiten und dritten Münzausgabe (1604-1619) unter König Jakob I. ausgegeben wurde. Die Goldmünze zu 15 Shilling ist nach einer Besonderheit der Rückseitendarstellung benannt. Die früher auf der Rückseite des Ryal dargestellten Sonnenstrahlen sind so zugespitzt, daß sie eher an Sporen (englisch: "spurs") erinnern. zurück Englisch für "Quadrat" bzw. "Viereck" (dänisch: firkant, französisch: carré, italienisch: quadrato, niederländisch: vierkant, portugiesisch: quadrado, spanisch: cuadrado). zurück zurück Beim "Srang" handelt es sich um eine tibetische Silbermünze im Wert von 10 Sho, die ursprünglich seit 1909 im Gewicht von 18,5 g ausgegeben wurde. In den Jahren 1909, 1914 und 1918/19 erschienen vier verschiedene Typen, teilweise mit Varianten. Zwischen 1918 und 1921 wurde ein Goldstück im Wert von 20 "Srang" geprägt. In den 30er Jahren erschienen 1 1/2- und 3-Srang-Stücke, allerdings nur mit einem Gewicht von 5 und 11,3 g und seit 1947 erschienen auch im Silbergehalt verminderte 10-Srang-Stücke, die auf den Vorderseiten meist einen stilisierten Löwen vor drei Berggipfeln und zwei Sonnen (Variante: eine Sonne und ein Mond) zeigen. Die Rückseiten zeigen meist buddhistische Symbole und tibetische Schriftzeichen, u.a. mit Wertangabe und Jahreszahl. Außerdem sind sehr seltene Versuchsprägungen von 5-, 25- und 50-Srang-Stücken aus den frühen 50er Jahren bekannt. Die Srang-Prägung endete 1952, zwei Jahre nach dem Beginn der schrittweisen Invasion der chinesischen Truppen in das tibetische Hochland. Die Jahresangaben der Silberstücke sind meist in zyklischer Datierung auf Basis des tibetischen Kalenders angegeben. zurück Länderkennzeichen für Serbien. zurück Serbisch für Serbien. zurück Landesname von Serbien und Montenegro. zurück ISO-4217-Code für den Suriname-Dollar. zurück  Das ehemalige Ceylon nannte sich am 22.05.1972 in &&Sri Lanka&& um. Die Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka ist ein Inselstaat im Indischen Ozean vor der Südspitze des Indischen Subkontinents. Das ehemalige Ceylon nannte sich am 22.05.1972 in &&Sri Lanka&& um. Die Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka ist ein Inselstaat im Indischen Ozean vor der Südspitze des Indischen Subkontinents.Sri Lanka liegt im Indischen Ozean, südöstlich des indischen Subkontinents, zwischen 6° und 10° nördlicher Breite und zwischen 79° und 82° östlicher Länge. Es mißt ca. 445 km in Nord-Süd und 225 km in Ost-West. Von Indien (Bundesstaat Tamil Nadu) ist es durch die Palkstraße und den Golf von Mannar getrennt. Die Korallenfelsinseln der Adamsbrücke stellen eine lose Verbindung zwischen dem Nordwesten Sri Lankas und dem indischen Festland dar. Amtssprache: Singhalesisch, Tamil Hauptstadt: Colombo Regierungssitz: Sri Jayawardenepura Staatsform: Präsidialrepublik Fläche: 65.610 qkm Einwohnerzahl: 20,222 Mio. (2006) Bevölkerungsdichte: 308,2 Einwohner pro qkm BIP/Einwohner: 1.160 US-Dollar (2004) Unabhängigkeit vom Großbritannien: 04.02.1948 Nationalfeiertag: 4. Februar Zeitzone: UTC +5,5h Währung: Sri-Lanka-Rupie (LKR) zurück Die "Sri-Lanka-Rupie" (ISO-4217-Code: LKR; Abkürzung: Rs.) ist die aktuelle Währung von Sri Lanka. Es gilt 1 Rupie = 100 Cents. Sie wird von der Zentralbank von Sri Lanka ausgegeben. Im Jahre 1825 wurde das Britische Pfund zum offiziellen Buchungsgeld von Ceylon erklärt und ersetzte damit den ceylonesischen Rixdollar mit einem Umrechnungsfaktor von 1 Pfund = 13 Rixdollar. Die britischen Silbermünzen wurde somit zum gesetzlichen Zahlungsmittel. Ab dem 26.09.1836 wurde die Indische Rupie zum Standard erklärt, die am 18.06.1869 auch formal zum uneingeschränkten gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt wurde. Am 23. August wurde die zuvor in 16 Anna, 64 Paisa und 192 Pai eingeteilte Rupie dezimalisiert und in 100 Cent unterteilt. Damit wurde sie zu Ceylons Geldmarktwährung und ab dem 01.01.1872 zu dem alleinigen gesetzlichen Zahlungsmittel, womit sie das britische Pfund mit einem Umtauschkurs von 1 Rupie = 2 Schillings und 3 Pence ersetzte. Zwischen 1940 und 1944 wurde ein Austausch der Münzen durchgeführt. Die Herstellung der 1/2-Cent-Münze wurde ab 1940 eingestellt und die 1-Cent-Münze ab 1942 in Bronze gefertigt. Nickel-Messing ersetzte im gleichen Jahr die Legierung aus Kupfer-Nickel der 5-Cent-Münze, wie auch ab 1943 das Silber bei den 25- und 50-Cent-Stücken. Im Jahre 1944 wurden gezähnte Nickel-Messingmünzen zu 2 und 10 Cent eingeführt. 1963 wurde eine neue Münzserie ohne Porträt eines Monarchen eingeführt. Die verausgabten 1- und 2-Cent-Münzen bestanden aus Aluminium, 5 und 10 Cent aus Nickel-Messing, 2 Cent, 50 Cent und 1 Rupie aus Kupfer-Nickel. Eine Kupfer-Nickel-Münze zu 2 Rupien und eine Münze aus Aluminium-Bronze zu 5 Rupien wurden schließlich 1984 eingeführt. Die seit 1963 ausgegebenen Münzen tragen auf der Vorderseite den Wappenschild von Sri Lanka. Die Rückseite zeigt den Nennwert und darunter die Wertangabe in Sinhala, Tamil und Englisch sowie das Ausgabejahr am unteren Rand und der Aufschrift "Sri Lanka" in Sinhala am oberen Rand. Am 14.12.2005 verausgabte die Zentralbank von Sri Lanka eine neue Münzserie in den Nennwerten von 25 und 50 Cent, 1, 2 und 5 Rupien. Die niedrigeren Nennwerte von 1, 2, 5 und 10 Cent, die ebenfalls eine gesetzliche Zahlungsfähigkeit besitzen, sind weitgehend aus dem Umlauf verschwunden und werden in der Regel von Banken nicht mehr ausgegeben. zurück "S$" ist die Abkürzung für den Singapur-Dollar. zurück "St" ist die Abkürzung für Stempelglanz, einen Erhaltungsgrad einer frisch geprägten Münze, bevor sie in Umlauf kommt. zurück zurück Beim "Staatendaalder" handelt es sich um eine von einigen niederländischen Provinzen geschlagene Talermünze im Gewicht von 30,5 g, die nur in den Jahren 1578/79 vor der 1579 geschlossenen Union von Utrecht geschlagen wurde. Der Staatendaalder zeigt auf der Vorderseite das Hüftbild des spanischen Königs Philipp II. mit Krone auf dem Haupt und einem Zepter in der linken Hand und auf der Rückseite den Wappenschild mit der Vlieskette darum, in der Umschrift "PACE ET IVSTITIA" (deutsch: "Mit Frieden und Gerechtigkeit"). Sie galt ursprünglich 32 Stuiver, im Jahr 1586 wurde ihr Wert auf 38 Stuiver und im 17. Jh. auf 42 Stuiver erhöht. zurück Als "Staatenschelling" (auch: Rijder- oder Placeatschelling) werden die seit 1672 geprägten niederländischen Schillinge zu 6 Stuiver bezeichnet, die auf den Vorderseiten den Provinzialschild und auf den Rückseiten einen Reiter mit Schwert zeigen. Da ihre Vollwertigkeit auf Plakaten betont wurde, werden sie auch "Placeatschellinge" genannt. Die Prägung endete 1692, die vollwertigen Stücke wurden 1693/94 mit einem Gegenstempel (niederländisch: Klop) in Form eines Pfeilbündel markiert und danach als "Klopschelling" bezeichnet. Der Wert der minderwertigen Stücke wurde auf 5 1/2, später auf 5 Stuiver reduziert. zurück Bezeichnung für etwas behördlich bzw. amtlich Veranlaßtes (englisch: official, französisch: officiel bzw. public). zurück Die "Staatliche Münze Berlin" (SMB) gehört zu den Deutschen Münzprägeanstalten. zurück Die "Staatliche Münze Karlsruhe" gehört zu den Deutschen Münzprägeanstalten. zurück Die "Staatliche Münze Stuttgart" gehört zu den Deutschen Münzprägeanstalten. zurück Die "Staatsbank der DDR" war die Zentralbank der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. zurück Bezeichnung für eine Druckerei in staatlicher Hand, die z.B. für den Druck von Marken, Papiergeld, amtlichen Formularen, Pässen etc. zuständig ist (englisch: state printing works bzw. national printing works, französisch: imprimerie nationale). Bekannte Staatsdruckereien sind u.a. die (deutsche) Bundesdruckerei in Berlin oder die Österreichische Staatsdruckerei in Wien. zurück Name eines amerikanischen Auktionshauses in New York. zurück Der Ortsname "Stade" geht auf das plattdeutsche Wort für "Ufer" zurück, es ist heute noch in dem Begriff "Gestade" enthalten. Die Stadt Stade liegt am südwestlichen Ufer der Unterelbe, etwa 45 km westlich von Hamburg und besaß eine eigene Münzstätte, in der schon im Mittelalter für das Erzbistum Bremen geprägt wurde. zurück Hierbei handelt es sich um (minderwertige) Münzen, die nur in einer Stadt zu ihrem Nennwert galten, außerhalb dieser Bereiche jedoch zu ihrem (geringeren) Metallwert umliefen. zurück Alternative Bezeichnung für Städtemünzen. zurück 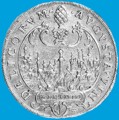 Beim "Stadtpyr" handelt es sich um eine heraldische Figur aus dem Mittelalter, die als Hauptbestandteil des Wappens von Augsburg auf vielen (auch neuzeitlichen) Münzen der Freien Reichsstadt (seit 1806 zu Bayern) zu sehen ist. Das Zeichen entwickelte sich aus der antiken Figur des Pinienzapfens und ähnelt diesem. Beim "Stadtpyr" handelt es sich um eine heraldische Figur aus dem Mittelalter, die als Hauptbestandteil des Wappens von Augsburg auf vielen (auch neuzeitlichen) Münzen der Freien Reichsstadt (seit 1806 zu Bayern) zu sehen ist. Das Zeichen entwickelte sich aus der antiken Figur des Pinienzapfens und ähnelt diesem.zurück Hiebei handelt es sich um das Wappen einer Stadt. In "Stadtwappen" befinden sich gewöhnlich keine Helme oder ähnliche Zusätze, jedoch oft Mauerkronen. Fast jede Stadt besitzt ein Stadtwappen. zurück Der auf der Münze als Kreisbegrenzung erscheinende erhöhte Rand wird als "Stäbchen" oder "Randstäbchen" bezeichnet. Das Stäbchen ist so hoch wie oder höher als der höchste Punkt des Reliefs des Münzbildes bzw. der Schrift und schützt diese vor der Abnutzung. Wenn gleich große Münzen mit Stäbchenrand aufeinander gestapelt oder nebeneinander gelegt eingerollt werden, liegen sie auf den Stäbchen. zurück  Der Begriff "Stäbler" (auch: Stebler) bezeichnet verschiedene Pfennigmünzen. Die ältesten Stäbler sind einseitige Pfennige, die von der Stadt Basel nach Erlangung des Münzrechts 1373 geschlagen wurden. Sie zeigen meist das Wappen der Stadt, den Baselstab. Nach Gründung des Rappenmünzbundes im oberrheinischen Gebiet ging der Name auf das Halbstück des Rappens über, auch wenn diese nicht mehr den Baselstab zeigten. Es galten 2 Rappen (Zweiling) = 1 "Stäbler". Diese wurden 1403 als Vereinsmünze des Münzbundes geschlagen, ursprünglich als Vierschlag-Pfennige. Im Jahr 1425 verloren die Stäbler des Rappenmünzbundes ihre eckige Gestalt und wurden auch im Gewicht reduziert. Der Stäbler konnte sich bis ins 16. Jh. behaupten, war im Jahr 1533 zu einer Billonmünze im Gewicht unter 2 g gesunken und wurde nun auch als Hälbling oder Heller bezeichnet. Stäbler wurden auch von anderen schweizerischen Münzständen geschlagen, allerdings geringwertiger als die des Rappenmünzbundes. Der Begriff "Stäbler" (auch: Stebler) bezeichnet verschiedene Pfennigmünzen. Die ältesten Stäbler sind einseitige Pfennige, die von der Stadt Basel nach Erlangung des Münzrechts 1373 geschlagen wurden. Sie zeigen meist das Wappen der Stadt, den Baselstab. Nach Gründung des Rappenmünzbundes im oberrheinischen Gebiet ging der Name auf das Halbstück des Rappens über, auch wenn diese nicht mehr den Baselstab zeigten. Es galten 2 Rappen (Zweiling) = 1 "Stäbler". Diese wurden 1403 als Vereinsmünze des Münzbundes geschlagen, ursprünglich als Vierschlag-Pfennige. Im Jahr 1425 verloren die Stäbler des Rappenmünzbundes ihre eckige Gestalt und wurden auch im Gewicht reduziert. Der Stäbler konnte sich bis ins 16. Jh. behaupten, war im Jahr 1533 zu einer Billonmünze im Gewicht unter 2 g gesunken und wurde nun auch als Hälbling oder Heller bezeichnet. Stäbler wurden auch von anderen schweizerischen Münzständen geschlagen, allerdings geringwertiger als die des Rappenmünzbundes.zurück Das Sammeln von Münzen mit Darstellungen von Stadtansichten ist ein attraktives und beliebtes Sammelgebiet. Schon in der Antike wurden Münzen mit Stadtansichten hergestellt. Zu den schönsten zählen römische Provinzialmünzen kleinasiatischer Städte. Vereinzelt wurden auch Städte in Griechenland dargestellt. Römische Münzen zeigten meist nur einzelne Bauwerke, mit Ausnahme der Ansicht des Hafens von Ostia aus der Vogelperspektive auf Sesterzen unter Kaiser Nero. Aus dem Mittelalter sind nur sehr wenige attraktive Stadtansichten bekannt. Erst die Großsilbermünzen der Neuzeit boten aufgrund ihres großen Durchmessers den Stempelschneidern genügend Raum zur Wiedergabe des Stadtpanoramas. Aber auch im Durchmesser kleinere goldene Dukaten und deren Mehrfachstücke zeigen Stadtansichten. In diesem Zusammenhang sind vor allem die Flußgolddukaten zu erwähnen, die oft die Stadtansicht und den Fluß zeigen, aus dem das Gold stammt. Seltener sind Stadtansichten auf Kleinmünzen (Nürnberg und Frankfurt), häufig sind Medaillen mit Stadtansichten zu finden. zurück Dies ist die Bezeichnung für die unter der Münzhoheit von Städten herausgegebenen Münzen. Bereits frühe antike Münzen griechischer Städte und Stadtstaaten werden als "Stadtprägungen" bezeichnet. Dies änderte sich im Wesentlichen erst mit der Entstehung verschiedener hellenistischer Königreiche, die von den Erben der Eroberungen Alexanders des Großen nach dessen Tod gegründet wurden. In Rom lag die Münzhoheit zunächst beim Senat (später auch beim Kaiser), der sie (nach anfänglichem Zögern) den eroberten Völkern im Westen strikt entzog, im Osten aber durchaus Provinzial- und Lokalprägungen zuließ (vor allem in Kleinasien, Ägypten und Syrien, aber auch in Griechenland selbst). Byzanz übernahm im wesentlichen das römische Münzrecht, die germanischen Fürsten prägten zur Völkerwanderungszeit nach byzantinischem und römischem Münzfuß. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, wagten es erst wieder die Karolinger, ihren eigenen Namen auf die Münzen zu setzen. Die Münzhoheit des Fränkischen Reiches verblieb strikt beim Kaiser bzw. König, wurde bei zunehmender Schwächung aber von den starken geistlichen und weltlichen Herren usurpiert und von den Ottonen und Salier schließlich vor allem an Bischöfe und Äbte verpachtet, um ein Gegengewicht gegen die starken weltlichen Fürsten (Herzöge) zu bilden. Der Kampf der Städte um das Münzrecht begann bereits im Hochmittelalter in den wirtschaftlich aufstrebenden Städten. Die frühesten "Städtemünzen" im Mittelalter prägten die wirtschaftlich entwickelten und mächtigen Städte in Oberitalien, nämlich seit dem 9. Jh. bereits Venedig. Im 12. Jh. folgten auch Genua, Florenz, Mailand und Rom. In Deutschland erreichten im 12./13. Jh. die ersten Städte wie Speyer, Lübeck und Hamburg, die Münzstätten zu beaufsichtigen und damit ihre Münzherren zu kontrollieren. Die Reichstädte und die Landstädte, die einem Territorialfürsten unterstanden, machten sich im 13./14. Jh. von den geistlichen oder weltlichen Feudalherren unabhängiger. Die Freien Reichsstädte unterstanden nur dem Kaiser und prägten (zumindest anfänglich) in dessen Namen, erfuhren manchmal sogar von diesem Unterstützung. Zunächst verpachteten, verpfändeten oder verkauften die Münzherren ihr Münzrecht auf Zeit oder auf Dauer, zum Teil war die Prägung auf bestimmte Metalle oder Nominale beschränkt. Neuerteilungen und Erweiterungen der Münzrechte erteilten die Kaiser Maximilian (1493-1519) und Karl V. (1519-1558). Einige Städte schlossen sich zu Münzvereinen zusammen oder beteiligten sich an daran. Die Prägungen der Städte richteten sich nach dem Münzfuß der Reichsmünzordnungen. Vor allem im 17. und 18. Jh. wurden nach geringerem Münzfuß auch Stadtgelder, -pfennige oder -münzen (entsprechend zu den Landmünzen) ausgegeben, die nur im Gebiet der jeweiligen Stadt umlaufberechtigt waren. Eine Besonderheit der städtischen Prägung sind die Belagerungsmünzen belagerter Städte, die keiner Verleihung des Münzrechts bedurften. Stadtmünzen sind ein beliebtes Sammelgebiet. zurück Beim "Stahl" handelt es sich um eine veredelte Form des Eisens, dennoch wegen der Nachteile des Eisens zur Münzprägung aber nur bedingt geeignet. Die Abkürzung von Stahl lautet "St". zurück Als "Stamenon nomisma" (auch: Histamenon) bezeichnet die byzantinische Goldmünze, die unter dem Kaiser Nikephoros II. Phokas (963-969 n.Chr.) an die Stelle des Solidus trat. Sie wog 4,4 g, daneben führte Nikephoros eine zweite Goldmünze ein, die um 1/12 leichtere Tetarteron nomisma (4,05 g). Beide Goldmünzen zeigen zunächst gleichartige Münzbilder (Christusbüste auf den Vorderseiten), sind aber seit dem beginnenden 11. Jh. auf Grund ihrer äußeren Gestaltung unterscheidbar. Im Gegensatz zum etwas kleineren und dickeren Tetarteron wurden die Stamena in zunehmend größerem Durchmesser ausgebracht und entwickelten sich schließlich zu schüsselförmig gewölbten Münze. Bereits vor der Mitte des 11. Jh. verschlechterte sich der Feingehalt der Histamena, bis sie schließlich in den 80er Jahren sogar als Elektron ausgegeben und mit der Münzreform (um 1092) unter Alexios I. Komnenos (1081-1118) von dem Hyperpyron abgelöst wurde. zurück Jacob Stampfer (geb. um 1505; gest. 1579) war ein bedeutender schweizerischer Medailleur und Münzgraveur, Sohn und Schüler eines Züricher Goldschmieds und Münzmeisters, den er 1531 porträtierte. Stampfer schuf eine große Anzahl von Schaumünzen in Gold und Silber. Neben Stempeln für Münzen seiner Heimatstadt Zürich werden ihm auch Stempelschnitte für Münzen von Chur, Zug und St. Gallen zugeschrieben. Der Medaillen- und Münzkünstler schuf die als Schweizer Bundestaler bekannte Schaumünze, die auf der Vorderseite die Schilde der 13 Kantone und der sieben ihnen zugewandten Orte zeigt und auf der Rückseite den Rütlischwur darstellt. zurück Die "Standing Liberty" (deutsch: "Stehende Liberty") ist eine der vier Haupttypen der Darstellung der Liberty auf US-amerikanischen Münzen. zurück Beim "Stanniol" handelt es sich um eine dünne Folie aus Zinn (lateinisch: "stannum") oder Aluminium, wie sie beispielsweise bei der Verpackung von Schokoladentafeln verwendet wird. Münzsammler benutzen sie zur Abformung der Konturen einer Prägung. zurück Die "Stanze" ist eine Einrichtung oder Maschine, mit der man die Schrötlinge aus den Zainen in der Art eines Brieflochers gestanzt werden. Das Stanzen erfolgt mit einem stährlernen, scharfrandigen Stempel auf einer stählernen Unterlage mit dem entsprechenden Ausschnitt, durch den die Schrötlinge dann fallen. Die Arbeit erfolgte mit einer Kurbel oder Spindel von hand, später mit Wasserkraft und heute mit einem automatischen Stanzwerk. zurück Dies ist die Bezeichnung für den in der modernen Münztechnik beim Ausstanzen der Münzplättchen anfallenden Abfall, in der alten Münztechnik Abschrote genannt. Heute schneidet das Stanzwerk gleichzeitig mehrere Ronde aus und die anfallenden "Stanzgitter" werden zerschnitten und wieder eingeschmolzen. zurück Vom 17.12.2001 an wurden sogenannte "Euro-Starter-Kits" ausgegeben. Ein Set (in Deutschland) enthielt 20 Münzen aller Stückelungen im Wert von 10,23 Euro bzw. 20,01 DM. Die Euromünzen sollten dazu dienen, der Bevölkerung ab dem 17.12.2001 den Umgang mit den Euro-Münzen vertraut zu machen und die Euro-Münzen ab dem 01.01.2002 für den Zahlungsverkehr zu verwenden. zurück Die "State Bank of Pakistan" ist die Zentralbank von Pakistan. zurück Von 1999 bis 2008 wurden in den USA die "State Quarters" verausgabt, die jeden der 50 US-Bundesstaaten repräsentieren und die 2009 mit Ausgaben für den District of Columbia und fünf Außengebiete ergänzt wurden. zurück Der State of Upper Yafa war ein britisches Protektorat in Aden. zurück Englisch für "Staatsdruckerei" (französisch: imprimerie nationale). zurück Die zweite wichtige Münze im griechischen Altertum, neben dem Drachme, war der "Stater" (von griechisch: "Statera" = deutsch: "Waage"). Der "Stater" war ursprünglich eine Gewichtsbezeichnung, die auf verschiedene Münzen übertragen wurde. Der verbreiteste "Stater" kam aus Korinth. Er wurde in Silber geprägt, wog etwa 8,5 Gramm und war eine Tridrachme - also 3 Drachmen - wert. Bekannt ist das Motiv mit dem Porträt der behelmten Athene, das sich Jahrtausende später auf den Kursmünzen der ersten Republik Griechenland (1924-1935) wiederfindet. Auf der Rückseite ist das Flügelpferd Pegasos dargestellt, eine weitere Figur der griechischen Mythologie. zurück Die "Staufer" waren ein schwäbisches Adelsgeschlecht, das im 12. und 13. Jh. mehrere schwäbische Herzöge und römisch-deutsche Könige und Kaiser hervorbrachte. Der Name "Staufer" leitet sich von der Burg Hohenstaufen auf dem am Nordrand der Schwäbischen Alb bei Göppingen gelegenen Berg Hohenstaufen ab. Die bedeutendsten Herrscher aus dem Adelsgeschlecht der Staufer waren Friedrich I. (Barbarossa), Heinrich VI. und Friedrich II. zurück Bei der &&"Stauning-Krone"&& handelt es sich um ein dänisches Propagandaerzeugnis der konservativen Jugend gegen den damaligen Staatsminister Th. Stauning aus dem Jahre 1933. Sie hatte als Vorbild die Krone aus den Jahren 1924-1941, wobei wie bei einer Torte ein Teil herausgeschnitten ist. Auf dem Rest steht beiderseits" STAUNING KRONE", womit klar gemacht werden sollte, wieviel die Krone vorher an Wert besaß. zurück ISO-4217-Code für den São-toméischen Dobra. zurück Alternative Schreibweise von Stäbler. zurück Hierbei handelt es sich um den Künstler, der die Ursprungsform entworfen hat (englisch: engraver, französisch: graveur). zurück Das "Stecherzeichen" ähnelt dem Druckerzeichen. Es handelt sich um ein Ornament oder einen Buchstaben oder mehrere, um den Künstler zu identifizieren, der die Ursprungsform entworfen hat. Stecherzeichen gibt es schon seit frühester Zeit auf zahlreichen Münzen und Medaillen. zurück 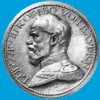 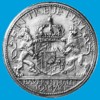 Die &&"Steckmedaille"&& ist eine Variante der Schraubtaler bzw. -medaillen, die nicht miteinander verschraubt, sondern ineinander gesteckt werden. Sie sind meist aus weichen Metallen oder Legierungen hergestellt. Deshalb würde sich ein Schraubgewinde schnell abnutzen. Ihre Ränder sind meist konisch geformt, so daß die beiden Seiten der Medaille gut verschließen. Die &&"Steckmedaille"&& ist eine Variante der Schraubtaler bzw. -medaillen, die nicht miteinander verschraubt, sondern ineinander gesteckt werden. Sie sind meist aus weichen Metallen oder Legierungen hergestellt. Deshalb würde sich ein Schraubgewinde schnell abnutzen. Ihre Ränder sind meist konisch geformt, so daß die beiden Seiten der Medaille gut verschließen.zurück Niederländisch für "ziegelrot" (dänisch: teglrod, englisch: brick-red, französisch: rouge brique, italienisch: rosso scuro, portugiesisch: cor de tijolo, spanisch: rojo ladrillo). zurück Die Steiermark ist heute in Bundesland von Österreich mit der Hauptstadt Graz. Bis zum Ende des 1. Weltkrieges im Jahr 1918 war das Herzogtum Steiermark ein Kronland von Österreich-Ungarn. zurück Beim "Steingeld" handelt es sich um ein vormünzliches Zahlungsmittel aus Stein, das in verschiedenen Teilen der Erde vorkam. In vorkolonialer Zeit gab es in Togo und Teilen Ghana flache, rundliche und in der Mitte mit einem Zentralloch versehene Quarzscheibchen im Durchmesser von 3 bis 10 cm, die als Steingeld angesehen werden. Sie wurden von Sammlern als Togosteine, von den Einheimischen Sokpé (deutsch: Donnersteine) bezeichnet, weil sie vom Himmel gefallen sein sollen. Sie sollen als Zahlungsmittel sowie für magische und rituelle Zwecke Verwendung gefunden haben. Bei den Völkern im Sudan sind zum "Steingeld" gehörige Halbedelsteine aus Karneol und Achaten als Handels- und Tauschmittel verwendet worden. Sie wurden oft in Idar-Oberstein geschliffen und von arabischen und indischen Händlern in Afrika eingeführt. Bei dem noch Anfang des 20. Jh. steinzeitlich lebenden Papua-Volk der Dani im Hochland Westneuguineas wurden länglich-ovale Je-Steine als Zeremonialgeld benutzt. Im Bereich der Südküste von Neubritannien (Melanesien) wurde aus braunem Hartstein das diskusförmige sog. Mok-Mok geschliffen (Durchmesser 5-11 cm), das heute sehr selten ist. Das bekannteste und kurioseste Steingeld findet sich auf den Inseln von Yap, im westlichen Bereich der Karolineninseln (Mikronesien) gelegen und zwischen 1894 und 1914 deutsches Schutzgebiet. Das von den Yap-Insulanern selbst Fä (Fei) oder Rai genannte Geld besteht aus gelblich-weißem Aragonit, der auf den Inseln selbst nicht vorkommt, sondern erst in Steinbrüchen auf den Palau-Inseln unter Mühen gebrochen, bearbeitet und 400 km über die offene See transportiert werden mußte. Die Steingeld-Expeditionen wurden im Auftrag eines gesamten Dorfes ausgeführt, den größten Anteil an Geldsteinen erhielt das Dorfoberhaupt. Das "Steingeld" hatte großen Einfluß auf das Sozialprestige von Einzelpersonen oder das Ansehen von Sippen und Dörfern. Die Prachtstücke sind bis heute vor den Häusern von Einzelpersonen und Gemeinschaftshäusern ausgestellt. Die Steine konnten im Gewicht zwischen 50 g und 3.000 kg schwanken und wurden mit Kanus und Flößen transportiert, eine große seefahrerische Leistung, die bei Sturm mit Lebensgefahr und Verlust der Geldsteine verbunden war. Die Geldsteine haben in der Regel die Form einer runden Scheibe mit einem Loch in der Mitte, das wohl auch zum Tragen und Rollen monströser Stücke diente. Ihr Durchmesser reichte von Handtellergröße bis zu Geldsteinen von 4 m Durchmesser. Neben der Größe war auch die Farbe und die Verarbeitung der Steinscheiben für den Wert entscheidend. Dünne Steine mit feiner kristalliner Körnung und Steine mit milchweißer oder schokoladenbrauner Färbung waren besonders beliebt. Die größten Geldsteine sind jüngeren Datums und wurden von europäischen und amerikanischen Dampfern transportiert. Die massenhafte Einfuhr der Geldsteine von europäischen und amerikanischen Händlern führte gegen Ende des 19. Jh. zu einer Inflation, die den Zusammenbruch der Fä-Währung einleitete. Bis zum 1. Weltkrieg wurde das steinerne Zahlungsmittel noch einigermaßen vielseitig verwendet, heute besitzt es nur noch zur Bezahlung von Strafen (bei Vergehen) einen gewissen Geldcharakter. zurück Als "Steinzeit" bezeichnet man den Zeitabschnitt der Menschheitsgeschichte, in der die Menschen als Werkstoff vorrangig Stein verwendeten (neben Holz, Knochen und Horn). Sie begann vor 2,6 Mio. Jahren und endete, als die Menschen seit dem 7. Jahrtausend v.Chr. lernten, Metalle zu verwenden. Zu regional sehr unterschiedlichen Zeiten lösten Metalle allmählich Stein als vorrangigen Werkstoff (Grundstoff der Werkzeuge) ab. Wo die Entstehung der Menschen durch Werkzeuggebrauch definiert wird, wird die Steinzeit als die erste Epoche der Menschheit angesehen. Die Steinzeit ist die älteste Stufe des von dem dänischen Altertumsforscher Christian Jürgensen Thomsen und anderen seit 1830 propagierten Dreiperiodensystems, welches die Ur- oder Vorgeschichte in die Steinzeit, die Bronzezeit und die Eisenzeit unterteilt. Die Steinzeit selbst wird wiederum unterteilt in das Paläolithikum (Altsteinzeit), das Mesolithikum (Mittelsteinzeit) und das Neolithikum (Jungsteinzeit). zurück Dies ist die Bezeichnung der etwa im Umfang von 460 Exemplaren geschlagenen Proben (1879/80) des geplanten, aber nie verwirklichten US-amerikanischen Goldstücks zu 4 US-Dollar. Sie sind nach der Rückseitendarstellung benannt, die einen fünfstrahligen Stern zeigt, darin "STELLA" und die Wertbezeichnung in Cents. Die geplante Nominale sollte damals ein besseres Wertverhältnis zu den europäischen Goldmünzen herstellen. Es gibt auch Abschläge in unedlen Metallen. zurück Stellaland war eine unabhängige Burenrepublik in Südafrika, die am 27.02.1884 von Großbritannien annektiert und am 30.09.1885 der Kolonie Betschuanaland angegliedert wurde. zurück In einem "Stellenwertsystem" (auch: Positionssystem) bestimmt die Stelle (Position) den Wert der jeweiligen Ziffer. Die niederwertigste Position steht dabei im Allgemeinen rechts. Ein Stellenwertsystem hat eine Basis b. Jede Zifferposition hat einen Wert, der einer Potenz der Basis entspricht. Für die n-te Position hat man einen Wert von bn-1 (wenn die niederwertigste Position mit 1 nummeriert ist). Die Berechnung des Zahlenwertes erfolgt durch Multiplikation der einzelnen Ziffern "zi" mit den zugehörigen Stellenwerten "bi" und Summierung der Produkte. zurück Italienisch für "Wappen" (dänisch: vaben, englisch: coat of arms, französisch: armoiries bzw. blason, niederländisch: wapen, portugiesisch: armas, spanisch: escudo). zurück Hierbei handelt es sich um ein durch Hand- oder Maschinendruck angefertigtes Druckgerät (dänisch: segl, englisch: cancel, französisch: oblitération, italienisch: timbro, niederländisch: stempel, portugiesisch: carimbo, spanisch: sello). Münz- oder Prägestempel sind Prägewerkzeuge, die zur Prägung von Münzen eingesetzt werden, heute als Matrizen bezeichnet. Früher wurden die Schriften und Bilder unter Verwendung von Stichel, Meißel und Schaber von Stempel- oder Eisenschneidern von Hand in die Prägestempel eingeschnitten. Immer wiederkehrende Teile (Zahlen, Buchstaben, Münzmeisterzeichen und Verzierungen) wurden oft auch mit erhabenen Punzen negativ in die Stempel eingeschlagen. Zur Prägung der Vorder- und der Rückseite der Münze benötigte man einen Unterstempel und einen Oberstempel. Bei der Hand- oder Hammerprägung war der meist fest installierte Unterstempel oder Stock, auf den der zu prägende Schrötling gelegt wurde, am unteren Ende mit einem Zapfen versehen, durch den er fest auf einem Holzbock befestigt war. Die Hammerschläge wurden auf den meist frei beweglichen Oberstempel ausgeführt, wobei sich sog. Schlagbärte bildeten (ähnlich wie bei häufig benutzten Meißeln). Bei dem mechanischen Walzenprägewerk war die Matrize mehrfach in die Walzen eingeritzt. Die gewölbten Stempel des Taschenwerks waren mit Zapfen in den Taschen der Walzen befestigt, was ihnen das Aussehen von Pilzen gab. Heute wird der Matrize genannte Stempel mittels Senkverfahren aus der Patrize hergestellt. zurück Änderungen von Stempeln wurden vor allem zu Zeiten vorgenommen, als die Stempel noch von Hand geschnitten wurden. Sie betrafen meist Jahreszahlen und Münzmeisterzeichen. Der Stempelschneider stach die zu ändernden (vertieft liegenden) Teile einfach aus und ersetzte die Stelle durch neue Zeichen. Häufig sind die alten Buchstaben oder Zahlen noch erkennbar. zurück Durch Irrtümer des Stempelschneiders oder Beschädigung des Stempels entstanden "Stempelfehler". Die Irrtümer bestehen oft aus orthographischen, grammatikalischen oder sachlichen Fehlern, wie z.B. Fehlen oder Zusatz von Buchstaben und Zahlen, Verdrehungen der Reihenfolge, falsches Setzen oder Verrutschen des Abstands zwischen den Zeichen. Auch seitenverkehrte, nicht spiegelbildliche Stempelschnitte kommen ebenso vor wie fehlerhafte Wappen. Gelegentlich wurde bei Fehlern sogar Absicht unterstellt, wie beim 3-Mark-Stück von 1924. Anstatt der Randschrift "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" gibt es auch fehlerhafte Randschriften mit "UNECHT" und "UNRECHT". Beschädigungen können schon bei der Patrize auftreten, so z. B. das Ausbrechen besonders hochstehender Teile, das sich dann auf die Matrize und auf die Münze überträgt ("WILHEIM" statt "WILHELM"). Auch Stempelrisse sowie das Herausbrechen ganzer Teile des Stempels kommen vor. zurück "Stempelglanz" (Abkürzung: "st") ist der Erhaltungsgrad einer frisch geprägten Münze, bevor sie in Umlauf kommt (englisch: Brillant uncirculated, französisch: FDC bzw. Fleur de coin, italienisch: FDC bzw. Fior di conio, niederländisch: FDC, spanisch: FDC bzw. Flor di cuño). Sie weist keinerlei Beschädigungen auf und ist der beste Erhaltungsgrad einer normalen Münze, prägefrischer Umlauf- und Gedenkmünze. Diese müssen allerdings frei von Kratzern und anderen Beschädigungen sein. zurück Durch hohen Prägedruck oder Materialfehler entstehen Risse oder Sprünge in den Stempeln, die sich auf den damit geprägten Münzen abdrücken. Dieser erhabene hervorstehende Abdruck des gesprungenen Stempels auf den Münzen wird Stempelsprung oder -riß genannt. Solche Risse kommen auf antiken, mittelalterlichen und neuzeitlichen Münzen häufiger vor und werden erst seit dem 19. Jh. seltener, da sie durch die moderne Prägetechnik und Materialien zunehmend vermieden werden können. Außerdem wird darauf geachtet, fehlerhafte Stempel frühzeitig auszutauschen. Der frühzeitige Austausch beschädigter Stempel bei alten Münzen konnte zu seltenen Stempelriß-Prägungen führen. Wenn gesprungene Stempel über einen längeren Zeitraum zur Prägung verwendet wurden, kann die Abfolge der Prägung alter Münzen oftmals am Wachsen der Stempelrisse festgestellt werden. Obwohl der Stempelsprung keinen Erhaltungsmangel, sondern eher einen Schönheitsfehler darstellt, kann er sich wertmindernd auf die Münze auswirken. zurück Der "Stempelschneider" oder Medailleur wurde früher auch Eisenschneider genannt, weil er die Münzbilder mittels Stichel, Meißel und Schaber spiegelbildlich in ein enthärtetes Eisen schnitt, das später wieder gehärtet wurde. Das änderte sich erst mit der Entwicklung der mechanischen Herstellung der Prägestempel. Heute wird meist die Hartkopie eines Gipsmodells mit einer Reduktionsmaschine auf die passende Größe der Patrize gebracht und mit einer Einsenkpresse auf die Matrize eingesenkt. Die Münz- und Medaillenkünstler der Neuzeit erlernten ihren Beruf an Münzstätten oder an privaten Prägeanstalten, waren als Goldschmiede oder Bildhauer, seltener als Steinschneider (Glyptik) ausgebildet. Einige Medailleure der frühen Renaissance kamen auch von der Malerei. Hervorragende und tüchtige Renaissance arbeiteten auch für mehrere Münzstätten und waren mit den neuesten Entwicklungen der Münztechnik vertraut oder experimentierten mit technischen Neuerungen. zurück Durch hohen Prägedruck oder Materialfehler entstehen Risse oder Sprünge in den Stempeln, die sich auf den damit geprägten Münzen abdrücken. Dieser erhabene hervorstehende Abdruck des gesprungenen Stempels auf den Münzen wird Stempelsprung oder -riss genannt. Solche Risse kommen auf antiken, mittelalterlichen und neuzeitlichen Münzen häufiger vor und werden erst seit dem 19. Jh. seltener, da sie durch die moderne Prägetechnik und Materialien zunehmend vermieden werden können. Außerdem wird darauf geachtet, fehlerhafte Stempel frühzeitig auszutauschen. Der frühzeitige Austausch beschädigter Stempel bei alten Münzen konnte zu seltenen Stempelriß-Prägungen führen. Wenn gesprungene Stempel über einen längeren Zeitraum zur Prägung verwendet wurden, kann die Abfolge der Prägung alter Münzen oftmals am Wachsen der Stempelrisse festgestellt werden. Obwohl der Stempelsprung keinen Erhaltungsmangel, sondern eher einen Schönheitsfehler darstellt, kann er sich wertmindernd auf die Münze auswirken. zurück Die "Stempelstellung" ist die Stellung der Vorder- und Rückseite einer Münze zueinander. Bis ins 18. Jh. hinein war die Stellung unregelmäßig, d. h., es war Zufall, wie dieö Prägestempel aufeinander standen. seitdem sind die Stempelstellungen festgelegt und man unterscheidet zwischen Kehrprägung und Wendeprägung. Die Verwendung dieser beiden Begriffe "Kehr-" und "Wendeprägung" ist nicht ganz unproblematisch. Denn im Sprachgebrauch verhält es sich eher so, daß man eine Münze seitlich wendet (wie man die Seite eines Buchs wendet und nicht kehrt), wohl aber um 180 Grad kehrt. Deshalb werden die Begriffe von Numismatikern und Sammlern oftmals genau umgekehrt verwendet. Die Versuche, obige Definition mit dem Sprachgebrauch in Übereinstimmung zu bringen (mit Ausdrücken wie "Kehrtwendung" oder "von oben nach unten umwenden") scheinen bisher auch nicht zur endgültigen Klärung der Diskussion beigetragen zu haben. Eine endgültige Entscheidung über die Anwendung der Begriffe ist den Numismatikern und Münzfreunden selbst überlassen. Früher oder später wird sich wohl eine einheitliche Verwendung der Ausdrücke durchsetzen. Durch falsches Einsetzen, unrichtiges Ausrichten oder Verrutschen der Münzen kommen häufig auch Exemplare vor, die nicht nach dieser Regel geprägt sind, z. B. deutsche Münzen mit "französischer Prägung". Es gibt auch Münzen, die nicht mit einer Stempeldrehung von 0 oder 180 Grad geprägt wurden, sondern z. B. mit einer Stempeldrehung von 50 Grad. Außergewöhnliche Stempeldrehungen sind in Preislisten oder Auktionskatalogen häufig vermerkt. Da solche Fehler bei Massenauflagen immer wieder vorkommen, rechtfertigen sie nicht die häufig geforderten hohen Preise. zurück Dies ist die griechische Bezeichnung für die Tetradrachmen aus hellenistischer Zeit, die auf den Rückseiten mit einem Kranz (aus Eichenlaub, Lorbeer- oder Ölzweigen) um das Münzbild versehen sind. Sie wurden vermutlich nach dem Vorbild der Athener Tetradrachmen "im neuen Stil" (Glaukes) auf breiten Schrötlingen nach Attischem Münzfuß geprägt, ihre Hauptprägezeit liegt in der 1. Hälfte des 2. Jh. (etwa zwischen 200 und 150 v.Chr.). Sie wurden vor allem in Kleinasien von Städten geprägt, u.a. in Kyzikos, Tenedos, Myrina, Kyme, Aigai, Lebedos und Herakleia (am Latmos). zurück 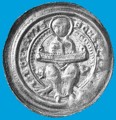 Hierbei handelt es sich um Brakteaten des Bistums Halberstadt, die den Stiftsheiligen St. Stephan zeigen. Sie sind vor allem im 12. und 13. Jh. geprägt worden, aber auch im 14. und 15. Jh. entstanden noch Halberstädter Pfennige, die den Hl. Stephan zeigen. Es gibt verschiedene Darstellungen des Heiligen, darunter auch die Darstellung des Martyriums (Steinigung). Einige Stücke sind Beischläge aus Magdeburg. Die späten Stephanspfennige werden auch als Sargpfennige bezeichnet, weil der viereckig gestaltete Oberkörper des Stiftsheiligen einem Sarg ähnelt. Hierbei handelt es sich um Brakteaten des Bistums Halberstadt, die den Stiftsheiligen St. Stephan zeigen. Sie sind vor allem im 12. und 13. Jh. geprägt worden, aber auch im 14. und 15. Jh. entstanden noch Halberstädter Pfennige, die den Hl. Stephan zeigen. Es gibt verschiedene Darstellungen des Heiligen, darunter auch die Darstellung des Martyriums (Steinigung). Einige Stücke sind Beischläge aus Magdeburg. Die späten Stephanspfennige werden auch als Sargpfennige bezeichnet, weil der viereckig gestaltete Oberkörper des Stiftsheiligen einem Sarg ähnelt.Stephanspfennige sind aber auch Denare der Stadt Besançon aus dem 11. Jh., die mit dem Namen "Stephanus" oder "Promartir" (Erstmärtyrer) beschriftet sind. zurück Bei den "Sterbemedaillen" handelt es sich um zur Erinnerung an den Tod eines Herrschers oder einen Angehörigen der Fürstenfamilie geschlagene Medaillen. zurück  Bei den "Sterbemünzen" handelt es sich um zur Erinnerung an den Tod eines Herrschers oder einen Angehörigen der Fürstenfamilie geschlagene Münzen. In Deutschland kommen Sterbemünzen seit dem ausgehenden 16. Jh. vor. Sie wurden von vielen Münzstände geprägt, besonders von den Herrschern von Sachsen, Braunschweig-Lüneburg, Reuß, Solms, Schwarzberg und Würzburg. Die Tradition der Sterbemünzen hielt sich bis ins 20. Jh., als 2-, 3- und 5-Mark-Stücke auf den Tod der verschiedenen Reichsfürsten geprägt wurden. Bei den "Sterbemünzen" handelt sich meist um Groschen- und Talermünzen, wobei auch Teil- und Mehrfachstücke sowie Goldmünzen und sogar Kleinmünzen kommen vor. Die bildlichen Darstellungen beziehen sich häufig allegorisch auf den Tod oder auf die Ruhmestaten des Verstorbenen (z. B. Famataler). Die Schriften nennen oft Lebensdaten des Verstorbenen und sind mit frommen Sprüchen versehen. Die Sterbemünzen stellen ein beliebtes Sammelgebiet dar. Bei den "Sterbemünzen" handelt es sich um zur Erinnerung an den Tod eines Herrschers oder einen Angehörigen der Fürstenfamilie geschlagene Münzen. In Deutschland kommen Sterbemünzen seit dem ausgehenden 16. Jh. vor. Sie wurden von vielen Münzstände geprägt, besonders von den Herrschern von Sachsen, Braunschweig-Lüneburg, Reuß, Solms, Schwarzberg und Würzburg. Die Tradition der Sterbemünzen hielt sich bis ins 20. Jh., als 2-, 3- und 5-Mark-Stücke auf den Tod der verschiedenen Reichsfürsten geprägt wurden. Bei den "Sterbemünzen" handelt sich meist um Groschen- und Talermünzen, wobei auch Teil- und Mehrfachstücke sowie Goldmünzen und sogar Kleinmünzen kommen vor. Die bildlichen Darstellungen beziehen sich häufig allegorisch auf den Tod oder auf die Ruhmestaten des Verstorbenen (z. B. Famataler). Die Schriften nennen oft Lebensdaten des Verstorbenen und sind mit frommen Sprüchen versehen. Die Sterbemünzen stellen ein beliebtes Sammelgebiet dar.zurück Beim "Sterbetaler" (mit Herz und Totenkopf) handelt es sich um eine beidseitig beschriftete Talermünze, die Herzog Ernst von Sachsen-Gotha (1640-1675) von 1668 bis 1672 verausgabte. Der Taler gehört zu den Sterbemünzen. zurück Die Herkunft des Begriffes "Sterling" ist nicht ganz geklärt, vielleicht ist es von dem späten altenglischen Ausdruck "steorling" in der Bedeutung "Münze mit einem Stern" abgeleitet, zumal einige frühe anglo-normannische Pfennige einen Stern auf der Rückseite aufweisen. Vielleicht wurden auch schon anglo-normannische Pfennigmünzen als Sterling bezeichnet, aber sicher ist die Bezeichnung für die beständigen und hochwertigen mittelalterlichen Pfennigmünzen, die seit 1180 unter dem englischen König Heinrich II. (1154-1189) geprägt wurden. Dieser Typ zeigt auf der Vorderseite das zeptertragende Brustbild des Herrschers in Vorderansicht und auf der Rückseite ein kurzes Zwillingsfadenkreuz mit 4 Kugeln in den Winkeln, danach Short-Cross Penny genannt. Seit 1247/8 zeigt der Sterling über die Umschrift bis zum Münzrand reichende Langkreuze auf den Rückseiten (Lang-Cross Penny), 1278 noch einmal abgeändert (einfaches, breites Kreuz). Im Vergleich mit den Pfennigprägungen auf dem Kontinent war der englische Sterling nicht nur erstaunlich typentreu, sondern im Zeitraum von fast 200 Jahren auch in Gewicht und Feingehalt (von wenigen Ausnahmen abgesehen) bemerkenswert konstant. Zu Beginn der Prägung 1180 hatte er ein Raugewicht von ca. 1,36 g (etwa 925/1000 fein), im letzten Regierungsjahr Edwards III. (1327-1377) wog er immerhin noch etwa 1,17 g. Sterlinge waren in Kontinentaleuropa ausgesprochen beliebt. Sie kommen in Münzfunden bis in den mecklenburgisch-pommerschen Raum vor und wurden auf den Märkten in der Champagne in großen Mengen an italienische Kaufleute verhandelt. Sterlinge liefen auch in Irland um, ähnliche Münzen wurden in Schottland geprägt. Der Einfluß ihrer Münzbilder reicht von Skandinavien bis nach Portugal. Nachahmungen und Beischläge wurden vor allem in Nordfrankreich, Westdeutschland und den Niederlanden produziert, darunter die besonders minderwertigen Lushburnes (Luschburger). Die mit dem Sterling in etwa gleichwertigen norddeutschen Witten wurden den "Sterlingen" angeglichen. In Südwestdeutschland und Westfalen wurden sie auch Engelsche oder Englische genannt, in Dänemark Engelsk. In Frankfurt a.M. war sogar eine Nominale mit der Bezeichnung "Englisch" versehen. Als Münzbezeichnung hielt sich der Ausdruck bis zum Ende des Mittelalters. Im Laufe des 13. Jh. begann sich der Name Sterling-Silber als Standard-Feingehaltsangabe (925/1000) einzubürgern, zunächst in den oberitalienischen Handelsstädten Venedig und Genua, davon ausgehend auch im östlichen Mittelmeerraum. Im 14. Jh. war Sterling die übliche Bezeichnung für den Standard-Feingehalt von Silberbarren in Venedig. Im Laufe des 14. Jh. ist die Standard-Feingehaltsbezeichnung - neben der Münzbezeichnung - auch für Westeuropa dokumentiert. Erst mit Einführung der Goldwährung in Großbritannien im frühen 19. Jh. beginnt die Bedeutung von "Sterling" als Standard-Feingehaltsangabe abzunehmen. Die englischen Silbermünzen wurden noch bis 1919 in einer Legierung von 925 Tausendteilen Silber und 75 Promille Kupfer ausgemünzt. Seit der Mitte des 15. Jh. verschiebt sich die Bedeutung des Ausdrucks "Sterling" (vorher Münzbezeichnung) in englischsprachigen Dokumenten auf die englische Währung. Da im Mittelalter aus einem Pfund (Pound) Silber 240 Sterlinge geprägt wurden, bürgerte sich als Zähleinheit der Ausdruck "pound of sterlings", in Dokumenten lat. "libra sterlingorum" ("Sterling" in der Pluralform) ein, der seit der Mitte des 15. Jh.s zunehmend in der Form Pound sterling (Singularform) erscheint. Als Bezeichnung der britischen Währung hat sich der Ausdruck "Pound Sterling" (Pfund Sterling) bis heute erhalten. Seit 1971 gelten 100 (New) Pence = 1 Pound Sterling (zuvor 20 Shillings = 1 Pound Sterling). zurück Mit "Sterling" wurden ursprünglich mittelalterliche Münzen bezeichnet. Unter dem Namen bekannt sind beispielsweise hochwertige Pfennige, die seit dem Jahr 1180 unter dem englischen König Heinrich II. (1154–1189) geprägt wurden. Als Münzbezeichnung hielt sich der Ausdruck in Westeuropa bis Ende des Mittelalters, wobei zunehmend der Name "Sterling-Silber" als Standardangabe für einen Feingehalt von 925 Tausendstel Anteilen an Edelmetall stand. Heute ist "Sterling" nicht nur ein international anerkannter Begriff, sondern auch die gängigste Metalllegierung bei Gedenkmünzen. In der Bundesrepublik Deutschland werden die Silbermünzen seit 1998 in dieser hochwertigen Legierung geprägt. Und natürlich wird diese Tradition auch im Euro-Zeitalter fortgesetzt. In England wurde der Ausdruck "Sterling" sogar Teil der Währungsbezeichnung. Da im Mittelalter aus einem Pfund (englisch: Pound) Silber 240 Sterlinge geprägt wurden, verbreitete sich zunächst als Zähleinheit der Ausdruck "Pound of Sterlings". Später bezeichnete "Pound Sterling" die britische Währungseinheit. zurück Ein "Stern" ist in der Astronomie eine massereiche, selbstleuchtende Gaskugel. Die Alltagssprache hingegen meint damit jeden leuchtenden Himmelskörper, der dem bloßen Auge punktförmig erscheint. Sterne kommen auch recht häufig auf Münzen vor. zurück   Dies ist die volkstümliche Bezeichnung für die Taler, die Landgraf Friedrich II. von Hessen-Kassel (1760-1785) in den Jahren 1776, 1778 und 1779 prägen ließ. Sie zeigen den Stern des 1770 gestifteten Ordens vom Goldenen Löwen auf der Rückseite. Die Münze stammt aus der Zeit, als der Landgraf hessische Soldaten als Söldner an England verkaufte, die im Unabhängigkeitskrieg in Nordamerika gegen die aufständischen Siedler kämpften. Da die Münze (vielleicht als Handgeld) auch in die Hände der Söldner gelangt sein soll, wurde sie von US-amerikanischen Sammlern auch als Blutdollar oder Bluttaler bezeichnet. Dies ist die volkstümliche Bezeichnung für die Taler, die Landgraf Friedrich II. von Hessen-Kassel (1760-1785) in den Jahren 1776, 1778 und 1779 prägen ließ. Sie zeigen den Stern des 1770 gestifteten Ordens vom Goldenen Löwen auf der Rückseite. Die Münze stammt aus der Zeit, als der Landgraf hessische Soldaten als Söldner an England verkaufte, die im Unabhängigkeitskrieg in Nordamerika gegen die aufständischen Siedler kämpften. Da die Münze (vielleicht als Handgeld) auch in die Hände der Söldner gelangt sein soll, wurde sie von US-amerikanischen Sammlern auch als Blutdollar oder Bluttaler bezeichnet.zurück Stettin (polnisch: Szczecin) ist heute die Hauptstadt der polnischen Woiwodschaft Westpommern. Stettin entwickelte sich Ende des 12. Jh. aus einer wendischen und zwei benachbarten deutschen Siedlungen, denen der pommersche Herzog Barnim I. 1243 das Stadtrecht verlieh. Danach wuchsen die Stadtteile schnell zusammen und Stettin wurde zu einem bedeutenden Handelsplatz. 1278 erfolgte die Aufnahme in den Hansebund. Herzog Otto I. machte Stettin 1309 zur Residenzstadt Pommerns. 1451 und 1464 wütete die Pest in der Stadt. Nach Einführung der Reformation wurde in Stettin die erste weltliche Hochschule Pommerns, das Pädagogium, gegründet. Von 1630/37 bis 1713/20 war Stettin in schwedischer Hand. 1659 widerstand sie den Belagerern, aber 1677 während des Schwedisch-Brandenburgischen Krieges eroberte Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg die Stadt, mußte sie aber wieder abgeben. 1713 besetzte der preußische König Friedrich Wilhelm I. die Stadt und erwarb sie endgültig durch den Stockholmer Frieden von 1720. Während der napoleonischen Kriege wurde die Festung 1806 von den Franzosen kampflos eingenommen, die die Stadt bis 1813 besetzt hielten. In der Stettiner Münzstätte arbeitete zeitweise auch Jakob Abraham und dort wurde der Stettiner Schilling geprägt. zurück Der Schilling von Stettin hatte ein Raugewicht von 1,33 g und ein Feingewicht 0,54 g). Um 1670 galten 11 "Stettiner Schillinge" 15 Schillinge Lübischer Währung. zurück Die "Stettiner Währung" ist eine Abart der Lübischen Währung im 16. und 17. Jh. Sie entstand dadurch, daß die Stettiner Kaufleute an den alten, schweren Münzen festhielten, so daß der Wert bestehen blieb, als diese nicht mehr umliefen. Es wurden neue schwere Münzen geprägt, während Lübeck zu einem leichteren Münzfuß überging. Der Schilling hatte ein Raugewicht von 1,33 g und ein Feingewicht 0,54 g). Um 1670 galten 11 Stettiner Schillinge 15 Schillinge Lübischer Währung. zurück Lateinisch für Antimon. zurück Dies ist die Spottbezeichnung für preußische Groschen (Gute Groschen) und Halbgroschen aus Billon, die unter König Friedrich dem Großen (1740-1788) zwischen 1786 und 1786 geprägt wurden. Die Vorderseiten zeigen das gekrönte, offene Monogramm in Antiqua-Schrift, das einem Stiefelknecht ähnelt, der früher zum Ausziehen der Schuhe diente. Die Rückseiten tragen die Wertbezeichnung "48" bzw. "24 / EINEN / THALER". zurück Johann Jakob Stierle (geb. 1764; gest. 1806) war Stempelschneider und Medailleur, der seine Kunst an der Prägeanstalt von Loos lernte. Im Jahr 1784 wurde er an die Münzstätte in Berlin berufen. Neben zahlreichen Münzstempeln fertigte er auch eine Reihe von Medaillen auf zeitgeschichtliche Ereignisse und Persönlichkeiten seiner Zeit, u.a. auf die Hinrichtung König Ludwigs XVI. von Frankreich und seiner Gemahlin Marie Antoinette. zurück Johann Baptist Stiglmayr (geb. 1791; gest. 1844) war ein deutscher Medailleur und Stempelschneider, der großes Geschick in der Herstellung von Gußmedaillen besaß. Er arbeitete viel für Ludwig I. von Bayern. Sein bekanntestes Werk ist der Konventionstaler aus dem Jahre 1828, der auf der Vorderseite eine Büste des Königs und auf der Rückseite ein kleineres Porträt der Königin zeigt, das von Medaillons ihrer Kinder umgeben ist. zurück Rumänisch für Transnistrien. zurück Englisch für den niederländischen Stuiver. zurück Hierbei handelt es sich um Spottmedaillen aus dem Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel, die auf den Rückseite einen Stockfisch und zwei Oberarme mit Holzhämmern in Händen zeigen, die den Stockfisch klopfen und dazu die Umschrift "NON NISI CONTVSVS" (deutsch: "Nicht (genießbar), wenn nicht geklopft"). Der erste, unter Herzog Heinrich Julius (1589-1613) im Jahr 1612 geprägte Typ, zeigt auf der Vorderseite das fünffach behelmte Wappen. Der unter seinem Nachfolger Friedrich Ulrich (1613-1634) im Jahr 1614 geprägte Typ zeigt ebenfalls das Stockfischmotiv mit Umschrift, auf der anderen Seite die Schrift "WAN MANS / STOCKFISCHS / GENIESSEN SOL / MVS MAN IHN ZVVOR / KLOPFEN WOL SO / FINDET MAN VIEL / FAVLER LEVT DIE / NICHTS THVN WAN / MAN SIE NICHT / BLEVT * HR. F / 1614". Die Veranlassung der Prägung ist nicht bekannt, vermutlich nimmt sie die Faulheit, die den Herzögen bei ihren Regierungsgeschäften begegnete, aufs Korn. Möglicherweise bezieht sich die Prägung auf die Braunschweiger, die zu dieser Zeit den geforderten Lehnseid nicht leisten wollten, was zu Belagerung und Reichsacht führte. Eine ähnliche Medaille aus Hamburg zeigt auf der Vorderseite den fünffach geklopften Stockfisch mit obiger Umschrift und auf der Rückseite den in fünf Teile zerlegten Fisch mit der Umschrift "ALIVS ET IDEM" (deutsch: "Ein anderer und doch derselbe"). zurück Stockholm ist die Hauptstadt Schwedens und die größte Stadt in Skandinavien. Seit 1643 ist Stockholm Residenz des Königs und besitzt auch eine bedeutende Münzstätte. Die Stelle, an der heute Stockholm steht, wird zum ersten Mal vom isländischen Dichter und Sagenschreiber Snorri Sturluson (1179–1241) in der Ynglingasaga erwähnt. Das älteste überlieferte Dokument ist ein Schutzbrief für das Fogdö-Kloster, ausgestellt im Juli 1252, in dem Stockholm erwähnt wird. In der Erik-Chronik, die zwischen 1320 und 1335 kompiliert wurde, steht, daß der Gründer Stockholms, der Regent Birger Jarl, um das Jahr 1250 eine Festung bauen wollte, um den Mälarsee vor Piratenplünderungen zu schützen. Es gibt keine historischen Belege für eine Existenz Stockholms vor der Mitte des 13. Jh. zurück Die "Stockholms Banco" bzw. Palmstruch-Bank (schwedisch: Palmstruchska banken; heute: Sveriges Riksbank) wurde 1656 von Johan Palmstruch gegründet und gilt als erste Notenbank der Welt. Sie war eine Wechsel- und Leihbank nach dem Vorbild der deutschen und niederländischen Banken. Palmstruch finanzierte den schwedischen Staatshaushalt und bekam als Gegenleistung das Recht, eine eigene Bank zu gründen und Geld zu verleihen. 50 Prozent der Einnahmen mußte er sich mit dem ebenfalls jüdischstämmigen schwedischen Finanzminister teilen. Johan Palmstruch gab ab dem 16.07.1661 das erste Papiergeld aus, welches angeblich durch Gold abgesichert war. Das schwedische Geld bestand bis dahin aus großen unhandlichen Kupfermünzen. 1661 ging die Bank zum Zeitpunkt der schwedischen Kupferkrise dennoch in Konkurs, da Inhaber der Banknoten angesichts fallender Notenkurse den Gegenwert in Gold zurückverlangten, wobei sich herausstellte, dass die Edelmetallreserven der Bank zur Deckung des Notenumlaufs nicht ausreichend war. Palmstruch wurde 1669 zum Tode verurteilt. Die Strafe wurde bald in eine Haftstrafe umgewandelt, aus der Palmstruch kurz vor seinem Tod entlassen wurde. zurück Alternative Bezeichnung für Zainprobe. zurück Englisch für "Restbestand" (dänisch: restbeholdning, französisch: stock restant, italienisch: stocks residu, niederländisch: restvoorraad, portugiesisch: saldo postal, spanisch: stock sobrante). zurück Französisch für "Restbestand" (dänisch: restbeholdning, englisch: stock remainder, italienisch: stocks residu, niederländisch: restvoorraad, portugiesisch: saldo postal, spanisch: stock sobrante). zurück Spanisch für "Restbestand" (dänisch: restbeholdning, englisch: stock remainder, französisch: stock restant, italienisch: stocks residu, niederländisch: restvoorraad, portugiesisch: saldo postal). zurück Italienisch für "Restbestand" (englisch: stock remainder, französisch: stock restant, italienisch: stocks residu, portugiesisch: saldo postal, spanisch: stock sobrante). zurück In Schwarzafrika wurden vor allem aus der Faser der Bambuspalme (Raphia ruffia) stoff- oder mattenartige Zahlungsmittel hergestellt, die weit verbreitet waren, vor allem bei Völkern im heutigen Angola und Kongo. Man nimmt an, da sich die "Stoff-" und "Mattengelder" meist aus Bekleidungsstücken (Lendenschürzen) ableiten. Bei dem in der Kongoregion lebenden Volk der Songye galt das als Mandiba bezeichnete Mattengeld aus Raphia- oder Raffiafasern als Zahlungsmittel zu zeremoniellen und rituellen Zwecken, zur Bezahlung des Brautpreises, zur Begleichung von Geldstrafen sowie als Gold für Bedürfnisse des täglichen Lebens. Bei den Bakuba wurden aus der Raphiafaser etwa 1 Meter lange Plüsche hergestellt, die zur Bezahlung von Strafgeldern verwendet wurden, bei Dorffesten als Schmuck reicher Stammesmitglieder getragen wurden und als wertvolle Erbstücke galten. Der Name der portugiesischen Kolonialmünze "Macuta" soll sich von der Bezeichnung von "Stoffgeld" ableiten, das in Südangola aus der Raffiafaser hergestellt wurde. In der nördlich des Bismarck-Archipels gelegenen Inselgruppe St. Matthias wurde ein gürtelähnliches "Stoffgeld" aus den feinen Fasern der Schraubenpalme gefertigt. zurück Dänisch für "Format" (englisch: size, französisch: format, italienisch: form, niederländisch: formaat, portugiesisch: formato, spanisch: tamano). Dänisch für "Größe" (englisch: size, französisch: grandeur, niederländisch: grootte, portugiesisch: tamanho, spanisch: tamano). zurück Alternative Bezeichnung für Spindelprägewerk. zurück &&"Stoter"&& ist der Beiname verschiedener, gleichwertiger Münzen in den Niederlanden. Ursprünglich wurde der englische Groat zu 4 Pence, der als Handelsmünze im 15./16. Jh. in den Niederlanden umlief, als "Stoter" bezeichnet. Er galt bis 1488 4, danach 6 und seit 1548 schließlich 2 1/2 niederländische Groten. Danach wurden die 1/20-Teilstücke des Philippstaler im Wert von 2 1/2 Stuiver und später noch andere Münzen, die 2 1/2 Stuiver galten, "Stoter" genannt. zurück Hierbei handelt es sich um eine bulgarische Kleinmünze, die seit 1881 geprägt wird. Es gelten 100 Stotinki = 1 Lew. zurück Mehrzahl von Stotinka. zurück Der "Stotinov" war - bis zur Einführung des Euro - die kleine Währungseinheit des 1991 durch Volksabstimmung von Jugoslawien losgelösten Sloweniens. Es galt 1 Tolar = 100 Stotinov. zurück Abkürzungen für "Stempel" in der deutsch sprachigen numismatischen Literatur. zurück Die "Strahlenkrone" ist ein mit gezackten Strahlen versehene Stirnreif und war ursprünglich das Zeichen des Sonnengottes Helios und später der römischen Kaiser. Die "Strahlenkrone" ist häufig auf römischen Münzen der Römischen Kaiserzeit zu sehen, zeitweilig auch zur Unterscheidung der Nominale, wobei die Strahlenkrone das Doppelstück kennzeichnet. Den Dupondius unterscheidet die "Strahlenkrone" vom As, unter Kaiser Decius (248-251 n.Chr.) den Doppelsesterz vom Sesterz und seit Caracalla (211-217 n.Chr.) den Antoninian vom Denar. zurück Die Straits Settlements (wörtlich: "Meerengen-Siedlungen") waren eine britische Kronkolonie mit der Hauptstadt Singapur, die 1867 aus Erwerbungen und Vorbesitz entlang der Straße von Malakka zwischen der malaiischen Halbinsel und Sumatra gebildet wurden. Auf der malaiischen Halbinsel waren ursprünglich nur Malakka und Pinang echte Bestandteile der Straits Settlements, jedoch konnte die englische Krone ihr Herrschaftsgebiet durch Protektion und Föderation im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jh. bis weit in den Norden der malaiischen Halbinsel ausdehnen. Wie in vielen anderen Gebieten Asiens war hier der mexikanische Peso als Währungseinheit üblich. Um nicht auf die Münzimporte angewiesen zu sein, brachten die Engländer, die schon im 19. Jh. kupferne Cent-Stücke und silberne Mehrfachstücke in Umlauf gebracht hatten, den Britischen Handelsdollar mit einem Gewicht von 26,95 g aus 900er Silber in Umlauf. Gewicht und Feingehalt wurde für den Straits-Dollar übernommen, der am 25.06.1903 eingeführt wurde. Es galt 1 Straits-Dollar = 100 Cent. Die Vorderseite zeigt das gekrönte Brustbild des Königs Edward VII. und die Rückseite ein Ornament mit Wertangabe in chinesisch und malaiisch. Nach einer baldigen Reduzierung in Gewicht und Durchmesser, wurde der Straits-Dollar von 1919 bis zu seinem Prägeende 1926 schließlich auf das Gewicht von 16,85 und den Feingehalt von 500/1000 reduziert. Er galt nicht nur in den Straits Settlements, sondern auch in der britischen Kolonie Nordborneo, Brunei, auf der Insel Labuan, der Weihnachts-Insel sowie in Sarawak. zurück Dies die Bezeichnung für die englische Kronkolonie Straits Settlements mit den malaiischen Staaten Johor, Kedah, Kelantan, Negri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor, Sungei Ujong und Trengganu. zurück Stralsund ist eine Stadt im heutigen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern im Norden Deutschlands. Die Hansestadt liegt am Strelasund, einer Meerenge der Ostsee, und wird auf Grund ihrer Lage als Tor zur Insel Rügen bezeichnet. 1234 erhielt Stralsund das Lübische Stadtrecht. In früherer Zeit gab es dort auch eine eigene Münzstätte. zurück Straßburg ist heute die Hauptstadt der im Osten Frankreichs gelegenen Region Elsaß. Straßburg wurde von dem römischen Feldherren Drusus im Jahre 12 v.Chr. als ein militärischer Außenposten namens "Argentoratum" (deutsch: "Silberburg") in der späteren Provinz Germania superior gegründet. In dessen Nähe befand sich bereits eine gallische Siedlung. Unter Trajan und nach dem Brand von 97 hatte Argentoratum seine größte Ausdehnung und stärkste Befestigung erreicht. Straßburg war möglicherweise ab dem 4. Jh. Bischofssitz. Im 5. Jh. wurde die Stadt durch Alemannen, Hunnen und Franken erobert. Im Mittelalter gehörte Straßburg zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Als eine der Folgen des Schwarzen Todes, der verheerenden europäischen Pestepidemie der Jahre 1348–49, fand am 14.02.1349 einer der ersten und größten Pogrome des Mittelalters statt. Im Laufe des sogenannten "Valentinstagmassakers" wurden mehrere Hundert Straßburger Juden öffentlich verbrannt und die Überlebenden der Stadt verwiesen. Bis Ende des 18. Jh. blieb es Juden bei Todesstrafe untersagt, nach 10 Uhr abends innerhalb der Stadtmauern zu verweilen. Durch den Anschluß an die Reformation wurde Straßburg lutherisch. Am 20.02.1529 schaffte der Rat der Stadt die Heilige Messe ab. Auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 legte Straßburg ebenfalls ein Bekenntnis zur Reformation ab. Straßburg schloß sich dabei aber zunächst nicht den lutherischen Protestanten der "Confessio Augustana" an, sondern legte mit Memmingen, Konstanz und Lindau ein eigenes, von Martin Bucer und Wolfgang Capito verfaßtes Bekenntnis, die nach den vier Städten sogenannte "Confessio Tetrapolitana" ab. Erst die zwischen Martin Luther und ebenfalls Bucer ausgehandelte "Wittenberger Konkordie" von 1536 sorgte für eine festere theologische und politische Anbindung an das Luthertum. 1531 nahmen Vertreter der Stadt am Konvent in Schmalkalden teil und später wurde Straßburg Mitglied des Schmalkaldischen Bundes zur Verteidigung der evangelischen Reichsstände gegen Kaiser Karl V. 1598 verpflichtete sich Straßburg in einer neuen Kirchenordnung auch auf die "Konkordienformel". Nach 1648 strebte Frankreich den Rhein als Grenze an, wobei die im Westfälischen Frieden gewonnene Reichsvogtei über die elsässischen Reichsstädte den eigenen Zwecken nutzbar gemacht wurde. Straßburg blieb davon jedoch zunächst ausgenommen. Erst im Rahmen der 1679 begonnenen Reunionspolitik Königs Ludwigs XIV. geriet auch Straßburg ins Visier. Nachdem die Stadt in diesem Zusammenhang im September 1681 mitten im Frieden durch die Franzosen besetzt worden war, wurde diese Änderung der Herrschaftsverhältnisse im Frieden von Rijswijk 1697 endgültig bestätigt. In der Zeit der französischen Revolution wurde die Stadt zu einem Anziehungspunkt für Republikaner aus Deutschland. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten wurde Straßburg zum Exil für deutsche Oppositionelle und Revolutionäre. 1871, nach dem deutsch-französischen Krieg, wurde Straßburg vom neu gegründeten Deutschen Reich zur Hauptstadt des Reichslandes Elsaß-Lothringen erklärt. Während des Krieges selbst war Straßburg von deutschen Truppen belagert und heftig beschossen worden. Am 28.09.1870 kapitulierte die Stadt, nachdem sie einen Monat lang der Kanonade getrotzt hatte. Nach dem 1. Weltkrieg kam Straßburg nach Frankreich zurück. zurück Die "Straßenbahn-Münzen" gehören zu den sog. Transportation Tokens. zurück Kurzbezeichnung für Straubenpfennige. zurück Als "Straubenpfennige" (auch: Strauben) werden in Dokumenten ein- und zweiseitige Pfennige aus dem 16./17. Jh. bezeichnet, die aus dem Obersächsischen und dem Niedersächsischen Kreis stammen. zurück Beim "Streckwerk" handelt es sich um eine mechanische Maschine, die in der Münztechnik dazu diente, die langen Zaine auf die gewünschte Dicke zu bringen (justieren). Dazu wurden die Zaine mehrfach zwischen zwei Rollen oder Walzen durchgelassen. Zwischen den Durchgängen mußten die Zaine geglüht werden, um sie geschmeidig zu halten. Das noch unausgereifte "Streckwerk", das ursprünglich noch von Hand betrieben werden mußte und noch keine konstant dicken Zaine gewährleistete, kam im 16. Jh. auf. Es konnte sich aber erst im Lauf des 17. Jh. durchsetzen. zurück Niederländisch für "Strich" (dänisch: streg, englisch: dash bzw. line, französisch: trait, italienisch: tratto, portugiesisch: traco, spanisch: linea). zurück Dänisch für "Strich" (englisch: dash bzw. line, französisch: trait, italienisch: tratto, niederländisch: streep, portugiesisch: traco, spanisch: linea). zurück Bezeichnung für eine mit einem Schreibutensil gezogene Linie (dänisch: streg, englisch: dash bzw. line, französisch: trait, italienisch: tratto, niederländisch: streep, portugiesisch: traco, spanisch: linea). zurück Ein "Strichelreif" ist ein am Rand der Münzoberfläche aus kleinen Strichen gebildeter Reif, der seit dem 16. Jh. zum Schutz gegen die illegale Beschneidung der Münzen angebracht wurde, in England seit 1504, in Frankreich seit 1548 angeordnet. Der Strichelreif hielt sich bis ins 19. Jh. und wurde durch die Rändelung überflüssig. zurück &&"Strichlidicken"&& ist die Bezeichnung der Dicken oder Sechsbätzner (24-Kreuzer) der Stadt St. Gallen aus den Jahren 1631 und 1633. Sie zeigen die Wertzahl auf der Vorderseite und Jahreszahl auf der Rückseite im Abschnitt unter einem trennenden Strich. Der Name wurde auch auf anderen schweizerischen Dicken mit ähnlicher Kennzeichnung übertragen. zurück Die "Strichprobe" ist ein Verfahren zur Feststellung des Edelmetallgehalts in Legierungen mittels eines Probiersteins aus schwarzem Kupferschiefer (geschliffen). Eine Goldmünze wird auf dem Probierstein so gerieben, daß sie einen metallischen Strich hinterläßt, der mit einem Strich verglichen wird, der von Probiernadeln stammt. Ein Satz Probiernadeln besteht aus etwa 30 einzelnen Nadeln mit verschiedener Feinheit, die in Karat angegeben ist. Um den Goldgehalt der Goldmünze zu bestimmen, muß die Färbung des Strichs der Goldmünze mit der eines Nadelstrichs übereinstimmen. Somit kann der Feingehalt von der betreffenden Probiernadel abgelesen werden. Ein ähnliches Verfahren wurde auch für Silber angewendet, wobei der Silbergehalt in Lot angegeben wurde. Bei Schmuck findet ein sog. "Goldpolierstern" noch heute Verwendung. zurück Striegau ist eine Stadt in Niederschlesien im heutigen Polen. Sie liegt am Fluß Strzegomka. Im Jahre 1622 wurden dort auch Münzen geprägt. zurück Dies ist die Spottbezeichnung für die sehr geringhaltigen 24-Kreuzer-Stücke aus Schlesien zur Kipper- und Wipperzeit (1621-1623). zurück Hierbei handelt es sich um einseitige Pfennige aus dem Breisgau, die in der ersten Hälfte des 13. Jh. geprägt wurden. Die Bezeichnung leitet sich von der Darstellung eines struppigen Kopfes auf dem Münzbild ab. zurück Das Wort "Stschoty" ist vermutlich vom russischen "Stschot" (deutsch: "Rechnung") abgeleitet und bezeichnet das russische Rechenbrett, das auf dem Dezimalsystem basierte. Wie der Abakus diente die "Stschoty" dem Rechnen auf den Linien und ist ähnlich wie das chinesische Rechenbrett ("suan pan") konstruiert, unterscheidet sich aber im arithmetischen Aufbau. Typisch für die Stschoty ist ein gesondertes Bruchrechnungsbrett und das Fehlen der Einteilung in Fünfereinheiten. Statt der Rechenpfennige wurden im alten Rußland meist Fruchtkerne verwendet. zurück Deutsche Bezeichnung für den niederländischen Schnapphahn bzw. Stuiver. Im ausgehenden 15. Jh. liefen in Ostfriesland Groninger und Emdener Stüber um, die mit 1/24 Goldgulden bewertet wurden. Später gingen 30 Stüber auf den Gulden. Die ersten ostfriesischen Stüber wurden seit etwa 1561 geprägt. Der Viertelstüber wurde auch Örtgen, der Halbe Ciffert oder Zyfert, der Doppelstüber auch Schaft und der Dreifachstüber auch Flindrich genannt. Die Stüber-Rechnung hatte in Ostfriesland bis 1841 Bestand. Bekannt wurden vor allem die 24-Stüber-Stücke, die in der sog. 2. Kipperzeit um 1680 in Emden und Oldenburg geprägt wurden und einen Gulden gelten sollten. Am Niederrhein setzte sich zu Beginn des 17. Jh. der Stüber durch, zuerst im Klevischen, bald aber auch in Jülich und Berg in Konkurrenz zum rheinischen Albus. Besonders zur Zeit des Erbfolgestreits, als nach dem Tod des letzten kinderlosen Herzogs Johann Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg (1609) die Erbanwärter aus den Häusern Brandenburg und Pfalz-Neuburg die Prägung unter dem Namen possidierende Fürsten fortsetzten, gewann der Stüber an Boden. Vor allem Brandenburg ließ für Kleve Schillinge zu 6 Stüber prägen, die Blamüser genannt wurden. zurück "Stückelung" ist ein münztechnischer Begriff für das Ausschneiden der Schrötlinge aus den Zainen, das früher von Hand mit der Benehmschere oder mechanisch mit dem Durchschnitt geschah. Heute wird das Stückeln durch die Schneidewerkzeuge eines automatischen Stanzwerkes erledigt. Metrologischer Begriff für die Teilung eines Ganzen, wie z.B. die Mark in zwei 50-Pfennig-Stücke, zehn 10-Pfennig-Stücke usw. unterteilt oder gestückelt wird. Von den mittelalterlichen Denaren oder den Brakteaten wurden keine oder nur selten Teilstücke (Obole) geprägt. Um Teilbeträge oder Ausgleichszahlungen leisten zu können, mußten die Pfennigmünzen gestückelt, d.h. zerbrochen oder zerschnitten werden. In den britischen Kolonien der Karibik und teilweise in Südamerika behalf man sich im 18./19. Jh. bei Kleingeldmangel mit der Stückelung von Großsilbermünzen, wobei man dann vom sog. Cut Money sprach. zurück Unter "Stückelungsplus" (englisch: Shere; österreichisch: Schärübertrag) versteht man eine über die vorgeschriebene Menge hinausgehende Anzahl aus einer Gewichtseinheit geprägter Münzen, also eine ungesetzliche Änderung des Münzfußes, die bei der Massenanfertigung von Münzen bis ins 18. Jh. hinein eine unerlaubte Gewinnquelle für den Münzmeister war. Das Stückelungsplus soll teilweise bis zu 6 Prozent des vermünzten Materials ausgemacht haben. Ähnlich wie die Falschmünzerei wurde es deshalb unter Strafe gestellt. zurück  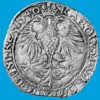 Ursprünglich war der "Stuiver" eine spätmittelalterliche Groschenmünze (Doppelgroot oder Plak) der Grafen von Flandern, die zur wichtigsten Kleinmünze und Rechnungsmünze in den Niederlanden bis zur Einführung der Dezimalwährung (1815) wurde. Als burgundische Nachahmungen der flämischen Groschenmünze den Feuerstahl des Ordens vom Goldenen Vlies (Briquet) zeigten, kam der Name "Stuiver" (von niederländisch: "stuiven" = deutsch: "Funken stieben") in Gebrauch. Es wurden Einfach- und Doppelstücke (Dubbeltje) geschlagen. Bis ins 16. Jh. wurde der "Stuiver" in den verschiedenen Provinzen unterschiedlich bewertet. Der Lütticher Stuiver galt nur 1/4 des Stuivers von Brabant, der geldrische 3/4 des brabantischen. Nach der Unabhängigkeit der Generalstaaten galten einheitlich 60 Stuiver einen Dukaten, 50 Stuiver einen Rikjksdaaler, 20 Stuiver einen niederländischen Gulden und 6 Stuiver einen Schelling. Ein Stuiver war zunächst in 4, später in 8 Duits (Deuts) unterteilt. Gemäß der wirtschaftlichen Bedeutung der Niederlande kam die Münze bald auch im nordwestdeutschen, rheinischen und westfälischen Raum vor und wurde dort unter dem Namen "Stüber" nachgeahmt und beigeschlagen, besonders in Ostfriesland, Westfalen und den (nördlichen) Rheinlanden. In den niederländischen Kolonien liefen meist Stuiver aus Kupfer um. Ursprünglich war der "Stuiver" eine spätmittelalterliche Groschenmünze (Doppelgroot oder Plak) der Grafen von Flandern, die zur wichtigsten Kleinmünze und Rechnungsmünze in den Niederlanden bis zur Einführung der Dezimalwährung (1815) wurde. Als burgundische Nachahmungen der flämischen Groschenmünze den Feuerstahl des Ordens vom Goldenen Vlies (Briquet) zeigten, kam der Name "Stuiver" (von niederländisch: "stuiven" = deutsch: "Funken stieben") in Gebrauch. Es wurden Einfach- und Doppelstücke (Dubbeltje) geschlagen. Bis ins 16. Jh. wurde der "Stuiver" in den verschiedenen Provinzen unterschiedlich bewertet. Der Lütticher Stuiver galt nur 1/4 des Stuivers von Brabant, der geldrische 3/4 des brabantischen. Nach der Unabhängigkeit der Generalstaaten galten einheitlich 60 Stuiver einen Dukaten, 50 Stuiver einen Rikjksdaaler, 20 Stuiver einen niederländischen Gulden und 6 Stuiver einen Schelling. Ein Stuiver war zunächst in 4, später in 8 Duits (Deuts) unterteilt. Gemäß der wirtschaftlichen Bedeutung der Niederlande kam die Münze bald auch im nordwestdeutschen, rheinischen und westfälischen Raum vor und wurde dort unter dem Namen "Stüber" nachgeahmt und beigeschlagen, besonders in Ostfriesland, Westfalen und den (nördlichen) Rheinlanden. In den niederländischen Kolonien liefen meist Stuiver aus Kupfer um.zurück Hierbei handelt es sich um Münzen ohne jede Legende (zu Beginn der Münzprägung üblich) oder auch Münzen mit vorgetäuschten, nicht identifizierbaren Trugschriften, wie sie vor allem bei Nachahmungen in der Völkerwanderungszeit und noch im Mittelalter häufig vorkamen. zurück Allgemeine Bezeichnung für "matt", "glanzlos" bzw. "unscharf" (englisch: dull, französisch: mat bzw. terne). zurück Stuttgart ist eine Stadt in Württemberg, die auch heute noch eine Münzstätte besitzt. Am 17.01.1374 wurde Graf Eberhard II. von Württemberg durch Kaiser Karl IV. das Recht der Münzprägung verliehen. Heute gehört Stuttgart zu den deutschen Münzprägeanstalten und verwendet das Münzzeichen "F". zurück Alternative Bezeichnung für Brandschuttmünzen. zurück Dies ist die volkstümliche Bezeichnung für das silberne 1-Öre-Stück SM (für schwedisch: "Sölff Mynt" = deutsch: "Silbermünze") nach der Mitte des 17. Jh. in Schweden. Nach 1776 ging der Name auf die Münzen zu 1/6 Skilling Banco und 1/4 Skilling Riksgälds über. zurück Hierbei handelt es sich um eine Besonderheit der Penny-Prägung des Königreichs Northumbria (England) im 8./9. Jh. n.Chr. Ausgehend vom Sceatta entwickelte sich im restlichen England ein breiterer Pfennig, während sich in Northumbria eine reine Kupferprägung entwickelte, die erst mit der Eroberung Yorks durch die Wikinger 866/67 endete. Der kupferne Styca wiegt ca. 1,2 g und sein Gepräge ist sehr einfach (meist Kugeln, Punkte und Kreuze). Die Umschriften nennen den König oder den Erzbischof von York. Die Styca-Prägung wurde von verwilderten Imitationen begleitet, deren Herkunft ungewiss ist. Die Funde lassen vermuten, daß diese gemeinsam mit den regulären Stücken umliefen. Die Bezeichnung "Styca" wurde abgeleitet vom altenglischen Wort "Stycce" (deutsch: "Stück") und stammt aus dem 17. Jh. zurück Englisch für "Ausführung". zurück Alternative Schreibweise für Stuyver. zurück Länderkennzeichen für die Sowjetunion. zurück Hierbei handelt es sich um ein deutsches Schutzgebiet in Ostafrika, das auch als Witu-Schutzgebiet bekannt ist. zurück Hierbei handelt es sich um antike Münzen, die unter einem dünnen Überzug aus Edelmetall einen Kern aus unedlem Metall aufweisen. Diese werden auch als subaerate Münzen bezeichnet, wobei es sich nicht unbedingt um Fälschungen handeln muß. zurück Alternative Bezeichnung für Subaerat. zurück Englisch für "Untertype" (französisch: variété). zurück Englisch für "Untertype" (französisch: variété). zurück Hierbei handelt es sich um eine Währungsmünze im südamerikanischen Ecuador, benannt nach dem Befreiungsgeneral und ersten Präsidenten der verfassungsgebenden Versammlung Kolumbiens, Antonio José de Sucre, dessen Bildnis die Münze zeigt. Der "Sucre" wurde 1884 als schwere Silbermünze (Peso) eingeführt, in den Jahren 1899 und 1900 gab es goldene 10-Sucres-Stücke im Gewicht von 8,136 g (900/1000 fein). Inzwischen wird er aus Nickel (mit Stahlkern) geprägt und sein Wert ist stark gesunken. Es gelten 100 Centavos = 1 Sucre und 25 Sucre = 1 Condor. zurück In der Burg Suczava wurden 1895 die Reste einer Falschmünzerwerkstatt gefunden, aus der eine Masse von Münzfälschungen des 17. Jh. stammen, vor allem Solidi (Schillinge), die unter den schwedischen Königen in Riga und Livland geprägt wurden. Die Falschmünzerwerkstatt an der Moldau schädigte vor allem das Münzwesen von Riga. Auch Fälschungen brandenburgisch-preußischer Solidi sollen aus der Burg Suczava stammen. zurück Länderkennzeichen für den Sudan. zurück  Die Republik &&Sudan&& (arabisch: Dschumhuriyyat as-Sudan) ist ein Staat in Nordost-Afrika mit Zugang zum Roten Meer und grenzt im Norden an Ägypten und Libyen, im Westen an den Tschad und die Zentralafrikanische Republik, im Süden an die Demokratische Republik Kongo, Uganda und Kenia und im Osten an Äthiopien und Eritrea. Die Republik &&Sudan&& (arabisch: Dschumhuriyyat as-Sudan) ist ein Staat in Nordost-Afrika mit Zugang zum Roten Meer und grenzt im Norden an Ägypten und Libyen, im Westen an den Tschad und die Zentralafrikanische Republik, im Süden an die Demokratische Republik Kongo, Uganda und Kenia und im Osten an Äthiopien und Eritrea.Mit einer Fläche von über 2,5 Millionen Quadratkilometern ist das Land etwa siebenmal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland und größter Flächenstaat des Kontinents. Der Sudan war britisch-ägyptisches Kondominium, erhielt am 12.02.1953 die innere Selbstverwaltung und wurde am 01.01.1956 unabhängige Republik. Amtssprache: Arabisch Hauptstadt: Khartum Staatsform: Präsidialrepublik Fläche: 2.505.810 qkm Einwohnerzahl: 36 bis 41 Mio. (2006) Bevölkerungsdichte: 14 bis 16 Einwohner pro qkm BIP/Einwohner: 718 US-Dollar (Stand: 2005) Unabhängigkeit: 01.01.1956 Zeitzone: UTC+3, MEZ+2 Währung: Sudanesisches Pfund (SDG) zurück zurück Das (neue) "Sudanesisches Pfund" (arabisch: Dschineh sudani; ISO-4217-Code: SDG ) ist seit dem 09.01.2007 die Währung des Sudan und ersetzte während einer Übergangszeit bis zum 30.06.2007 den Sudanesischer Dinar im Verhältnis 100 zu 1. Der Dinar hatte 1991 das (alte) sudanesische Pfund (SDP) im Verhältnis 10 zu 1 ersetzt. Es gibt Münzen zu 1, 5, 10, 20 und 50 Piaster sowie Banknoten zu 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Sudanesischen Pfund. zurück  Die Republik &&Südafrika&& ist ein Staat an der Südspitze Afrikas. Das Land liegt zwischen 22 und 35 Grad südlicher Breite sowie zwischen 17 und 33 Grad östlicher Länge. Im Süden und Südosten grenzt das Land an den Indischen Ozean und im Westen an den Atlantischen Ozean. Im Norden liegen die Nachbarländer Namibia, Botswana und Simbabwe, östlich davon Mocambique und Swaziland. Das Königreich Lesotho ist eine Enklave, wird also vollständig von Südafrika umschlossen. Die Republik &&Südafrika&& ist ein Staat an der Südspitze Afrikas. Das Land liegt zwischen 22 und 35 Grad südlicher Breite sowie zwischen 17 und 33 Grad östlicher Länge. Im Süden und Südosten grenzt das Land an den Indischen Ozean und im Westen an den Atlantischen Ozean. Im Norden liegen die Nachbarländer Namibia, Botswana und Simbabwe, östlich davon Mocambique und Swaziland. Das Königreich Lesotho ist eine Enklave, wird also vollständig von Südafrika umschlossen.Am 31.05.1910 schlossen sich die ehemaligen britischen Kolonien Kap der Guten Hoffnung, Natal, Oranjefluß und Transvaal zur "Union von Südafrika" zusammen. Am 31.05.1961 nannte sich der Staat in "Republik von Südafrika" um. Von den 1959 als Reservate für die schwarze Bevölkerung eingerichteten "Homelands" wurden ab 1976 die Transkei, Bophuthatswana, Venda und die Ciskei unabhängig. Seit dem 27.04.1994 sind sie aber wieder Teil von Südafrika. Amtssprache: Afrikaans, Englisch, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, Nord-Sotho, Süd-Sotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga Hauptstadt: Tshwane/Pretoria Regierungssitz: Exekutive Tshwane/Pretoria, Legislative Kapstadt, Judikative Bloemfontein Staatsform: Präsidialrepublik mit föderalen Elementen Fläche: 1.219.912 qkm Einwohnerzahl: 46,880 Mio. (2005) Bevölkerungsdichte: 38 Einwohner pro qkm BIP: 255 Mrd. US-Dollar (2006) BIP/Einwohner: 5.384 US-Dollar (2006) Unabhängigkeit: 31.05.1910 Zeitzone UTC: +2 Währung: Rand zurück &&Bophuthatswana&& war ein Homeland im nördlichen Südafrika. Es bestand aus sieben Enklaven, verstreut über die ehemaligen südafrikanischen Provinzen Kapprovinz, Transvaal und Oranje Freistaat und umfaßte etwa 40.000 qkm. Die Hauptstadt Mmabatho lag in einem unmittelbar an Botswana grenzenden Landesteil. Bophuthatswana wurde als Homeland für alle Tswana sprechenden Volksgruppen gegründet. 1989 betrug die Anzahl der Einwohner etwa 1,5 Mio. und außerhalb des Homelandes lebten weitere 1,356 Mio. Tswana. Von der südafrikanischen Regierung wurde Bophuthatswana 1971 die Selbstverwaltung übertragen. Am 05.12.1977 wurde das Homeland in die Unabhängigkeit entlassen. Alle Einwohner Bophuthatswanas mußten die südafrikanische Staatsangehörigkeit aufgeben. Dieser Status wurde international jedoch nicht anerkannt. Am 27.04.1994 wurde Bophuthatswana wieder mit Südafrika vereinigt. zurück Die &&Ciskei&& ("diesseits des Kei") war ein Homeland im Südosten von Südafrika. Das 7.760 qkm große Homeland wurde 1961 im Rahmen der Apartheidspolitik der "Bantustanisierung" neben Transkei als Heimat der Xhosa sprechenden Einwohner des Landes errichtet. Ab den 1970er Jahren begann die südafrikanische Regierung mit der Umsiedlung der xhosasprachigen Bevölkerung dorthin. Zuletzt lebten von über 6 Mio. Xhosa etwa 645.000 in Ciskei. Hauptstadt von Ciskei war Bisho. 1971 entstand eine Gesetzgebende Versammlung, und 1972 erhielt Ciskei weitgehende Selbstverwaltung. 1973 wurde Lennox Leslie Sebe der Regierungschef des autonomen Staates. Bei den zweiten Wahlen in die Versammlung 1978, zu denen alle inner- und außerhalb wohnenden Ciskei-Xhosa wahlberechtigt und Parteien zugelassen waren, gewann die Ciskei National Independence Party (CNIP) des Regierungschefs Lennox Leslie Sebe alle 50 zur Wahl stehenden Sitze. Eine 1979 eingesetzte Kommission sprach sich vor allem aus wirtschaftlichen Gründen gegen die Abtrennung von Südafrika aus. 1980 fand eine Volkszählung statt. Ciskei hatte damals 630.353 Einwohner (Xhosas ohne die kleine weiße Minderheit und Mischlinge, genannt Coloureds). Weitere 442.000 Ciskeier waren als "Gastarbeiter" in der Republik Südafrika tätig. In einem Referendum über die geplante Unabhängigkeit im Dezember 1980 sprachen sich 98,7 Prozent der Wähler für die Unabhängigkeit von Südafrika aus. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,5 Prozent. Am 04.12.1981 wurde Ciskei, wie zuvor 1976 Transkei, 1977 Bophuthatswana und Venda in die formelle Unabhängigkeit von Südafrika entlassen, war finanziell jedoch immer von Südafrika abhängig. Alle Bewohner von Ciskei verloren dadurch die südafrikanische Staatsangehörigkeit. International wurde die Unabhängigkeit der vier Homelands jedoch nicht anerkannt. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verurteilte am 15.12.1981 die behauptete Unabhängigkeit von Ciskei und erklärte sie für nichtig. Da der vorläufige Verwaltungssitz Zwelitsha mit 35.000 Einwohnern ungeeignet erschien, wurde mit dem Bau der neuen Hauptstadt Bisho (Bicho) begonnen. Die Fläche von Ciskei wuchs durch Abrundungen auf ca. 8.300 qkm. Der Staatshaushalt, der zu 50 Prozent von Südafrika getragen wurde, betrug 1981 rund 82,146 Mio. Rand. Am 27.04.1994 wurde Ciskei zusammen mit den neun anderen Homelands wieder mit Südafrika vereinigt. Es gehört heute zur Provinz Ostkap. zurück Die &&Transkei&& ("jenseits des Kei") war das erste der ehemaligen autonomen Bantu-Verwaltungsgebiete im östlichen Kapland in Südafrika. Die Fläche betrug 43.800 qkm und die Einwohnerzahl ca. 3,2 Mio. Menschen. Mit der Hauptstadt Umtata erhielt Transkei als Homeland innerhalb der Apartheidspolitik Südafrikas begrenzte autonome Rechte. Von 6,240 Mio. Xhosa lebten 1989 2,93 Mio. in Transkei. Die einzige Hafenstadt war Port St. Johns. Seit 1963 verfügte Transkei über innere Selbstverwaltung und wurde als erstes Bantu-Homeland am 26.10.1976 formal in die volle Unabhängigkeit entlassen. Die Unabhängigkeit wurde jedoch international nie anerkannt. 1978 brach Transkei die diplomatischen Beziehungen zu Südafrika ab. 1987 wurde der Staatschef Kaizer Matanzima, ein Neffe Nelson Mandelas, nach einem Militärputsch durch Bantu Holomisa ersetzt. Mit dem Ende der Apartheidspolitik und den ersten allgemeinen Parlamentswahlen in Südafrika vom 26. bis 29.04.1994 wurde Transkei wieder ein Teil der Republik Südafrika und in die südafrikanische Provinz Ost-Kap eingegliedert. zurück &&Venda&& war ein 6.875 qkm großes Homeland im nördlichen SSüdafrika, in der heutigen Provinz Limpopo. Es wurde für die Ethnie der Venda gegründet. Von 520.000 Venda lebten 1989 340.000 im Homeland. Am 01.02.1973 wurde es in die Selbstverwaltung entlassen. Am 13.09.1979 erklärte die südafrikanische Regierung das Homeland als unabhängig und ihre Bewohner verloren die südafrikanische Staatsbürgerschaft. Tatsächlich war Venda jedoch stets finanziell und politisch von Südafrika abhängig. Wie bei den übrigen Homelands auch wurde die Unabhängigkeit Vendas international nie anerkannt. D as Homeland bestand aus einer Serie unzusammenhängender Territorien im damaligen Transvaal, mit einem Hauptteil und einer Hauptexklave. 1990 wurde die Regierung durch einen Volksaufstand vorübergehend abgesetzt. Am 27.04.1994 wurde das Homeland wieder in Südafrika eingegliedert und ist heute Teil der Provinz Limpopo. zurück Offizielle Bezeichnung für Südafrika. zurück Die Südafrikanische Zollunion bzw. Zollunion des südlichen Afrika (englisch: Southern African Customs Union, abgekürzt: SACU) ist ein Zusammenschluß von Lesotho, Namibia, Südafrika und Swaziland auf Basis eines gemeinsamen Zollabkommens. Die SACU geht auf eine Zollunion zwischen der Südafrikanischen Union, Betschuanaland, Swaziland und Basutoland aus dem Jahr 1910 zurück. Südwestafrika (Namibia) kann als De-facto-Mitglied der SACU ab 1918 angesehen werden, da es ab diesem Zeitpunkt unter der Fremdverwaltung durch Südafrika stand. Die SACU ist damit die älteste noch bestehende Zollunion der Welt, da die bereits 1889 zwischen der britischen Kolonie Kap der Guten Hoffnung und dem Oranjefreistaat gegründete Zollunion als unmittelbarer Vorläufer der SACU angesehen wird. 1969 und 2002 wurde die Südafrikanische Zollunion durch neue Verträge inhaltlich neu ausgestaltet. Parallel zur SACU betreiben deren Mitgliedsländer, mit Ausnahme Botswanas, eine gemeinsame Währungspolitik, da die Währung der vier anderen Staaten innerhalb der SACU an den Südafrikanischen Rand gekoppelt ist. zurück Der "Südafrikanische Rand" (ISO-4217-Code: ZAR; Abkürzung: R) ist die Währung von Südafrika. Er wird auch kurz als "Rand" bezeichnet. zurück Die &&Südarabische Föderation&& existierte zwischen 1962 und 1967 als eine Organisation von Staaten unter britischem Protektorat. Aus ihr entwickelte sich die Demokratische Volksrepublik Jemen. Sie wurde am 04.04.1962 aus den fünfzehn Protektoratsstaaten der Föderation der Arabischen Emirate des Südens gebildet und am 18.01.1963 mit der britischen Kronkolonie Aden vereinigt. Im Juni 1964 kam das Upper Aulaqi Sultanat dazu, womit die Föderation siebzehn Staaten umfaßte. 1966 entsandte die Föderation ein eigenes Team zu den Commonwealth Games in Kingston/Jamaika. Die Föderation wurde abgeschafft, als sie am 30. November gemeinsam mit dem Protektorat von Südarabien als Volksdemokratische Republik Jemen die Unabhängigkeit von Großbritannien erlangte. zurück Das "Südafrikanische Pfund" war die (alte) Währung von Südafrika. Es wurde im Jahr 1961 durch den Rand ersetzt. zurück Südaustralien war eine britische Kolonie und ist heute ein Teilstaat von Australien. zurück Der "Süddeutsche Münzverein" war ein Zusammenschluß süddeutscher Staaten ab 1837. Die Taler der Jahre 1837 bis 1856 waren Doppeltaler mit einem Raugewicht von ca. 37,12 g und einem Feingewicht von ca. 33,41 g Silber, was einem Feingehalt von 900/1000 entspricht. zurück Französisch für Schweden. zurück Die britische Kolonie Süd-Georgien, die bis 1962 zu den Falkland-Inseln gehörte, bildet seit 1985 zusammen mit den Süd-Sandwich-Inseln ein eigenständiges Gebiet unter dem Namen Süd-Georgien und Süd-Sandwich-Inseln. zurück Die britischen Kolonien Süd-Georgien und Süd-Sandwich-Inseln gehörten bis 1962 zu den Falkland-Inseln und bilden seit 1985 zusammen ein eigenständiges Gebiet unter dem Namen Süd-Georgien und Süd-Sandwich-Inseln. zurück Der Südjemen entstand am 30.11.1967 aus dem Zusammenschluß der Südarabischen Föderation mit den Fürstentümern des britischen Protektorats Aden. Die sog. "Unabhängige Volksrepublik Jemen" nannte sich 1970 in "Demokratische Volksrepublik Jemen" um und vereinigte sich am 22.05.1990 mit der Arabischen Republik Jemen zur Republik Jemen. zurück zurück Süd-Kasai ist eine Provinz der Republik Kongo, die sich im August 1960 für unabhängig erklärte. Der Abfall wurde 1962 in einer gemeinsamen Militäraktion der UNO und der Regierung in Kinshasa beendet. zurück Süd-Nigeria war eine britische Kolonie in Afrika im Tiefland beiderseits der Nigermündungen. zurück Die britische Kolonie Süd-Orkney-Inseln, die bis 1962 zu den Falkland-Inseln gehörte, zählt heute zu den Britischen Gebieten in der Antarktis. zurück Bezeichnung für die britische Kolonie südlich des Sambesi in Afrika. zurück Die britische Kolonie Süd-Sandwich-Inseln, die bis 1962 zu den Falkland-Inseln gehörte, bildet seit 1985 zusammen mit Süd-Georgien ein eigenständiges Gebiet unter dem Namen Süd-Georgien und Süd-Sandwich-Inseln. zurück Die "südschwäbischen Brakteaten" gehören zu den sog. Bodenseebrakteaten. Nach 1230 beteiligten sich u.a. auch die Grafen von Markdorf, Montfort, Heiligenberg und Kyburg, kleine staufische Münzstätten, Kaufbeuren, Memmingen, Biberach und Buchau sowie die Münzstätten Buchhorn, Isny, Leutkirch und sogar schon das verhältnismäßig entfernte Ulm an der Prägung der Brakteaten. Damit waren die Hohlpfennige schon weit bis in den schwäbischen Raum hinein verbreitet. zurück Die britische Kolonie Süd-Shetland-Inseln, die bis 1962 zu den Falkland-Inseln gehörte, zählt heute zu den Britischen Gebieten in der Antarktis. zurück Kurzbezeichnung für den südlichen, nichtkommunistischen Teil von Vietnam. zurück Südwestafrika (Afrikaans: Suidwes Afrika, Englisch: Southwest Africa) war die Bezeichnung Namibias während seiner Fremdverwaltung durch Südafrika in den Jahren 1918 bis 1990. 1920 wurde die ehemalige Kolonie Deutsch-Südwestafrika (1884-1918) Völkerbundsmandat von Südafrika. Im Oktober 1966 wurde das Mandat entzogen und 1990 wurde das Land unabhängig. zurück Nach Errichtung der Republik Bolivien im Jahre 1825 wurde der Real vom "Sueldo" abgelöst (1852 in Sol umbenannt), bis schließlich 1864 mit der Umstellung auf die Dezimalwährung der Boliviano eingeführt wurde. Es galten 8 Sueldos = 1 Peso. Es gab silberne 1/2-, 1-, 2-, 4- und 8-Sueldo-Stücke (alle 903/1000 fein), letztere im Gewicht von 27 g. Sie zeigen auf den Vorderseite einen Baum zwischen zwei Vikunja (Lamas) als Teil des Landeswappens und auf den Rückseiten den Befreiungsgeneral und Staatsmann Simon Bolivar, nach dem der unabhängige Staat benannt wurde. zurück Arthur Suhle (geb. 21.05.1898 in Berlin; gest. 14.02.1974 in Berlin) war ein deutscher Numismatiker, der sich besonders mit der Numismatik des Mittelalters und der Neuzeit sowie mit Medaillen beschäftigte. Er war ab 1921 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Münzkabinett in Berlin tätig und 1922 zum Kustos ernannt, 1928 zum Kustos und Professor. Nach dem Tode von Kurt Regling war er von 1935 bis 1945 kommissarischer Leiter des Münzkabinetts und von 1945 bis 1973 war er dessen Direktor. Daneben unterrichtete er von 1946 bis 1962 als Professor an der Humboldt-Universität in Berlin. zurück Afrikaans für Südwestafrika. zurück Französisch für Schweiz. zurück Französisch für Serie. zurück Bei den "Suiten-Medaillen" handelt es sich um eine Folge (französisch: "suite") von Medaillen, die ein innerer Zusammenhang verbindet, wie Herrscher aus derselben Dynastie oder berühmte Persönlichkeiten. Sie werden oftmals nach dem Tod des verehrten Herrschers herausgegeben. Häufig weisen schematische Kennzeichen der äußeren Gestaltung wie gleicher Durchmesser oder gleiche Gestaltung einer Seite darauf hin, daß es sich um eine Suite oder Serie handelt. Manchmal sind die Seriennummern angegeben. Das Aufkommen der Medaille in der Renaissance, ursprünglich meist Auftragsarbeiten der Herrscher, die sich für die Nachwelt verewigen wollten, bot das ideale Medium für Suiten. Im 16. Jh. entstanden mehrere "Medaillensuiten" auf die Päpste. Auf die Gesandten des Friedensschlusses zu Münster (1648) fertigte Vestner später eine Medaillensuite. Im 18. Jh. folgten Suiten auf die Zaren von Rußland, die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und die Könige von Frankreich. Aus dem Atelier von Christian Wermuth stammen die umfangreichen Suiten mit 250 Papst-Medaillen und 211 römischen Kaisern. Franz Andreas Schega schuf eine Suite auf die bayerischen Fürsten der Wittelsbacher. Im 18. und 19. Jh. entstanden auch Suiten auf "berühmte Männer", wie z. B. eine Medaillensuite auf Reformatoren von Jean Dassier. Die Suitenmedaille stand auf Grund der fehlenden Authentizität lange in der Kritik, denn die Dargestellten, die ja schon lange verstorben waren, mußten Zeichnungen, Kupferstichen und Büsten nachempfunden oder sogar frei erfunden werden. Um zu kennzeichnen, daß es sich um lebensechte Porträts handelte, trugen deshalb Medaillen (zusätzlich zu den Herstellungsformeln "fecit" oder "sculpsit") den Zusatz "ad vivum" (meist "ad viv." oder "A.V." abgekürzt). Heute werden Suitenmedaillen wieder gesammelt, aber ganze Serien sind schwer zu bekommen bzw. teuer. In jüngster Zeit kamen Serienmedaillen oder sog. "Medailleneditionen" heraus, die nach thematischen Schwerpunkten gefertigt werden, z. B. Folgen von Nobelpreisträgern oder Fußballspielern. Dadurch müssen nicht einzelne Medaillen verkauft werden, sondern es können gleich ganze Serien im Abonnement zum Kauf angeboten werden. zurück Bei den "Suiten-Münzserien" handelt es sich um eine Folge (französisch: "suite") von Münzen, die ein innerer Zusammenhang verbindet, wie Herrscher aus derselben Dynastie oder berühmte Persönlichkeiten. Sie werden oftmals nach dem Tod des verehrten Herrschers herausgegeben. Häufig weisen schematische Kennzeichen der äußeren Gestaltung wie gleicher Durchmesser oder gleiche Gestaltung einer Seite darauf hin, daß es sich um eine Suite oder Serie handelt. Manchmal sind die Seriennummern angegeben. Als erste Münzserie gelten baktrische Tetradrachmen aus der gemeinsamen Regierungszeit des Antimachos und Agathokles (171-160 v.Chr.), die sie herausgaben, um sich in der Auseinandersetzung mit dem Usurpator Eukratides (171-135 v.Chr.) als berechtigte Nachfolger zu legitimieren. Die Folge zeigt auf den Vorderseiten die Ahnenreihe beginnend mit dem für Alexander den Großen gehaltenen Herakleskopf, dann die Bildnisse des Seleukidenkönigs Antiochos, des Diodotes (Gründer des baktrischen Reichs) und schließlich dessen Nachfolger Euthydemos. Die Rückseiten zeigen Herakles oder Zeus und sind mit Namen und Monogramm der beiden baktrischen Herrscher beschriftet. Unter den römischen Prägungen der Römischen Kaiserzeit auf verehrte Vorgänger ragt die Antoninian-Serie unter Kaiser Decius (248-251 n.Chr.) heraus, die elf römische Kaiser zeigt. zurück zurück zurück Hierbei handelt es sich um eine sehr selten geprägte Währungsmünze in Indonesien bis ins 19. Jh. Es galt 1 Suku = 100 Kepings = 1/4 Spanischer Dollar (8 Reales). zurück "Sultan" heißt arabisch soviel wie "Herrschaftsgewalt" und war der Titel unabhängiger Herrscher in einem islamischen Gebiet (Sultanat), der in der Regel vom Kalifen verliehen wurde. Der erste Herrscher mit dem Beinamen "Sultan" war Mahmut von Gazna (999-1030). Auf Münzen kommt der Name erstmals auf solchen des Seldschuken Tugril Beg (1038-1063) vor. Bei den ägyptischen Fatimiden war der Titel "Sultan al-Islam", bei den Bujiden "Sultan ad-Daula" gebräuchlich. Bekannt ist der Titel vor allem im Zusammenhang mit den Herrschern des Osmanischen Reiches, die den Titel bis 1922 trugen. Auf Münzen sind die Namen der osmanischen Sultane in Form einer Tughra dargestellt. Heute tragen nur noch die Herrscher der Sultanate Brunei und Oman den Titel. zurück Ein "Sultanat" ist das Herschaftsgebiet eines Sultans. Heutzutage wird die Staatsgewalt von einem Sultan nur noch in wenigen Ländern mit eigener Münzprägung ausgeübt, nämlich in Brunei und im Oman. zurück Offizielle (deutsche) Bezeichnung für den Oman. zurück Wegen der Darstellung einer Sonnenuhr wurden die Fugio-Cents auch als "Sun-dial-Cents" bezeichnet. zurück Sungei Ujong gehörte zu den malaiischen Staaten. zurück Offizielle finnische Bezeichnung von Finnland. zurück Eigenname von Finnland. zurück zurück Lateinische Bezeichnung für einen über allem stehenden absolutischen Fürsten bzw. "Souverän", der die unbeschränkte Staatsgewalt inne hatte (französisch: Souverain). zurück Französisch für "vorzüglich" (englisch: Extremely fine, italienisch: Splendido, niederländisch: Prachtig, spanisch: Extraordinariamente bien conservado). zurück Alternative Schreibweise für Suriname. zurück Deutsche Bezeichnung für den Guilder, die Währungseinheit von Suriname. Es gilt 1 Guilder (Surinam-Gulden) = 100 Cent. zurück  Im Norden grenzt Niederländisch Guyana (heute: &&Suriname&&) an den Atlantik, im Westen an Guyana, im Süden an Brasilien und im Osten an die französische Kolonie Guyana. Im Norden grenzt Niederländisch Guyana (heute: &&Suriname&&) an den Atlantik, im Westen an Guyana, im Süden an Brasilien und im Osten an die französische Kolonie Guyana.Fläche: 163.265 qkm Einwohner: 412.000 Bevölkerungsdichte: 3 Einwohner je qkm Hauptstadt: Paramaribo Amtssprache: Niederländisch Währung: 1 Suriname-Gulden = 100 Cent Staatsform: seit dem 25.11.1975 unabhängige Republik »Niederländisch Guyana« kam auf Beschluß des Wiener Kongresses im Jahre 1815 endgültig zu den Niederlanden. Heute ist das Territorium selbständig und trägt die Bezeichnung "Suriname". zurück Der "Suriname-Dollar" (ISO-4217-Code: SRD) ist die Währung von Suriname. Er wurde 2004 eingeführt und löste den Surinam-Gulden ab. 1.000 Gulden wurden gegen 1 Dollar eingetauscht. zurück zurück Englisch für "Zuschlag" (dänisch: tillaeg, französisch: surtaxe, italienisch: sopratassa, niederländisch: toeslag, portugiesisch: sobretaxa, spanisch: sobretasa). zurück Französisch für "Zuschlag" (dänisch: tillaeg, englisch: surtax, italienisch: sopratassa, niederländisch: toeslag, portugiesisch: sobretaxa, spanisch: sobretasa). zurück Französisch für "ganzflächig" (englisch: all over). zurück Französisch für "einzeilig" (englisch: in one line). zurück zurück Die "Svea" ist die Personifikation Schwedens. zurück Die "Svenska Numismatiska Föreningen" (deutsch: Schwedische Numismatische Vereinigung) wurde 1873 unter dem Namen Nordisk Numismatisk Union gegründet und erbte u.a. im Jahre 1928 die Sammlung von Sven Svensson, die Teil einer Stiftung wurde. zurück Sven Svensson (geb. 1855; gest. 1928) war ein schwedischer Tabakhändler, der angeblich die schönste und umfangreichste, private Sammlung an Münzen und Medaillen besaß. Er vererbte seine Sammlung der Svenska Numismatiska Föreningen. zurück Landesname von Schweden. zurück Schwedische Bezeichnung für die Schwedische Reichsbank. zurück Italienisch für Schweiz. zurück Rätoromanisch für Schweiz. zurück zurück Englisch für "Fluß der Schwäne" und frühere Bezeichnung für die britische Kolonie Westaustralien. zurück Niederdeutsch für schwere Pfennige. zurück Englisch für "Hakenkreuz" (französisch: croix gammée). zurück  &&Swaziland&& ist ein Staat im südlichen Afrika. Es grenzt an Südafrika und Mocambique. Ursprünglich sollte Swasiland nach der Unabhängigkeit von Großbritannien "Ngwana" heißen. &&Swaziland&& ist ein Staat im südlichen Afrika. Es grenzt an Südafrika und Mocambique. Ursprünglich sollte Swasiland nach der Unabhängigkeit von Großbritannien "Ngwana" heißen.Das Binnenhochland zwischen den Drakensbergen und der Lebombo-Kette war britische Kolonie als gemeinsames Kondominium von Großbritannien und Transvaal, die 1894 in die Kolonie Transvaal eingegliedert wurde. Im März 1902 wurde sie wiedererrichtet und erhielt 1967 die innere Selbstverwaltung. Seit dem 06.09.1968 ist Swaziland ein unabhängiges Königreich. Amtssprache: Englisch, Siswati Hauptstadt: Mbabane Regierungssitz: Lobamba Staatsform: Absolute Monarchie Fläche: 17.363 qkm Einwohnerzahl: 1,169 Mio. (2004) Bevölkerungsdichte: 67 Einwohner pro qkm BIP/Einwohner: 298 US-Dollar (2005) Währung: Lilangeni und Rand Unabhängigkeit von Großbritannien: 06.09.1968 Zeitzone: UTC +2 1 Währung: Lilangeni und Rand zurück Englisch für Schweden. zurück Die "Swissmint" oder Eidgenössische Münzstätte in Bern ist die offizielle Münzprägestätte der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Sie ist seit dem 01.01.1998 der Eidgenössischen Finanzverwaltung unterstellt. Ihre Hauptaufgabe ist das Prägen der Umlaufmünzen (5 Rappen bis 5 Franken) für den täglichen Zahlungsverkehr. Daneben produziert sie Sondermünzen, Gedenkmünzen und Medaillen. Sämtliche Prägewerkzeuge (Stempel) werden in der Münzstätte hergestellt, während die ungeprägten Münzplatten zugekauft werden. Weitere Aufgaben der Swissmint sind der Vertrieb der Sammlermünzen, die Zerstörung von verschmutzten, abgenutzten oder beschädigten Geldstücke und die Echtheitsprüfung von verdächtigten Münzen. Der Sitz der Swissmint ist ein von Theodor Gohl entworfenes und nach dreijähriger Bauzeit 1906 in Betrieb genommenes Gebäude an der Bernastrasse 28 im Berner Kirchenfeldquartier. zurück Englische Bezeichnung für die Schweiz. zurück Hierbei handelt es sich um eine schottische Goldmünze im Wert von 120 Shillings (schottisch) oder 6 Pounds (schottisch), die unter König Jakob VI. (1567-1625) in den Jahren 1601 bis 1604 geprägt wurde. Die Goldstücke sind nach der Darstellung auf der Rückseite benannt, die unter der Krone ein Schwert und und ein Zepter (englisch: "sword and sceptre") gekreuzt zeigen. Die Vorderseite zeigt den bekrönten Wappenschild mit dem schottischen Löwen als Wappenbild. Es gab auch Halbstücke. zurück Hierbei handelt es sich um eine schottische Silbermünze zu 30 Shillings schottisch (Ryal), die König Jakob VI. zwischen 1567 und 1582 herausgab. Eine Seite zeigt immer das gekrönte Wappen, wobei es aber verschiedene Rückseitendarstellungen gibt. Zwischen 1567 und 1571 ist ein aufgerichtetes bekröntes Schwert mit einer Hand zu sehen, die auf die Wertzahl (XXX) hinweist. Diese Stücke sind häufig mit einer gekrönten Distel gegengestempelt, die ihre Werterhöhung auf 36 Shillings 9 Pence (schottisch) kennzeichnen. Seit 1582 ist das Hüftbild des Königs mit gezücktem Schwert nach links dargestellt. In diesem Typ wurde 1582 auch ein Stück zu 40 Shillings ausgegeben. zurück Länderkennzeichen für die Seychellen. zurück   Sybaris war eine griechische antike Stadt am Golf von Tarent. die Stadt wurde um 720 v.Chr. an der Ostküste Kalabriens als Kolonie von Achaiern aus Helike sowie einigen Troizenern gegründet und gelangte durch die Fruchtbarkeit des Gebiets und durch Handel bald zu bedeutender Macht und Größe. Sybaris besaß auch eine eigene Münzstätte. Sybaris war eine griechische antike Stadt am Golf von Tarent. die Stadt wurde um 720 v.Chr. an der Ostküste Kalabriens als Kolonie von Achaiern aus Helike sowie einigen Troizenern gegründet und gelangte durch die Fruchtbarkeit des Gebiets und durch Handel bald zu bedeutender Macht und Größe. Sybaris besaß auch eine eigene Münzstätte.zurück Hierbei handelt es sich um chinesische Silberbarren in verschiedenen Formen (meist bootförmig), die in China bis um 1935 verbreitet waren und der Bezahlung größerer Beträge im Handel und als Geldanlage dienten. Die Benennung "Sycee" (ausgesprochen: "Saisi") leitet sich wohl vom chinesischen "Si-tsu" (deutsch: "feine Seide") ab und bezieht sich auf die seidenfadenähnlichen Linien, die sich nach dem Guß der Barren auf der Oberfläche zeigten. Die Sammlerbezeichnung "Seidenschuh-" oder "Schuhgeld" geht auf die Form der Stücke zurück, die wie die Seidenschuhe aussehen, die die kleinen (verkrüppelten) Füße der vornehmen Damen schmückten. Die Verwendung von Silberbarren soll in China bis weit in die vorchristliche Zeit zurückgehen. Das erste Sycee-Silber soll im 13./14. Jh. gegossen worden sein. In der Neuzeit wurde es immer beliebter und kam als Währung im 19. Jh. in Gebrauch. Es wurde meist privat gegossen, oft mit Zeichen von Banken oder Unternehmen versehen, die Gewicht und Feingehalt garantierten. Man kennt es in Gewichten von 1/10 bis 100 Tael. Das Gewicht des Tael ist regional stark schwankend, meist werden 36 bis 37 g angegeben. Die kleineren Stücke von Teilgewichten bis zu 5 Tael wurden oft als Geschenke verwendet. Durch das Interesse der Sammler stieg ihr Sammelwert. Besonders alte Stücke, seltene Formen und von berühmten Banken herausgegebene Stücke sind wertvoll. Nach dem Verbot für Sycee-Silber durch die chinesische Regierung 1935 verschwanden die Stücke bald aus dem Umlauf. zurück Sydney ist eine Stadt in Australien und heute die Hauptstadt des Bundesstaates New South Wales. Sie wurde am 26. Januar 1788 gegründet. Als in der Mitte des 19. Jh. Gold gefunden wurde, entstand eine Münzstätte, die neben dem Sovereign und dessen Halbstück auch viele Token herstellte. zurück Alternative Bezeichnung für Zyfert. zurück "Syli" ist die Bezeichnung der Währungseinheit der westafrikanischen Republik Guinea seit der Währungsreform vom 02.10.1972, als der Staat aus dem Währungsverband des CFA-Francs BCEAO ausstieg. Der Syli ist nach dem Wappentier Guineas (Elefant) benannt. Es galt 1 Syli = 100 Cauris. Durch die Währungsreform vom 06.01.1986 wurde der Syli durch den Guinea-Franc (ohne Unterteilung) ersetzt. zurück Der Terminus "Symbol" (von griechisch: "Etwas Zusammengefügtes") oder auch "Sinnbild" wird im Allgemeinen für Bedeutungsträger (Zeichen, Wörter, Gegenstände, Vorgänge etc.) verwendet, die eine Vorstellung meinen (von etwas, das nicht gegenwärtig sein muß). Welche Vorstellung dann mit dem Wort "Symbol" konkret verbunden werden soll, wird in den verschiedenen Anwendungsgebieten jeweils speziell definiert. zurück Der Symbolismus ist eine Strömung der Malerei und Bildhauerei des ausgehenden 19. Jh. und hatte seine Hochphase in der Zeit zwischen ca. 1880 und 1910. Auch in Literatur und Musik gab es diese Richtung. zurück "Symbolon" ist die Bezeichnung für Marken aus der Zeit der griechischen Antike, die zumeist aus Blei bestanden und deren Zweck nicht immer klar ist. Es waren sowohl Quittungsmarken für Steuern, als auch Eintritts- und Ausweismarken. zurück ISO-4217-Code für die Syrische Lira. zurück Länderkennzeichen für Syrien. zurück   Syrakus war in der Antike die reichste und mächtigste Stadt in Sizilien und wurde 773 v.Chr. von Korinth gegründet. Die Münzprägung begann im letzten Drittel des 6. Jh. v.Chr., wobei es sich um Tetradrachmen handelte, die auf der Quadriga zeigten. Die Statere zeigten einen Reiter. Die Rückseiten trugen im Incusus einen archaischen Frauenkopf, der auf späteren Prägungen von vier Delphinen umspielt wird. Es soll sich um die Quellnymphe Arethusa handeln. Nach dem Sieg des Tyrannen Gelon über die Karthager im Jahre 480 v.Chr. gab es eine Serie von Siegesmünzen. bei denen das Haupt der Arethusa mit einem Lorbeerkranz geschmückt war. Syrakus war in der Antike die reichste und mächtigste Stadt in Sizilien und wurde 773 v.Chr. von Korinth gegründet. Die Münzprägung begann im letzten Drittel des 6. Jh. v.Chr., wobei es sich um Tetradrachmen handelte, die auf der Quadriga zeigten. Die Statere zeigten einen Reiter. Die Rückseiten trugen im Incusus einen archaischen Frauenkopf, der auf späteren Prägungen von vier Delphinen umspielt wird. Es soll sich um die Quellnymphe Arethusa handeln. Nach dem Sieg des Tyrannen Gelon über die Karthager im Jahre 480 v.Chr. gab es eine Serie von Siegesmünzen. bei denen das Haupt der Arethusa mit einem Lorbeerkranz geschmückt war.Zwischen 413 und 390 v.Chr. wurden Dekadrachmen geschlagen, die zum Teil von den Stempelschneidern Kimon und Euainetos signiert sind. Syrakus hatte von allen sizilianischen Städten die umfangreichste Prägetätigkeit, wobei die Münzen nicht nur aus Silber, sondern ab dem 5. Jh. v.Chr. auch schon aus Bronze geschlagen wurden. Münzen aus Gold und Elektron gab es weniger, aber dennoch umfangreicher als die der anderen griechischen Stadtstaaten in diesem Teil des Mittelmeeres. In der klassischen und in der hellenischen Epoche wurden die Münzbilder noch abwechslungsreicher, denn nun findet man auch Gottheiten wie Zeus, Athene, Apollon, Artemis, Herakles und Nike. Außerdem gibt es Porträts von hellenistischen Herrschern. Daneben wurden auch zahlreiche Tiere dargestellt und Fabelwesen wie Pegasos und Hippokamp. Eine letzte Blütezeit der Münzprägung gab es unter Hieronymus II. (215-214 v.Chr.). Nach seinem Tod wechselte die Stadt von der römichen zur karthagischen Seite udn wurde deshalb 212 v.Chr. von den Römern zerstört. Danach gab es nur noch einige Münzen aus Bronze. In der nachrömischen Zeit war Syrakus dann byzantinische Münzstätte spätestens unter Mauricius Tiberius (582-602 n.Chr.) bis zur Einnahme durch die Araber im Jahre 878 n.Chr. Als Münzzeichen wurde "SCL" bzw. "CVRAKOVCI" verwendet. zurück Britische Bezeichnung von Syrien. zurück Offizielle Bezeichnung von Syrien. zurück Französische Bezeichnung von Syrien. zurück  &&Syrien&& (amtlich: Arabische Republik Syrien, arabisch: Al-Dschumhuriyya al-arabiyya as-suriyya) ist ein Staat in Vorderasien und Teil des Maschrek. Syrien grenzt im Süden an Israel und Jordanien, im Westen an den Libanon und das Mittelmeer, im Norden an die Türkei und im Osten an den Irak. &&Syrien&& (amtlich: Arabische Republik Syrien, arabisch: Al-Dschumhuriyya al-arabiyya as-suriyya) ist ein Staat in Vorderasien und Teil des Maschrek. Syrien grenzt im Süden an Israel und Jordanien, im Westen an den Libanon und das Mittelmeer, im Norden an die Türkei und im Osten an den Irak.Syrien erreicht auf etwa 193 Kilometer die Ostküste des Mittelmeeres, direkt nördlich des Staates Libanon. Entlang dieser Küste erstreckt sich eine schmale Ebene. Parallel zu ihr verläuft - in etwa 20 km Abstand zur Küste - das Alawitengebirge, dessen Ostabhang steil zur fruchtbaren Orontes-Ebene abfällt. Eine von Norden nach Süden verlaufende Gebirgskette trennt das Orontes-Tal von der syrischen Hochebene. Diese wird weiter südlich vom Antilibanon-Gebirge mit dem 2.814 Meter hohen schneebedeckten Gipfel des Hermon (arabisch: Dschabal asch-Schaich) gegen Westen abgeschirmt. Syrien war Teil des Osmanischen Reiches und wurde 1918 von arabischen Truppen besetzt. Vom 11. März bis 24. Juli 1920 war es Königreich, stand danach unter französischer Verwaltung und war ab 1922 französisches Mandatsgebiet. Ab dem 28.09.1941 war es unabhängige Republik, wurde aber bis zum 17.04.1946 von französischen und britischen Truppen besetzt. Vom 01.02.1958 bis zum 28.09.1961 war es Teil der Vereinigten Arabischen Republik. Amtssprache: Arabisch Hauptstadt: Damaskus Staatsform: Präsidialrepublik Fläche: 185.180 qkm Einwohnerzahl: 20,102 Mio. (2006) Bevölkerungsdichte: 108,6 Einwohner pro qkm BIP/Einwohner: 1.380 US-Dollar (2004) Währung: Syrische Lira Unabhängigkeit von Frankreich: 17.04.1946 Zeitzone: UTC+2 Währung: Syrische Lira zurück Vom 01.02.1958 bis zum 28.09.1961 gehörte Syrien mit Ägypten zur sog. Vereinigten Arabischen Republik. zurück Die "Syrische Lira" (auch: Syrisches Pfund, arabisch: Al-lira as-suriyya; ISO-4217-Code: SYP) ist die Währung von Syrien. Eine Lira ist in 100 Piaster unterteilt, allerdings sind diese nur noch selten im Gebrauch. Es gibt Banknoten zu 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 und 1.000 Lira, sowie Münzen zu 1, 2, 5, 10 und 25 Lira. Die Syrische Lira ist nicht konvertibel. Die Ein- und Ausfuhr ist verboten. Bei Reisen nach Syrien ist es deshalb nicht ratsam, sich im Ausland mit Lira zu versorgen, zumal der Kurs durch die nicht vorhandene Konvertibilität deutlich ungünstiger ist als in Syrien selbst. zurück Alternative Bezeichnung für die Syrische Lira. zurück Polnischer Name von Stettin. zurück Veraltete Schreibweise für Zepter. zurück zurück Polnisch für Sechsgröscher. | |
| Begriff hinzufügen | nach oben |